30.05. BIS 05.06.2016 Text: Lothar Tölle, Fotos: Gerd Hoffmann
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Documento Di Orientamento Strategico
Regione Campania – Fondi Strutturali Comunitari Obiettivo 1 POR 2000- 2006 Progetto Integrato per la valorizzazione delle risorse archeologiche, architettoniche e paesistiche dei Campi Flegrei Itinerario di valenza culturale di primario interesse regionale Titolarità Regione Campania Documento di orientamento strategico Regione Campania Provincia di Napoli Comune di Bacoli Comune di Monte di Procida Comune di Pozzuoli Comune di Quarto Soprintendenza BAAS di Napoli Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta Commissario per l’attuazione della legge 80/86 Documento redatto a cura della struttura operativa dell’Asse II del POR Campania Approvato dal Tavolo di concertazione il 3.7.2001(Verbale n.3) Ma la riunione è del 12/07/02 1 Regione Campania – Fondi Strutturali Comunitari Obiettivo 1 Scheda sintetica CONTESTO TERRITORIALE: Campi Flegrei COMUNI INTERESSATI DAL PIT: Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto. ASSE DI RIFERIMENTO PRIMARIO: ASSE II Risorse Culturali FINALITA’: Conservare e valorizzare il patrimonio storico culturale dei Campi Flegrei per creare condizioni favorevoli all’innesco di processi di sviluppo locale , favorendo lo sviluppo di iniziative imprenditoriali collegate alla valorizzazione del Bene culturale nei settori dell’artigianato, del turismo, dei servizi e del restauro. Creare le condizioni per l’attrazione di capitali privati nel ciclo di recupero, valorizzazione e gestione dei Beni culturali, anche promuovendo la finanza di progetto. OBIETTIVI GENERALI: a) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, naturale -

Il Turismo Geologico: Aree Protette E Geoparchi
IL TURISMO GEOLOGICO: AREE PROTETTE E GEOPARCHI CAPITOLO 2 IL TURISMO GEOLOGICO: AREE PROTETTE E GEoparcHI Convener: Anna Paganoni Museo Civico di Scienze Naturali, Bergamo; Associazione Italiana Geologia & Turismo, [email protected] Maurizio Burlando Presidente Geoparks Network Italia, Direttore Beigua Geopark, [email protected] Furio Finocchiaro Dipartimento di Matematica e Geoscienze, Università di Trieste, Trieste; Associazione Italiana Geologia & Turismo, [email protected] GEOLOGICAL TOURISM: PROTECTED AREAS AND GEOPARKS Geological tourism holds in Geosites, in protected natural areas, in Geological museums and in Geoparks, privileged places aimed at the conservation and promotion of geological processes, from those that are unique and rare to more common ones (but often clearly evident). Discovering, through promotional events dedicated to geo-tourism, where, when and why phenomena and places are expressions of the Geological Heritage, is the focus of this second session of our Conference. These phenomena are with full rights in the Cultural Heritage of our country not only due to regulatory law but also to the included participation of the geological heritage into our collective and individual identity. Such an heritage must be protected, preserved and known in its excellence spots, but especially loved as it is loaded with an immaterial and symbolic responsibility, an heritage to respect like our own home for the benefit of future generations. Damage and/or loss of each of the elements that form the “Geological heritage” alters forever the possibility of understanding and interpretation. Geology, memory of natural processes, must find ways to convey the complex four-dimensional perspective, where time and space are witnessing climates, environments and different phenomena. -
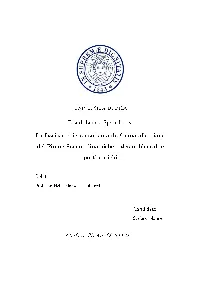
Università Di Pisa
Università di Pisa Tesi di Laurea Specialistica La fascia costiera campana da Cuma alla piana del Fiume Sarno: dinamiche paleoambientali e porti antichi Relatore Prof.essa Nella Maria Pasquinucci Candidato Stefano Marinelli ANNO ACCADEMICO 2010-2011 La Campania è la regione più bella non solo d'Italia, ma di tutto il mondo. Non c'è niente di più dolce del suo clima: basti dire che la primavera vi sboccia due volte. Non c'è niente di più fertile del suo suolo: si dice che là gareggino Cerere e Bacco. Niente di più ospitale del suo mare: vi si trovano i famosi porti di Gaeta e di Miseno, di Baia dalle tepide fonti, il Lucrino e l'Averno, quasi luoghi di riposo del mare. Qui ci sono monti cinti di vigneti, il Gauro, il Falerno, il Massico e, più bello di tutti, il Vesuvio, che rivaleggia col fuoco dell'Etna. Ci sono città volte al mare: Formia, Cuma, Pozzuoli, Napoli, Ercolano, Pompei e la stessa loro capitale Capua, un tempo annoverata fra le tre più grandi città (del mondo) con Roma e Cartagine. (Floro, Campania Felix) Indice Introduzione 1 1 Inquadramento dell'area di studio: il golfo di Napoli 5 1.1 Il territorio dei Campi Flegrei . 7 1.1.1 I laghi costieri . 11 1.2 Il territorio dell'antica Neapolis . 13 1.2.1 Settore occidentale . 15 1.2.2 Settore orientale . 16 1.3 Il settore meridionale del golfo di Napoli . 18 2 Dinamiche paleoambientali nella fascia costiera campana in età storica 22 2.1 Evoluzione del paesaggio costiero dei Campi Flegrei . -

Le Cavità Archeologiche Artificiali Del Golfo Di Napoli
MARENOSTRUM ARCHEOCLUB D‟ITALIA Beni culturali e sviluppo del territorio Potenzialità Archeologiche, Architettoniche e Ambientali della Provincia di Napoli Le cavità archeologiche artificiali del Golfo di Napoli A cura di Dott. Paolo Caputo, archeologo Dott. Rosario Santanastasio, geologo Introduzione Tra i siti archeologici campani le cavità artificiali (cave, ambienti rupestri, riserve d‟acqua, acquedotti, ipogei funerari, gallerie) sono caratterizzate da scarsa visibilità, pur interessando il pubblico, oltre che per i valori storici, soprattutto per fascino evocativo e potere suggestivo connessi all‟immaginario popolare: sacralità e magia, attrazione- repulsione dell‟ignoto, miti dell‟Oltretomba, simbologia di vita-morte, etc.… Sull‟argomento si interfacciano l‟aspetto geologico del territorio di ubicazione e quello archeologico dei contesti storici di realizzazione. Pur riconosciute tra i monumenti significativi d‟età antica della Provincia di Napoli e connesse al sistema di fruizione e valorizzazione dei suoi beni culturali, il turismo che le riguarda necessita tuttavia di incentivazione. Come noto, il vantaggio del potenziale processo di valorizzazione di tali cavità è dato dall‟ubicazione in aree e siti archeologici, del cui originale contesto erano parte: di grande attrazione, possono essere messe “in rete” migliorando il sistema degli attuali contesti socio-ambientali, dei trasporti e dell‟accoglienza, se già accessibili e fruibili. Il vero problema, infatti, è che non tutte le cavità di questo tipo sono attualmente fruibili -

Re-Tour Nei Campi Flegrei …
Re-tour nei Campi Flegrei …. “…un Itinerario in cantiere…” IDEA FORZA: 1) Strutturazione di un itinerario di visita architettonico - archeologico - paesistico di valenza internazionale, costituito da alcuni grandi poli di visita ( Pozzuoli, Baia, Miseno, Monte di Procida - Cappella, lago Fusaro, Cuma, lago di Averno, Quarto) connessi da percorsi di varia natura: nuovi ed antichi tunnel scavati nel tufo; strade romane sommerse, sentieri archeologico - naturalistici, percorsi su ferro, vie del mare. 2) Sviluppo del sistema culturale, ricettivo e produttivo, strettamente collegato al grande patrimonio esistente. Re-tour nei Campi Flegrei….. “…un itinerario in cantiere…” La strategia Il Progetto Integrato nasce in maniera dichiarata dal percorso progettuale e fortemente concertato del Patto Territoriale dei Campi Flegrei avviato nel 1998. Sono previste tre azioni strategiche: 1 Re-tour nei Campi Flegrei….. “…un itinerario in cantiere…” a) Restauro, recupero, riqualificazione e valorizzazione dei seguenti poli di visita: - il Rione Terra di Pozzuoli e l’anfiteatro Flavio - il Parco archeologico di Baia e Castello di Baia - l’antico sito borbonico del lago di Fusaro - il Parco archeologico di Cuma - il Parco archeologico del lago di Averno e della Grotta di Cocceio - il Parco archeologico di Miseno - i percorsi nel paesaggio di Monte di Procida - le aree archeologiche e il c.s. di Quarto b) Tre progetti portanti immateriali: - Animazione e Sensibilizzazione; - Ricerca azione; -Lapis – Laboratorio del progetto integrato di sviluppo; Re-tour nei Campi Flegrei….. “…un itinerario in cantiere…” c) Sviluppo dell’imprenditoria locale attraverso : - Potenziamento del sistema ricettivo; - Nascita e sviluppo di una filiera produttiva nel campo dell’artigianato tradizionale del restauro e dei servizi turistici d) Integrazione e collegamento con le risorse naturalistiche ed agricole del territorio: 2 Re-tour nei Campi Flegrei…. -

INFORMATION MEMORANDUM 2018 Ex Polveriera, Loc
FARI TORRI EDIFICI COSTIERI INFORMATION MEMORANDUM 2018 Ex Polveriera, loc. Miseno – Bacoli (NA) - CAMPANIA FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI INFORMATION MEMORANDUM – Ex Polveriera – Loc. Miseno – Bacoli (NA) CAMPANIA Indice Premessa pag. 4 1. Principi 1.1 Filosofia del progetto pag. 6 1.2 Elementi qualitativi di valutazione della proposta pag. 7 1.3 Nuove funzioni pag. 8 1.4 Modalità di intervento pag. 9 2. Inquadramento territoriale 2.1 Contesto geografico pag. 11 2.2 Sistema infrastrutturale e logistico pag. 12 2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali pag. 13 3. Immobile 3.1 Localizzazione pag. 30 3.2 Inquadramento tecnico-amministrativo pag. 31 3.3 Caratteristiche fisiche pag. 32 2 FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI INFORMATION MEMORANDUM – Ex Polveriera – Loc. Miseno – Bacoli (NA) CAMPANIA 3.4 Qualità architettonica e paesaggistica pag. 33 3.5 Rilevanza storico – artistica pag. 36 3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica pag. 38 4. Iter di valorizzazione e strumenti 4.1 Trasformazione pag. 48 4.2 Strumenti di valorizzazione pag. 49 4.3 Percorso amministrativo pag. 50 4.4 Cooperazione e partenariato a supporto del progetto pag. 51 5. Appendice 5.1 Accordi, provvedimenti e pareri pag. 52 5.2 Focus indicazioni progettuali pag. 54 5.3 Forme di supporto economico e finanziario pag. 56 5.4 Partner pag. 67 3 FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI INFORMATION MEMORANDUM – Ex Polveriera – Loc. Miseno – Bacoli (NA) CAMPANIA Premessa Il progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI è una delle iniziative avviate dall’Agenzia del Demanio nell’ambito di un nuovo filone di attività, definito PROGETTI A RETE per il recupero e riuso del patrimonio pubblico, di proprietà dello Stato e di altri Enti, secondo tematismi che caratterizzano fortemente il network. -

Createspace Word Templates
REVIEWS OF OTHER BOOKS BY SEAN GABB “Fascinating to read, very well written, an intriguing plot and I enjoyed it very much.” (Derek Jacobi, star of I Claudius and Gladiator) “Vivid characters, devious plotting and buckets of gore are enhanced by his unfamiliar choice of period. Nasty, fun and educational.” (The Daily Telegraph) “He knows how to deliver a fast-paced story and his grasp of the period is impressively detailed.” (The Mail on Sunday) “A rollicking and raunchy read . Anyone who enjoys their history with large dollops of action, sex, intrigue and, above all, fun will absolutely love this novel.” (Historical Novels) “As always, [his] plotting is as brilliantly devious as the mind of his sardonic and very earthy hero. This is a story of villainy that reels you in from its prosaic opening through a series of death-defying thrills and spills.” (The Lancashire Evening Post) “It would be hard to over-praise this extraordinary series, a near-perfect blend of historical detail and atmosphere with the plot of a conspiracy thriller, vivid characters, high philosophy and vulgar comedy.” (The Morning Star) OTHER BOOKS BY SEAN GABB Acts of the Apostles: A Parallel Text Ars Grammatica The Churchill Memorandum The Column of Phocas Cultural Revolution, Culture War Dispatches from a Dying Country Freedom of Speech in England Literary Essays Radical Coup Return of the Skolli Smoking, Class and the Legitimation of Power Stories from Paul the Deacon Stories from the Life of Christ War and the National Interest The York Deviation WRITING AS RICHARD BLAKE Conspiracies of Rome Terror of Constantinople Blood of Alexandria Sword of Damascus Ghosts of Athens Curse of Babylon Game of Empires Death in Ravenna Crown of Empire Death of Rome I Death of Rome II The Devil’s Treasure The Boy from Aquileia The Tyburn Guinea The Break How I Write Historical Fiction Sean Gabb is a writer and teacher whose books have been translated into German, Italian, Spanish, Greek, Hungarian, Slovak and Chinese. -

Il Bimillenario Dell'acquedotto Augusteo Di Serino
Il bimillenario dell’acquedotto augusteo di Serino GRAZIANO FERRARI1, RAFFAELLA LAMAGNA2 1 Via Vignati 18, 20161, Milano, e-mail: [email protected] 2 C.so Vittorio Emanuele 377/A, 80135, Napoli, e-mail: [email protected] Abstract Riassunto A little known roman tunnel is placed in the municipality Una galleria romana poco nota, posta in località Scalan- of Bacoli (Naples, Italy), in an area historically called Sca- drone (comune di Bacoli – NA), contiene un’iscrizione landrone. Bacoli is part of the renowned Phlegraean Field, parietale che celebra l’apertura di un cunicolo di collega- visited by thousands of foreigners as part of a Grand Tour mento fra la galleria stessa ed un ramo dell’antico acque- in the XVI-XIX centuries. However, the Scalandrone tun- dotto augusteo di Serino. L’iscrizione riporta una data cor- nel was not mentioned in local guides and foreign reports. rispondente al 30 dicembre 10 d.C. Si tratta del più antico The tunnel contains an inscription which celebrates the riferimento ante quem relativo all’acquedotto augusteo. opening of an Haustus (passage intended as a water ca- Grazie ad una collaborazione fra A.R.I.N. S.p.A (Azienda tchment) connected to the Augustean aqueduct. The date Risorse Idriche Napoli) e la Soprintendenza Speciale ai of the event is reported as December 30th 10 A.D. So, on Beni Archeologici di Napoli e Pompei, è stato ideato e last December we celebrated the bimillennial birthday of realizzato un progetto comprendente l’esecuzione di un the Haustus. Thanks to the cooperation between A.R.I.N. -

A. Ufficio Del Direttore B. Cura E Gestione Delle Collezioni, Studio, Didattica E Ricerca
A. UFFICIO DEL DIRETTORE A.1 - SEGRETERIA DEL DIRETTORE Personale assegnato: Silvana Carannante, Assistente alla Fruizione e Vigilanza [email protected] A.2 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI COLLEGIALI Personale assegnato: Marzia del Villano, Assistente tecnico [email protected] A.3 – UFFICIO PROGETTI SPECIALI/UNESCO segreteria del direttore: Silvana Carannante [email protected] A.5 – RELAZIONI SINDACALI Personale assegnato: Maria Salemme, Funzionario amministrativo [email protected] A.6. – TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE Personale assegnato: Filippo Russo, Funzionario per la Promozione e Comunicazione [email protected] B. CURA E GESTIONE DELLE COLLEZIONI, STUDIO, DIDATTICA E RICERCA UFFICIO TUTELA E GESTIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE, DEI MONUMENTI E DELLE COLLEZIONI B.1 – Pozzuoli (Anfiteatro Flavio, Macellum, Necropoli di Via Celle, Necropoli di San Vito, Ipogei del Fondo Caiazzo, Stadio di Antonino Pio, Tempio di Apollo sul Lago d’Averno) Responsabili: La responsabilità dell’Ufficio è temporaneamente avocata dal Direttore, dott. Fabio Pagano Annalisa Manna, Funzionario architetto (responsabile ufficio tecnico) [email protected] B.2 – Terme di Baia (Area archeologica delle Terme, Parco Monumentale, Tempio di Diana, Tempio di Venere) Responsabili: Enrico Gallocchio, Funzionario archeologo (responsabile di ufficio) [email protected] Angela Klein, Funzionario architetto (responsabile ufficio tecnico) [email protected] B.3 – Parco -

Aqua Augusta Della Campania
UNIOR UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” PUTEOLI Studi di storia ed archeologia dei Campi Flegrei a cura di Giuseppe Camodeca - Marco Giglio PUTEOLI. STUDI DI STORIA ED ARCHEOLOGIA DEI CAMPI FLEGREI PUTEOLI. STUDI DI STORIA ED NAPOLI NAPOLI ISBN 978-88-6719-136-9 2016 2016 2 Indice Lo stadio di Cuma 3 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” DIPARTIMENTO ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO PUTEOLI. STUDI DI STORIA ED ARCHEOLOGIA DEI CAMPI FLEGREI a cura di GIUSEPPE CAMODECA - MARCO GIGLIO NAPOLI 2016 4 Indice L’immagine di copertina è tratta da A. M. Bejarano Osorio, Una Ampulla de vidrio decorada con la planta de la ciudad Puteoli, in Memoria, Mérida Excavaciones Arqueológicas, 8, 2002 (2005), 513-532 Volume pubblicato con i fondi del progetto PRIN 2010-2011, Unità B, Colonie e Municipi della Campania romana, diretta dal prof. G. Camodeca, Università degli studi di Napoli “L’Orientale” ISBN 978-88-6719-136-9 Prodotto da IL TORCOLIERE • Officine Grafico-Editoriali d’Ateneo UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’Orientale” finito di stampare nel mese di Dicembre 2016 Lo stadio di Cuma 5 INDICE G. CAMODECA Presentazione ........................................................................................................ 7 Puteoli G. CAMODECA Nuove dediche puteolane di età augusteo-tiberiana poste da un gruppo di liberti ............................................................................................................... 11 Puteoli - Cumae G. CAMODECA Unguentarii e turarii in Campania: nuovi dati da Puteoli e Cumae .............. 23 Cumae S. IAVARONE Tra pubblico e privato: funzione ed evoluzione dei marciapiedi alla luce di un nuovo contesto dall’abitato di Cuma ......................................................... 43 G. SORICELLI Terra sigillata "puteolana" al Museo Civico "Giuseppe Barone" di Baranello (Cb) ................................................................................................. 67 Baiae e Bauli S. -
Campi Flegrei 2008. Civiltà Del Futuro
Quarto centri storici laghi e lagune salmastre area parco oasi naturalistiche parchi archeologici, altri monumenti riserve marine del parco C. F. parchi sommersi grotte e crypte Campi percorsi naturalistici flegrei 2008. percorsi paesaggistici itinerario urbano Cuma Gli Astroni Civiltà ferrovia circumflegrea del futuro. ferrovia cumana metropolitana regionale metrò del mare La solfatara AZIONI · AIUTI ALLE IMPRESE IMMATERIALI · INFORMAZIONE · FORMAZIONE Baia Rione Terra · EVENTI PROGETTI PIT COMUNE DI BACOLI RESTAURI E · Villa Cerillo e Parco botanico / Biblioteca - Centro studi sul paesaggio VALORIZZAZIONE · Castelletto via castello / Centro servizi per il turista · Villa Comunale / Recupero · Passeggiata circumlacuale del lago Miseno / Pista ciclabile · Via Torre di Cappella / Ampliamento · Mobilità pedonale Baia Fusaro / Riqualificazione COMUNE DI MONTE DI PROCIDA · Nuova Piazza di Cappella e resti archeologici · Percorsi sul paesaggio a Torre Fumo - Montegrillo - Cappella COMUNE DI QUARTO · Arredo urbano - centro storico · Parco archeologico di Quarto COMUNE DI POZZUOLI Nisida · Restauro palazzo e torre Don Pedro de Toledo / Biblioteca multimediale Bacoli · Restauro palazzo Don Pedro de Toledo - centro culturale per il teatro REGIONE CAMPANIA Monte di · Indagini preliminari e restauro del Tempio di Augusto / Duomo · Restauro e valorizzazione del Rione Terra / Attività culturali e ricettive Procida SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI NAPOLI · Parco archeologico delle Terme di Baia · Anfiteatro Flavio - strutture archeologiche e di servizio -
108 I Campi Flegrei, Paradigma Di Campania Napoli – Pozzuoli
I vulcani flegrei sono tutti contenuti tra il mare ed il profilo dell'Archiflegreo, celebre per l'effusione dell'ignimbrite campana, la nube ardente esplosiva che circa 40000 anni fa sconvolse la regione fino alla penisola sorrentina, formando i depositi profondi di tufo grigio o piperno. 108 La seconda effusione, detta anche del tufo giallo, rimodulò l'intera piana intorno a 15000 anni fa. Si attribuisce ad un gigantesco vulcano sottomarino centrato in Pozzuoli, del diametro di circa 15 km. Residui periferici di questo cratere sono la Napoli collinare, l'Eremo di Camaldoli, la massima altezza dei Flegrei (458 mt), la piana di Quarto, ed ancora i dicchi di Cuma, la parte alta di Monte di I CAMPI FLEGREI, PARADIGMA DI Procida ed il capo Miseno. All'interno di questo arco si formarono notevoli crateri secondari, come il Gauro (o Campiglione) e l'isoletta di Nisida. FRAMMENTAZIONE Infine una terza fase, iniziata circa 8000 anni fa e proseguita fino a 3800 anni fa, di attività minore, vide il formarsi dei vulcani del bosco degli Astroni, del lago d'Averno, della Solfatara e dell'ex lago di Agnano. Sono questi i siti cui si deve storicamente l'attributo "flegrei", per la residua attività vulcanica ancora riscontrabile. Un ultimo episodio, breve ed isolato in epoca storica, è stata la formazione del Monte Nuovo nel 1538, "una nocte congestus", la cui eruzione chiuse un periodo ascendente di almeno 400 anni del bradisismo flegreo ed alterò profondamente la linea di costa di Lucrino, formando la laguna di sbarramento e seppellendo il villaggio termale medievale di Tripergolae.