Zukunft Elbinsel Wilhelmsburg E.V
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
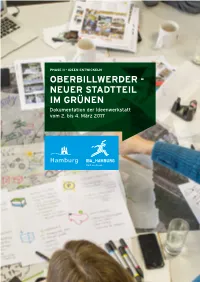
Dokumentation Ideenwerkstatt Oberbillwerder 2017
PHASE II - IDEEN ENTWICKELN OBERBILLWERDER - NEUER STADTTEIL IM GRÜNEN Dokumentation der Ideenwerkstatt vom 2. bis 4. März 2017 www.oberbillwerder-hamburg.de Inhalt 04 OBERBILLWERDER – NEUER STADTTEIL IM GRÜNEN 04 Einleitung 06 Oberbillwerder 08 WAS BISHER GESCHAH 08 Beteiligung Phase I „Sammeln und informieren“ 10 DIE IDEENWERKSTATT 10 Beteiligung Phase II „Ideen entwickeln“ 11 Die Ideenwerkstatt auf einen Blick 12 Zusammenfassung und Ausblick - Erkenntnisse aus der Ideenwerkstatt 14 DOKUMENTATION DER ERGEBNISSE DER EXPERTENGRUPPEN 16 Städtebauliche Qualität 26 Wohnen und Nachbarschaft 30 Lebendige Vielfalt 38 Nachhaltigkeit 46 Mobilität 54 Kulturlandschaft 66 DOKUMENTATION BÜRGERWORKSHOP 100 VERZEICHNIS MATERIALBIBLIOTHEK 102 IMPRESSUM Oberbillwerder - neuer Stadtteil im Grünen it Oberbillwerder wird im Bezirk Berge- Hansestadt auch etwas ganz Besonderes werden: dorf ein neuer Stadtteil für Hamburg lebenswert und attraktiv, inklusiv und integrativ, Mgeplant, denn die Stadt wächst. Jährlich umweltfreundlich und zukunftsbeständig. Die sollen deshalb 10.000 neue Wohnungen gebaut Entwicklung eines neuen Stadtteils von dieser werden. Bei der Frage wo diese geschaffen wer- Größenordnung ist von herausragender Be- den können, verfolgt der Senat der Freien und deutung für den Bezirk Bergdorf und die ganze Hansestadt Hamburg eine doppelte Strategie. Mit Stadt. Deshalb hat die Senatskommission für „Mehr Stadt in der Stadt“ wurde die verstärkte Stadtentwicklung und Wohnen am 28. Septem- Nutzung der inneren Stadtbereiche überschrie- ber 2016 ausdrücklich darauf hingewiesen, für ben. Aufgrund der hohen Wohnungsnachfrage ist die Erarbeitung des Masterplans bis Ende 2018 2016 zusätzlich das Programm „Mehr Stadt an einen sehr offenen und transparenten Prozess neuen Orten“ aufgelegt worden, verbunden mit mit vielen Mitwirkungsmöglichkeiten für die der Herausforderung, äußere Bereiche städte- Öffentlichkeit, Fachexpertinnen und -experten, baulich zu erschließen, ohne Hamburgs grünen Wirtschaft, Politik und Verwaltung zu wählen und Charakter zu beeinträchtigen. -

Staffeleinteilung Herren Spieljahr 2021 / 2022
Staffeleinteilung Herren Spieljahr 2021 / 2022 Oberliga Hamburg 01 Oberliga Hamburg 02 Bramfeld 1. Buchholz 1. BU 1. HEBC 1. Concordia 1. HSV III Curslack-Neuengamme 1. Niendorf 1. Dassendorf 1. Rugenbergen 1. Hamm United 1. Süderelbe 1. Lohbrügge 1. TuS Osdorf 1. Meiendorf 1. Union Tornesch 1. Paloma 1. Victoria 1. Sasel 1. Hier könnt ihr die regionale Einteilung der Oberligen in einer Grafik anschauen. Landesliga 01 Landesliga 02 Landesliga 03 Altenwerder 1. Altengamme 1. Ahrensburg 1. Halstenbek-Rellingen 1. ASV Hamburg 1. Bergstedt 1. Harburger TB 1. Dersimspor 1. BU 2. Harksheide 1. Düneberg 1. Condor 1. Inter Eidelstedt 1. FC Bingöl 12 1. Eimsbüttel 1. Niendorf 2. FC Türkiye 1. Eintracht Lokstedt 1. Nienstedten 1. Kosova 1. Hansa 11 1. Nikola Tesla 1. Oststeinbek 1. Rahlstedt 1. Rantzau 1. SVNA 1. Sternschanze 1. Rasensport Uetersen 1. Voran Ohe 1. TuS Berne 1. VfL Pinneberg 1. Vorw. Wacker 1. Victoria 2. Hier könnt ihr die regionale Einteilung der Landesligen in einer Grafik anschauen. Staffeleinteilung Herren Spieljahr 2021 / 2022 Bezirksliga 01 Bezirksliga 02 Bezirksliga 03 Blau-Weiß 96 1. ASV Bergedorf 85 1. BU 3. Egenbüttel 1. Barsbüttel 1. Eilbek 1. FC Elmshorn 1. Börnsen 1. Farmsen 1. Heidgraben 1. ETSV Hamburg 1. Fatihspor 1. Hetlingen 1. FSV Geesthacht 1. HT 16 1. Hörnerkirchen 1. Glinde 1. Inter 2000 1. Kummerfeld 1. Hamwarde 1. Paloma 2. Lieth 1. MSV Hamburg 1. Sperber 1. Roland Wedel 1. SC V. M. 2. UH-Adler 1. SC Pinneberg 1. SC Wentorf 1. VfL 93 1. TBS-Pinneberg 1. Schwarzenbek 1. Wandsetal 1. Bezirksliga 04 Bezirksliga 05 Bezirksliga 06 1. -

Gewerbeflächenkonzept Bezirk Altona 2018
GEWERBEFLÄCHENKONZEPT BEZIRK ALTONA 2018 | Bezirksamt Altona Bezirksamt Altona I Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 2 Gewerbeflächenkonzept Altona Impressum Herausgeber Freie und Hansestadt Hamburg Bezirksamt Altona Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung Jessenstraße 1–3 22767 Hamburg Verfasser BPW baumgart+partner Ostertorsteinweg 70–71 28203 Bremen [email protected] Text, Redaktion, Grafik: Frank Schlegelmilch Ida Frenz Stand: Dezember 2018 Bezirksamt Altona I Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt Gewerbeflächenkonzept Altona 3 Inhalt Vorwort 1 Gewerbeflächenkonzept Altona 7 1.1 Anlass 7 1.2 Methodik 8 2 Gewerbeflächenentwicklung in Hamburg 11 2.1 Rahmenbedingungen 11 2.2 Zielsetzung 14 3 Der Wirtschaftsstandort Altona 21 3.1 Besonderheiten des Wirtschaftsstandortes Altona 21 3.2 Gewerbeflächen in Altona 24 3.3 Struktur der Branchen 34 3.4 Nachfrage-Tendenzen in Altona 38 3.5 Differenzierung der Standorte nach Nachfrage-Typen 39 4 Ziele der Gewerbeflächenentwicklung in Altona 41 4.1 Sicherung der bestehenden Gewerbe- und Industriegebiete 42 4.2 Optimierung der Flächennutzung innerhalb der Gewerbegebiete 43 4.3 Funktionale und gestalterische Qualifizierung 44 4.4 Klimagerechte Weiterentwicklung der Bestandsgebiete 46 4.5 Etablierung eines aktiven Gebietsmanagements 47 5 Handlungskonzept für die Gewerbestandorte 49 Steckbriefe mit Bewertung und Entwicklungsstrategie 6 Ausblick 115 7 Quellenverzeichnis 116 Bezirksamt Altona I Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt Gewerbeflächenkonzept Altona 5 Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Altonaerinnen und Altonaer, der Wirtschaftsstandort Altona zeichnet sich durch Die große Beliebtheit Altonas als Wohnstandort führt eine ausgesprochene Vielfältigkeit und Kreativität aus. dazu, dass der Umwandlungsdruck auf bestehende So sind in den Stadtteilen Bahrenfeld und Lurup regi- Gewerbestandorte steigt. -

Arme Kinder, Arme Alte, Arme Alle
gesamt 0-7 jahre ab 65 Jahre bis 5 Prozent 5–10 Prozent Arme Kinder, arme Alte, arme alle 10–15 Prozent 15–20 Prozent Wohldorf- Ohlstedt Anteil der Bezieher von Sozialleistungen 20–25 Prozent Duvenstedt Quelle: Statistikamt Nord in den Hamburger Stadtteilen Stichtag: 31.12.2012 mehr als 25 Prozent Steilshoop Lemsahl- Mellingstedt Jenfeld Hohenfelde 9,6 15,5 6,3 Barmbek-Süd 9,4 14,4 7,6 Bergstedt Eilbek Dulsberg 22,6 46,9 14,3 Poppen- Stadtteil gesamt Jahre0-7 ab Jahre 65 Barmbek-Nord 11 19,7 7,3 Iserbrook Langenhorn büttel Ohlsdorf 8,8 11,5 3,3 Altona Nord Bezirk Mitte Fuhlsbüttel 8,8 14,2 5,9 Hummels- Sasel Volksdorf büttel Altstadt, Hafencity 8,8 8,1 11 Langenhorn 12 23,7 5 Ottensen Neustadt 13,6 14,6 15,1 Wellingsbüttel Hoheluft Ost Altona Altstadt Schnelsen St. Pauli 18,4 23,8 22,4 Bezirk Wandsbek Niendorf Hoheluft West St. Georg 9,7 12,9 10,5 Eilbek 9,4 17,9 5,3 Ohlsdorf Fuhlsbüttel Uhlenhorst Hammerbrook 21,8 51,6 17,1 Wandsbek 10,9 20,9 5,8 Borgfelde 12,2 25,2 10,2 Marienthal 6,3 8,1 4,3 Hohenfelde Groß Rahlstedt Hamm 12,3 25,9 8,2 Jenfeld 26 46,1 15,6 Eidelstedt Borstel Alsterdorf Steils- Farmsen- Harvestehude Horn 20,4 40,2 10,6 Tonndorf 12,3 23,9 5 hoop Berne Bramfeld Billstedt 26,4 48,4 11 Farmsen-Berne 12,6 22,2 5,1 Lurup Dulsberg Lokstedt Eppen- Rothenburgsort, Billbrook 29,1 53,4 11,7 Bramfeld 12,5 23,4 5,8 Winterhude Stellingen dorf Veddel 28 45,2 15,8 Steilshoop 26,1 48,9 9,9 Barmbek- Tonndorf Wilhelmsburg 26,6 45,9 9,4 Wellingsbüttel 2,4 2,5 0,9 Rissen Nord Duls- Hoheluft berg Sülldorf Osdorf Ost H o h e l u f t Barmbek- Finkenwerder, Kl. -

Begründung Zum Bebauungsplan Bergedorf 104 / Curslack 19
Begründung zum Bebauungsplan Bergedorf 104 / Curslack 19 Juni 2014 1 2 INHALTSVERZEICHNIS 1 Grundlagen und Verfahrensablauf ............................................................................. 6 2 Anlass und Ziel der Planung ....................................................................................... 6 3 Planerische Rahmenbedingungen ............................................................................. 8 3.1 Raumordnung- und Landesplanung ................................................................... 8 3.1.1 Flächennutzungsplan ................................................................................................ 8 3.1.2 Landschaftsprogramm .............................................................................................. 8 3.2 Andere rechtlich beachtliche Tatbestände......................................................... 9 3.2.1 Bestehende Bebauungspläne .................................................................................. 9 3.2.2 Baumschutz .............................................................................................................. 9 3.2.3 Denkmalschutz ......................................................................................................... 9 3.2.4 Hinweise aus dem Fachinformationssystem Boden ................................................. 9 3.2.5 Kampfmittelverdachtsflächen.................................................................................. 10 3.2.6 Wasserschutzgebiet .............................................................................................. -

Bus Linie 150 Fahrpläne & Karten
Bus Linie 150 Fahrpläne & Netzkarten 150 Cranz > Finkenwerder > Waltershof > Im Website-Modus Anzeigen Othmarschen > Bf. Altona Die Bus Linie 150 (Cranz > Finkenwerder > Waltershof > Othmarschen > Bf. Altona) hat 3 Routen (1) Airbus (kehre): 00:41 - 22:27 (2) Bf. altona: 00:38 - 23:58 (3) Estebogen: 04:26 - 23:55 Verwende Moovit, um die nächste Station der Bus Linie 150 zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste Bus Linie 150 kommt. Richtung: Airbus (Kehre) Bus Linie 150 Fahrpläne 23 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Airbus (kehre) LINIENPLAN ANZEIGEN Montag 00:41 - 22:27 Dienstag 00:41 - 22:27 Bf. Altona Paul-Nevermann-Platz 5, Hamburg Mittwoch 00:41 - 22:27 Große Rainstraße Donnerstag 00:21 - 23:15 Hohenesch 85, Hamburg Freitag 00:41 - 22:27 Friedensallee Samstag 00:41 - 22:53 Bahrenfelder Straße 182, Hamburg Sonntag 00:21 - 23:15 Am Born Behringstraße 11, Hamburg Kreuzkirche Ottensen Behringstraße 55, Hamburg Bus Linie 150 Info Richtung: Airbus (Kehre) Griegstraße Stationen: 23 Griegstraße 52, Hamburg Fahrtdauer: 35 Min Linien Informationen: Bf. Altona, Große Rainstraße, Behringstraße (Ak Altona) Friedensallee, Am Born, Kreuzkirche Ottensen, Jürgen-Töpfer-Straße 18 f, Hamburg Griegstraße, Behringstraße (Ak Altona), Bab- Auffahrt Waltershof, Am Genter Ufer, Bab-Auffahrt Waltershof Aluminiumwerk, Osterfelddeich, Auedeich, Dradenaustraße, Hamburg Jeverländer Weg, Emder Straße, Steendiek, Finkenwerder (Fähre), Norderschulweg, Am Genter Ufer Brunnenstieg, Kneienblick, Nordmeerstraße, Rudolf- Dradenauer Deichweg, Hamburg Kinau-Allee, -

Elbe Estuary Publishing Authorities
I Integrated M management plan P Elbe estuary Publishing authorities Free and Hanseatic City of Hamburg Ministry of Urban Development and Environment http://www.hamburg.de/bsu The Federal State of Lower Saxony Lower Saxony Federal Institution for Water Management, Coasts and Conservation www.nlwkn.Niedersachsen.de The Federal State of Schleswig-Holstein Ministry of Agriculture, the Environment and Rural Areas http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ UmweltLandwirtschaft_node.html Northern Directorate for Waterways and Shipping http://www.wsd-nord.wsv.de/ http://www.portal-tideelbe.de Hamburg Port Authority http://www.hamburg-port-authority.de/ http://www.tideelbe.de February 2012 Proposed quote Elbe estuary working group (2012): integrated management plan for the Elbe estuary http://www.natura2000-unterelbe.de/links-Gesamtplan.php Reference http://www.natura2000-unterelbe.de/links-Gesamtplan.php Reproduction is permitted provided the source is cited. Layout and graphics Kiel Institute for Landscape Ecology www.kifl.de Elbe water dropwort, Oenanthe conioides Integrated management plan Elbe estuary I M Elbe estuary P Brunsbüttel Glückstadt Cuxhaven Freiburg Introduction As a result of this international responsibility, the federal states worked together with the Federal Ad- The Elbe estuary – from Geeshacht, via Hamburg ministration for Waterways and Navigation and the to the mouth at the North Sea – is a lifeline for the Hamburg Port Authority to create a trans-state in- Hamburg metropolitan region, a flourishing cultural -

Fata Morgana Über Der Elbe
Deutschland REUTERS A380-Modell bei Airbus in Toulouse C. KAISER / PLUS 49 / VISUM C. KAISER / PLUS Hamburger Airbus-Werftgelände (mit Mühlenberger Loch): Millionen Tonnen Sand für das Kreuzfahrtschiff der Lüfte STADTPLANUNG Fata Morgana über der Elbe Entschwebt Hamburgs umstrittener Prestigeflieger, der Riesen-Airbus A380, nach Toulouse? Mit schlampigen Gutachten und geschönten Arbeitsplatzprognosen versuchte der Senat, das Luftfahrtprojekt für die Stadt zu gewinnen. Nun suchen die Gegner eine Entscheidung vor Gericht. llerlei Häme muss Thomas Mirow, weil die Sache überdurchschnittlich 48, in diesen Tagen über sich er- kompliziert sei. Rechtsexperten der Agehen lassen. Hamburgs Wirt- Stadt schätzen den Erfolg Ham- schaftssenator, bislang Hätschelkind der burgs als schwierig ein. hanseatischen Lokalpresse, wird für einen In ihrer „sehr gründlichen Ent- peinlichen Baustopp an der Elbe verant- scheidung“, urteilt Ingo von Münch wortlich gemacht. (FDP), Staatsrechtler und ehemals Ursprünglich noch im alten Jahr wollte Hamburgs Zweiter Bürgermeister, Mirow das Elbebiotop „Mühlenberger habe die erste Instanz den Planfest- Loch“ zuschütten lassen, um im Stadtteil stellungsbeschluss der Behörde aus- Finkenwerder die Produktion des neuen einander genommen, der schon den Super-Airbus A380 (vormals A3XX) zu er- „Sofortvollzug“ der Aufschüttung möglichen. Unter Verwendung von Millio- vorsah: Die drei Verwaltungsrichte- nen Tonnen Sand, auf den schlammigen rinnen spießten in ihrem Urteil zahl- Grund des Süßwasserwatts gekippt und Elbe bei Blankenese: Protest von hüben und drüben reiche Ungereimtheiten auf und ta- von stählernen Spundwänden zusammen- delten dubiose Gutachten, die den gehalten, sollte das dort bereits bestehen- Toulouse“: Dort nämlich, so die Drohung „bösen Schein“ filzigen Taktierens hinter- de Gelände des Airbus-Konzerns EADS der EADS, werde das Kreuzfahrtschiff der ließen. -

Raderlebnis Bergedorf Vier- Und Marschlande
3. Auflage Herzlich willkommen! R1 Vierländer Rosentour R2 Tour Hinter den Deichen R3 Elbkieker-Tour Erleben Sie diese reizvolle Landschaft am besten im Die Tour startet am -Bahnhof Billwerder-Moorfleet Wer seinen Beinen zwischendurch eine kleine Pause Ein kleiner Rundkurs im Spadenland entlang der Dei- Eine Tour entlang der Elbe, zum größten Teil am Original vor Ort. Aufgrund der Größe eignen sich die und führt entlang der kurvigen Gose Elbe vorbei an gönnen möchte, kann bei der Bootsvermietung che. Im Spadenland mussten sich ehemals die Anwoh- Innen- und Außendeich befahrbar. Diese Tour Raderlebnis Bergedorf Vier- und Marschlande besonders für einen Fahrrad- Rosengärten, alten Fachwerk häusern zum Vierländer Paddel-Meier selbst auf ein Boot umsteigen und die Land- ner selbst um den Erhalt und die Pflege der Deiche zeigt vielfältige Attraktionen der Gewässerland- ausflug. Dieser Flyer zeigt Ihnen fünf schöne Touren Rosenhof. Neben historischen Rosen können hier Züch- schaft vom Wasser aus ent decken. In Hofläden, Cafés und kümmern, andernfalls wurde das Grundstück abge- schaft: den Hafen Oortkaten, Windsurfing auf Vier- und Marschlande zum Entdecken. Insbesondere Liebhaber von Natur tungsneuheiten im Rosengarten bewundert und erwor- Restaurants gibt es gesunde Lebens mittel zur Stärkung. sprochen. Als Symbol hierfür wurde ein Spaten in den dem Hohendeicher See, Schiffsverkehr auf der und Kulturhistorie, von landwirtschaftlich gepräg- ben werden. Deich gesteckt. Die Spadenländer Spitze wurde durch Elbe, Fähre am Zollenspieker. Es befinden sich auch verschiedene Einkehrmöglichkei- ter und naturnaher Landschaft, von sportlicher Betä- die Rückverlegung der Deichlinie wieder zu einer typi- Fünf schöne Touren zum Entdecken Weiter geht die Radtour auf dem bei Fahrradfahrern ten auf der Strecke oder in der Nähe. -

In Hamburg the Group Energy System Integration of the DLR-Institute Of
In Hamburg the group Energy System Integration of the DLR-Institute of Engineering Thermodynamics is located in the ZAL TechCenter on the “Rüsch”-peninsula of the township Hamburg-Finkenwerder. Our facilities can be compassed as follows: Address: German Aerospace Centre Institute of Engineering Thermodynamics Energy System Integration at the ZAL TechCenter Hein-Saß-Weg 22 21129 Hamburg Germany Mr Christoph Gentner +49 (0)711 6862 374 By train With Deutsche Bahn (www.bahn.de), Metronom (www.der-metronom.de) or Nord-Ostsee-Bahn (www.nob.de) till Ham- burg Central Station or one of the train stations “Hamburg-Harburg” and “Altona”, respectively. Thence, further by car, taxi or public transport (see below). By plain After arrival at Hamburg airport (www.airport.de) please continue either by car, taxi or public transport (see below). By car Coming both from the north or the south take the motorway A7 (cf. maps); slip the motorway at exit “30-HH-Waltershof“ in direction of “HH-Finkenwerder/Hafen“; keep to the right at the forking and follow the signposting “Finkenwerder/ Altenwerder/Dradenau“ on the road “Finkenwerder Straße“; keep the road as “Aue-Hauptdeich“ as well as “Ostfrieslandstraße“; turn to the left on the road “Steendiek“; after 87m turn right on “Schloostraße”; after 19m turn left on “Finksweg”; after 160m turn left on “Hein-Saß-Weg” and follow this street for 800m; the ZAL TechCenter is located on the right hand side. journey time approx. 15 minutes (from exit “Waltershof“). By taxi All train stations and nearly all urban railway stations allocate taxis; otherwise a taxi may be arranged for calling +49 (0) 40 – 66 66 66; ask the driver to take you to “Hamburg-Finkenwerder“ on the “Rüsch”-peninsula to the ZAL TechCenter located at Hein-Saß-Weg 22; journey time approx. -

Dorfgemeinschaft Billwärder an Der Bille Ev
Billwerder Dorfidyll Dorfgemeinschaft Billwärder an der Bille e.V. Früjahr/Sommer 2015 Nr. 82 / 24. Jahrgang In diesem Sommer 2015, liebe Billwerder, wird der untere Bereich des Billwerder Billdeiches, d.h. vom Kreisel am Mittleren Landweg in Richtung Westen bis zum östlichen Fuß der Brücke über die A 1, bearbeitet und repariert. Die Sanierungsarbeiten werden am 1. Juni d.J. beginnen und Ende September 2015 abgeschlossen sein, wenn alles wie geplant verläuft. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung unserer Deichstrasse, nur Anliegerverkehr ist möglich. Unser Billwerder Billdeich ist aus dem Netz der Hauptverkehrsstrassen herausgenommen und wird jetzt als normale Bezirksstrasse geführt. Die von den Sanierungsarbeiten betroffenen Billwerder Anwohner konnten am Sonnabend, 9. Mai 2015, von 13 bis 15 Uhr in unserem Alten Spritzenhaus die Pläne einsehen und kommentieren. - Wir müssen uns auf Beschränkungen am Billdeich einstellen, sind jedoch auch froh, dass keinerlei Verbreiterung vorgesehen ist; die diesbezügliche Durchgangsbreitenbegrenzungsbeschilderung bleibt erhalten. Damit bleibt unser Billdeich wesentlich im Bereich des Unattraktiven für Raser unter den Autofahrern – dieses ist uns sehr wichtig Im 70. Jahr nach der Befreiung unseres Landes von der entsetzlich kriegerischen, katastrophalen und verbrecherischen braunen Naziherrschaft erleben wir nun erneut Flüchtlingsströme. Wir erinnern uns an die damalige Not nach 1945 in 2 unserem Lande, können nachempfinden, was jetzige Schutz- und Obdachsuchende leiden. Es entstehen jetzt Containersiedlungen und Bürgergruppen, die sich helfend – oft in Erinnerung der eigenen Flucht und Notlage nach 1945 – um die heutigen Flüchtlinge kümmern. - In diesem Zusammenhang denken wir auch an die vielen Nissenhütten, die vielerorts entstanden, um nach dem Kriege notdürftig Obdach zu bieten. Zu diesem Thema lesen Sie in diesem Blatt einiges. -

Assignment of Positionally Uncertain Point Events to Regions
Assignment of positionally uncertain point events to regions Tonio Fincke, Jochen Schiewe, and Karl-Peter Traub Lab for Geoinformatics and Geovisualization (g²lab) HafenCity University Hamburg Hebebrandstraße 1, 22297 Hamburg, Germany {tonio.fincke | jochen.schiewe | karl-peter.traub} @hcu-hamburg.de http://www.hcu-hamburg.de/geomatik/g2lab 1. INTRODUCTION Although it is often not considered explicitly, positional uncertainty is a frequent issue in spatial analysis. It denotes the phenomenon that the spatial coordinates of an object do not indicate, but only approximate the actual position. As with other kinds of uncertainties, positional uncertainty can be introduced through every step of working with data. Uncertainty can be described or modeled with confidence intervals or probability density functions (Morgan, 1990; MacEachren, 2005). For modeling spatial uncertainty, buffered regions or fuzzy borders can be draped around the spatial feature. An example is the ‘Egg-Yolk’ model, where regions with indeterminate boundaries are represented by concentric regions (Cohn, 1996). Due to their special characteristics, spatial uncertainties and methods for their consideration continue to receive specific attention (Zhao, 2009; Navratil, 2008; Fisher, 2000; Shokri, 2006; Hession, 2006). For example, the 9-intersection model (Egenhofer, 1991) has been extended to uncertain geographic objects (Clementini, 1996). Locational or positional uncertainties pose special challenges (Murray, 2003; Grubesic, 2004). In a specific case, we want to count the number of emergency rescues which have occurred in several distinct city districts. The fire department of Hamburg provided data about emergencies that happened between 2005 and 2008 around a rescue service station (for former investigations of emergency rescues in Hamburg see Traub, 2003).