Bernd Rill (Hrsg.): Italien Im Aufbruch – Eine Zwischenbilanz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Politica Estera Dell'italia. Testi E Documenti
AVVERTENZA La dottoressa Giorgetta Troiano, Capo della Sezione Biblioteca e Documentazione dell’Unità per la Documentazione Storico-Diplomatica e gli Archivi ha selezionato il materiale, redatto il testo e preparato gli indici del presente volume con la collaborazione della dott.ssa Manuela Taliento, del dott. Fabrizio Federici e del dott. Michele Abbate. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI UNITÀ PER LA DOCUMENTAZIONE STORICO-DIPLOMATICA E GLI ARCHIVI 2005 LA POLITICA ESTERA DELL’ITALIA TESTI E DOCUMENTI ROMA Roma, 2009 - Stilgrafica srl - Via Ignazio Pettinengo, 31/33 - 00159 Roma - Tel. 0643588200 INDICE - SOMMARIO III–COMPOSIZIONE DEI GOVERNI . Pag. 3 –AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI . »11 –CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI CONCERNENTI L’ITALIA . »13 III – DISCORSI DI POLITICA ESTERA . » 207 – Comunicazioni del Ministro degli Esteri on. Fini alla Com- missione Affari Esteri del Senato sulla riforma dell’ONU (26 gennaio) . » 209 – Intervento del Ministro degli Esteri Gianfranco Fini alla Ca- mera dei Deputati sulla liberazione della giornalista Giulia- na Sgrena (8 marzo) . » 223 – Intervento del Ministro degli Esteri on. Fini al Senato per l’approvazione definitiva del Trattato costituzionale euro- peo (6 aprile) . » 232 – Intervento del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusco- ni alla Camera dei Deputati (26 aprile) . » 235 – Intervento del Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusco- ni al Senato (5 maggio) . » 240 – Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi ai Paesi Fondatori dell’Unione Europea (Roma, 11 maggio) . » 245 – Dichiarazione del Ministro degli Esteri Fini sulla lettera del Presidente Ciampi ai Capi di Stato dei Paesi fondatori del- l’UE (Roma, 11 maggio) . » 247 – Discorso del Ministro degli Esteri Fini in occasione del Cin- quantesimo anniversario della Conferenza di Messina (Messina, 7 giugno) . -

SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Affari Costituzionali
SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione INDAGINE CONOSCITIVA SUI FATTI ACCADUTI IN OCCASIONE DEL VERTICE DEL G8 TENUTOSI A GENOVA DOCUMENTO CONCLUSIVO 20 settembre 2001 Introduzione Dopo i fatti accaduti in occasione del Vertice G8 di Genova (19-22 luglio 2001), giˆ il 23 luglio la Commissione affari costituzionali del Senato era riunita per ascoltare le comunicazioni del Ministro dell'interno Scajola a proposito di quei fatti. Il 24 luglio 2001, presso la Commissione affari costituzionali del Senato, la senatrice Dentamaro, insieme a 8 altri senatori dell'opposizione (dei gruppi Magherita, Democratici di sinistra, Verdi), richiedeva, ai sensi dell'art. 48-bis del Regolamento, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Successivamente, il 1¡ agosto, dagli stessi Gruppi di opposizione era presentata in Senato una proposta di inchiesta parlamentare sui fatti di Genova. Sia la proposta di indagine conoscitiva, sia la proposta di inchiesta erano tempestivamente iscritte all'ordine del giorno della Commissione affari costituzionali del Senato. Nella seduta antimeridiana del 1¡ agosto il Senato discuteva, respingendola, una mozione di sfiducia individuale, proposta dai Gruppi dell'opposizione nei confronti del Ministro dell'interno Scajola. Subito dopo la Commissione affari costituzionali del Senato conveniva all'unanimitˆ di procedere a una indagine conoscitiva sui fatti accaduti in occasione del Vertice G8 tenutosi a Genova. Contestualmente, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in sede di Ufficio di Presidenza, conveniva su analoga proposta. Conseguentemente, il 2 agosto i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati procedevano a un'intesa circa lo svolgimento congiunto dell'indagine conoscitiva da parte delle Commissioni affari costituzionali dei due rami del Parlamento. -
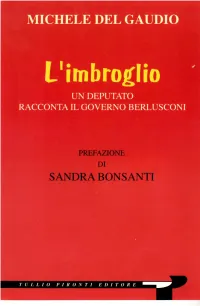
L'imbroglio I
MICHELE DEL GAUDIO I I I L'IMBROGLIO I Un deputato racconta il Governo Berlusconi I Prefazione di I SANDRA BONSANTI I I I I TULLIO PIRONTI EDITORE I I © 1995 Tullio Pironti Editore Via Port'Alba, 33 - Napoli Prima edizione: aprile 1995 Ad Anlonino Caponnetlo, ('he nli ha accolto nella sua vita come un figlio. Al suo esempio dovrebbe ispirarsi ogni politico, ogni giudice, ogni cittadino. Nota dell'autore Nella narrazione i laW sono esposti in ordine cronologico, rna non rnanca qualche anlicipazione per rendere cornprensi hili Ie diverse vicende. Vedi caro amico cosa si deve inventare per poter riderci sopra per continuare a sperare. Ese quest'anno poi passasse in un istante vedi amico mio come diventa importante che in quesl'istante ci sia anch'io. L 'anno che sta arrivando tra un an no passera io mi sto preparando e questa fa novita. LUCIO DALLA Non sa niente, e crede di saper tullo. Questa fa chiaramente prevedere una carriera politica. GEORGE BERNARD SHAW PREFAZIONE Michele Del Gaudio e seduto due banchi sotto if mio. Per molti mesi abbiamo condiviso una visione d'insieme delf'au la. Ifatti che accadono davanti ai nostri occhi, Ie parole che ascoltiamo sono assolutamente gli stessi: i deputati della nuova deslra assiepati dall'altra parte, quel centro che ondeg gia fra loro enol, e noi, pieni di contraddizioni, di buona volonta, di incertezze. Fra noi e loro c'e una terra di nessuno. C'e una cultura che ci divide, c'e un 'idea di Stato e di societa che ci separa. -

Proposta Alternativa Di Documento Conclusivo Dell'indagine Conoscitiva
PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI FATTI ACCADUTI IN OCCASIONE DEL VERTICE DEL G8 TENUTOSI A GENOVA (presentata dai senatori Bassanini, Dentamaro, Iovene, Marini, Petrini, Turroni, Villone) INDICE INTRODUZIONE Capitolo I I FATTI DI GENOVA Le Fonti 1. Le manifestazioni del 19 luglio: le donne iraniane e il corteo dei migrantes 2. Le manifestazioni del 20 luglio: le piazze tematiche; il corteo della CUB; il corteo delle Tute Bianche. 2.1 Il Blocco Nero Ð I Black Blockers 2.2. Le Piazze Tematiche e i cortei 2.3. Il corteo della CUB a Ponente 2.4. Il corteo delle "tute bianche" dallo stadio Carlini a via Tolemaide. 3. Gli scontri a piazza Alimonda e la morte di Carlo Giuliani. 4 . Il corteo internazionale di sabato 21 luglio. 5. La perquisizione alla scuola Pertini (ex Diaz). 6. La perquisizione al centro stampa Ð media center nella scuola Diaz-Pascoli. 7. L'uso legittimo della forza, i feriti e i manganelli "tonfa". 7.1. La relazione Cernetig 7.2. La distruzione di materiali video e fotografici. 7.3. L'uso del "tonfa" e dei manganelli 7.4. L'uso dei blindati 7.5. L'uso delle armi Capitolo II BOLZANETO: LA CASERMA NINO BIXIO 1. La caserma Nino Bixio di Genova Bolzaneto 2. CONSIDERAZIONI CRITICHE Capitolo III ORDINE PUBBLICO A GENOVA E PROPOSTE DI RIFORMA 1. La Pianificazione Operativa delle Attivitˆ di Pubblica Sicurezza 2. Le Proposte di Miglioramento delle Funzioni di Ordine e Sicurezza Pubblica in Occasione di Grandi Eventi e Manifestazioni di Piazza Capitolo IV INTERPRETAZIONE DELLA VICENDA 1. -

P 20200706 Lune Lune Naz 003
Il Sole 24 Ore Lunedì 6 Luglio 2020 3 Primo Piano Città capoluogo. Premiato chi L’indice di gradimento dei sindaci PERIFERIA E CENTRO ha gestito la crisi in prima linea Il Governance Poll sui sindaci delle città capoluogo di provincia: graduatoria in base al risultato 2020 (in %), voti ottenuti nel giorno dell’elezione (in %) e differenza CDX CENTRODESTRA CSX CENTROSINISTRA M5S M5S CIV LISTE CIVICHE LEGA LEGA IND INDIPENDENTE SARANNO POS. SINDACO COMUNE ANNO ELEZIONE GOVERNANCE POLL 2020 CONSENSO GIORNO ELEZIONE DIFF. % 35 50 65 80 I NUOVI LEADER? 1 CSX Antonio Decaro * Bari 2019 66,3 69,4 +3,1 IL SALTO NON È Sul podio 2 CIV Cateno De Luca Messina 2018 65,3 67,4 +2,1 3 CSX Giorgio Gori * Bergamo 2019 55,3 63,7 +8,4 I sindaci al vertice del Governance Poll 2020 SCONTATO CDX Marco Bucci Genova 2017 55,2 63,7 +8,5 1 2 3 4 5 CSX Luca Salvetti Livorno 2019 60,5 63,3 -2,8 CDX Luigi Brugnaro Venezia 2015 53,2 60,5 +7,3 di Antonio Noto 7 CDX Pierluigi Peracchini La Spezia 2017 60,0 60,4 +0,4 8 CDX Rodolfo Ziberna Gorizia 2017 59,8 60,2 +0,4 risultati del Governance Poll 9 CIV Damiano Coletta Latina 2016 60,0 75,1 -15,1 sembrerebbero aprire CDX Marco Fioravanti Ascoli Piceno 2019 59,3 60,0 +0,7 nuovi scenari di leadership na- Antonio Cateno Giorgio Marco CIV Andrea Soddu 7 Nuoro 2015 60,0 68,4 -8,4 zionale, ma bisogna sempre fare Decaro De Luca Gori Bucci Iconti con i profili percepiti dagli 12 CDX Alessandro Ciriani Pordenone 2016 58,8 59,9 + 1,1 elettori in relazione ai singoli ruoli 13 CSX 62,8 CSX CIV CSX CDX Valeria Mancinelli * Ancona 2018 59,8 -3,0 che gli stessi politici occupano. -
Aro Top Sindaci Endino Aggi Ko
Il Sole 24 Ore Lunedì 6 Luglio 2020 3 Primo Piano Città capoluogo. Premiato chi L’indice di gradimento dei sindaci periferia e centro ha gestito la crisi in prima linea Il Governance Poll sui sindaci delle città capoluogo di provincia: graduatoria in base al risultato 2020 (in %), voti ottenuti nel giorno dell’elezione (in %) e differenza CDX CENTRODESTRA CSX CENTROSINISTRA M5S M5S CIV LISTE CIVICHE LEGA LEGA IND INDIPENDENTE saranno POS. SINDACO COMUNE ANNO ELEZIONE GOVERNANCE POLL 2020 CONSENSO GIORNO ELEZIONE DIFF. % 35 50 65 80 i nuovi leader? 1 CSX Antonio Decaro * Bari 2019 66,3 69,4 +3,1 Sul podio il salto non È 2 CIV Cateno De Luca Messina 2018 65,3 67,4 +2,1 3 CSX Giorgio Gori * Bergamo 2019 55,3 63,7 +8,4 I sindaci al vertice del Governance Poll 2020 scontato CDX Marco Bucci Genova 2017 55,2 63,7 +8,5 1 2 3 4 5 CSX Luca Salvetti Livorno 2019 60,5 63,3 -2,8 CDX Luigi Brugnaro Venezia 2015 53,2 60,5 +7,3 di Antonio Noto 7 CDX Pierluigi Peracchini La Spezia 2017 60,0 60,4 +0,4 8 CDX Rodolfo Ziberna Gorizia 2017 59,8 60,2 +0,4 risultati del Governance Poll 9 CIV Damiano Coletta Latina 2016 60,0 75,1 -15,1 2020 sembrerebbero aprire CDX Marco Fioravanti Ascoli Piceno 2019 59,3 60,0 +0,7 nuovi scenari di leadership na- 7 zionale, ma bisogna sempre fare Antonio Cateno Giorgio Marco CIV Andrea Soddu Nuoro 2015 60,0 68,4 -8,4 Decaro De Luca Gori Bucci Iconti con i profili percepiti dagli 12 CDX Alessandro Ciriani Pordenone 2016 58,8 59,9 + 1,1 elettori in relazione ai singoli ruoli 13 CSX 62,8 CSX CIV CSX CDX Valeria Mancinelli * Ancona 2018 59,8 -3,0 che gli stessi politici occupano. -

Paolo Berlusconi
Giornale -f libro ^ra Giampaolo Pansa Consorzio Cooperative Abitazione «I BUGIARDI» Consorzio Cooperative Abitazione (Voi. 1 ) I grandi giornalisti ANNO 71. N. 60 SPED. IN ABB, POST. - 50% .ROMA SABATO 12 MARZO 1994 - L 2.500 «tu. L Coinvolto un ex funzionario comunista già inquisito Clinton fra boom e scandali Paolo Berlusconi: ANDREA BARBATO «Sì, pagai tangenti» L SORRISO di Bill Clin ton, in questi giorni, somiglia sempre di più ad una smorfia forza ta. Gli americani, in In un Comune soldi a Psi e Pei ^_I _ percentuali crescenti, sospettano di lui. La sua popola ai ROMA. Silvio Berlusconi insiste nella tesi della per del Pei. già inquisiti e arrestati a suo tempo e che sa rità decresce. Borsa e dollaro av secuzione giudiziaria, si appella a Scalfaro, denun rebbero, secondo l'accusa, tra i beneficiari di parte del vertono contraccolpi. 1 giornali, ciando inquinamenti nell'inchiesta che vede coinvolta denaro insieme ad altri amministratori locali. Silvio anche i grandi fogli democratici la Fininvest, ma rinuncia all'esposto al Csm. Un cam-. Berlusconi, da Roma, ha difeso così il tratello: «Era im della costa orientale, stampano bio di strategia del Cavaliere nella sua difficile partita possibile sottrarsi a certe richieste». Il Cavaliere ha vis titoli e articoli carichi di veleni. con i magistrati del pool, mentre proprio da Milano suto dunque un'altra difficile giornata, passata a Ro L'inchiesta sulle transazioni fi giungono novità dalle indagini e il fratello minore Pao nanziarie e immobiliari nell'Ar ma tra un summit con i legali e uno sfortunato tour in lo ammette di aver attinto, per pagare tangenti, da fon due ospedali. -

I Suoi Valori Sono Irrinunciabili E Tracciano La
d’Italia ANNO LXIII N.21 Registrazione Tribunale di Roma N. 16225 del 23/2/76 WWW.SECOLODITALIA.IT mercoledì 28/1/2015 AN VENT’ANNI DOPO: I SUOI VALORI Franco Mugnai economico, tanto per citarne alcune, A ventiSONO anni dalla svolta IRRINUNCIABILI di Fiuggi. E TRACCIANO LA ROTTA sono battaglie che non hanno tempo, A vent’anni dal momento in cui perché sono la nostra storia, il nostro prese il via la rivoluzione del cen- presente, il nostro futuro. Il venten- trodestra. Nel gennaio del 1995 nale di Alleanza Nazionale non è, era già finita la prima Repubblica, la stagione del pentapartito, la quindi, una pur doverosa celebra- ghettizzazione della destra ita- zione, ma, soprattutto, una significa- liana, il tentativo di mettere all’an- tiva presa di coscienza, perché golo, non tanto un partito, quanto nessuno pensi che si tratti solo di “ri- un’intera comunità umana con il cordare”. Il miglior futuro d’Italia sta, suo patrimonio storico, culturale e infatti, nel rispetto di quei valori, nella di idee. Nacque così Alleanza Na- difesa di quei principi e nell’afferma- zionale; e con Alleanza Nazionale zione di quelle idee che Alleanza Na- si formò una coalizione che, nata zionale come partito seppe quasi all’improvviso e cresciuta in pochi mesi, sarebbe entrata nel mirabilmente incarnare. cuore degli italiani. Le radici germogliano Le idee di Alleanza nazionale Compito dalla Fondazione è far si Oggi, ricordando quel momento, che le radici profonde di questo pa- quei principi e quelle idee, tanto cari quella svolta, operata nel solco di non vogliamo fermarci al mero trimonio valoriale e programmatico, a quanti si sentono di appartenere in- una continuità di valori perenni che profilo commemorativo e all’analisi non solo non gelino mai, ma, costan- retrospettiva di ciò che è stato, scindibilmente alla comunità nazio- andavano a coniugarsi in una mo- nale e intendono dividerne, derna visione politica. -

Seduta Di Martedì 24 Gennaio 1995
Atti Parlamentari — 7519— Camera dei Deputati XH LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1995 RESOCONTO STENOGRAFICO 126. SEDUTA DI MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IRENE PIVETTI INDI DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE INDICE PAG. PAG. Comunicazioni del Governo (Discussio• CAVERI LUCIANO (gruppo misto-UV) . 7526 ne): CERULLO PIETRO (gruppo FE-LD) .... 7529 PRESIDENTE . 7523, 7524, 7525, 7526, 7528, COSTA RAFFAELE (gruppo FE-LD) .... 7592 7529, 7531, 7532, 7534, 7537, 7538, 7539, D'ALEMA MASSIMO (gruppo progressisti- 7543, 7544, 7546, 7549, 7551, 7552, 7556, federativo) 7603 7558, 7559, 7560, 7562, 7563, 7564, 7565, DELLA VALLE RAFFAELE (gruppo forza Ita• 7566, 7568, 7570, 7572, 7573, 7574, 7575, lia) 7585 7577, 7578, 7580, 7582, 7583, 7584, 7585, Dì LUCA ALBERTO (gruppo forza Italia) . 7523 7586, 7588, 7592, 7594, 7596, 7600, 7603, D'ONOFRIO FRANCESCO (gruppo CCD). 7552 7605, 7608, 7609, 7613, 7614, 7615, 7616, ELIA LEOPOLDO (gruppo PPI) 7568 7617, 7618, 7619, 7624, 7625, 7626, 7629, FINI GIANFRANCO (gruppo alleanza nazio- 7632 nale-MSI) 7619 BERLUSCONI SILVIO (gruppo forza Italia) 7608 FIORI PUBLIO (gruppo alleanza nazionale- BERTINOTTI FAUSTO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 7596 MSI) 7539 BIANCHI GIOVANNI (gruppo PPI) 7546 FUMAGALLI CARULU OMBRETTA (gruppo BOGI GIORGIO (gruppo misto) 7575 CCD) 7580 Bossi UMBERTO (gruppo lega nord) ... 7614 GARRA GIACOMO (gruppo forza Italia) . 7525 BRUGGER SIEGFRIED (gruppo misto-SVP) 7544 GIUGNI GINO (gruppo progressisti-fede• BOTTIGLIONE Rocco (gruppo PPI) .... 7588 rativo) 7582 CASINI PIER FERDINANDO (gruppo CCD) 7626 GUBETH FURIO (gruppo FE-LD) 7594 126. N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A. -

La Politica Estera Dell'italia Nel 2008
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SEGRETERIA GENERALE UNITÀ DI ANALISI, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTAZIONE STORICO – DIPLOMATICA LA POLITICA ESTERA DELL’ITALIA TESTI E DOCUMENTI 2008 ROMA La politica estera dell’Italia nel 2008 Indice sommario - Introduzione ( Ministro Pierfrancesco Sacco, Capo dell’Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico Diplomatica ) - Composizione del Governo Prodi - Composizione del Governo Berlusconi - Cronologia dei principali avvenimenti concernenti l’Italia - Discorsi generali di politica estera - Aree di interesse prioritario per la politica estera italiana: 1) Unione Europea 2) Medio Oriente 3) Relazioni transatlantiche 4) Nazioni Unite 5) Balcani 1 INTRODUZIONE Questo nuovo volume della collana “Testi e documenti 2008” della politica estera italiana, curato dall’Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico- Diplomatica della Segreteria Generale del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, fa seguito all’edizione relativa al 2007 riprendendone l’impostazione “snella” sperimentata in conseguenza della riduzione delle risorse umane e finanziarie che questo Ministero sta affrontando. I documenti selezionati si riferiscono alle aree di interesse prioritario per la politica estera italiana, individuate sulla base dei contatti diplomatici tenuti dal Ministro D’Alema, una volta caduto a gennaio il Governo Prodi, nei mesi che hanno preceduto le elezioni, e delle dichiarazioni programmatiche di Franco Frattini, Ministro degli Esteri del nuovo Governo Berlusconi. Europeismo, potenziamento del ruolo dell’Italia in Medio Oriente e rafforzamento delle relazioni transatlantiche sono in primo piano. A queste aree si è ritenuto di aggiungere le Nazioni Unite dove, nonostante il cambio di governo, è proseguito l’attivismo italiano già manifestatosi con Romano Prodi, e i Balcani, regione di tradizionale interesse per il nostro paese, segnata nel febbraio di quell’anno dalla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. -

Giugno-Dicembre 2010 / New Acquisitions List
Lista delle nuove acquisizioni – giugno-dicembre 2010 Istituto Affari Internazionali – Biblioteca / Library New Acquisitions List – June-December 2010 LISTA DELLE NUOVE ACQUISIZIONI NEW ACQUISITIONS LIST giugno-dicembre 2010 June-December 2010 1. Strategia, disarmo, etc. 1. Strategy, disarmament, etc. 2. Unione europea 2. European Union 3. Economia 3. Economics 4. Generale 4. Generalities 5. Mediterraneo e Medioriente 5. Mediterranean and Middle East 1. Strategia, disarmo, etc. / Strategy, disarmament, etc. Auf dem Weg zu Global Zero? : die neue amerikanische Nuklearpolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit / Marco Fey ... [et al.]. - Frankfurt am Main : Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktsforschung, 2010. - iii, 37 p. - (HSFK- Report ; 2010/4). - ISBN 978-3-942532-00-6 Autori: Marco Fey, Giorgio Franceschini, Harald Müller, Hans-Joachim Schmidt Testo online: http://www.hsfk.de/fileadmin/downloads/report0410.pdf HSFK 223 Between morality and military interests: norm setting in humanitarian arms control / Simone Wisotzki. - Frankfurt am Main : Peace Research Institute Frankfurt, [2010]. - iii, 34 p. - (PRIF reports ; 92). - ISBN 978-3-937829-98-2 Pubbl. anche in tedesco: Zwischen moralischen Motiven und militärischen Interessen: Die Normenentwicklung in der humanitären Rüstungskontrolle (HSFK-Report ; 7/2009) Testo online: http://hsfk.de/fileadmin/downloads/PRIF_NO_92hp.pdf PRIF 87 Il caro armato : spese, affari e sprechi delle Forze Armate italiane / Massimo Paolicelli, Francesco Vignarca. - [S.l. : Altreconomia, 2009. - 129 p. - (I libri di Altreconomia) Suppl. di Altreconomia, n. 110 (2009) A 1824 Chinese energy security: the myth of the PLAN's frontline status / Ryan Clarke. - Carlisle Barracks : U.S. Army War College. Strategic Studies Institute, 2010. - vii, 113 p. - (Letort paper). - ISBN 1-58487-456-2 Testo online: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub1012.pdf A 1819 Contemporary conflict resolution : the prevention, management and transformation of deadly conflicts / Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Miall. -

Dal Movimento Sociale Italiano Ad Alleanza Nazionale Da Almirante a Fini Pietro Blandini
1 Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra di Storia e teoria dei movimenti e dei partiti politici Dal Movimento Sociale Italiano ad Alleanza Nazionale Da Almirante a Fini Pietro Blandini Prof. Andrea Ungari RELATORE Pietro Blandini – Matricola 084562 CANDIDATO Anno Accademico 2019-2020 2 Indice Introduzione 4 1. Almirante e Fini 6 1. Giorgio Almirante 6 1.1 L’infanzia, i primi lavori come giornalista e il fascismo (1914-1945) 6 1.2 Il dopoguerra e la latitanza (1945-1946) 7 1.3 La fondazione del Movimento Sociale Italiano (1946) 8 1.4 La prima (breve) segreteria e gli anni dell’opposizione interna (1947-1969) 8 1.5 La seconda segreteria: Almirante anima del partito (1969-1984) 10 1.6 Il funerale di Berlinguer, gli ultimi anni e la morte (1984-1988) 12 2. Gianfranco Fini 14 2.1 La giovinezza a Bologna e i primi tempi a Roma (1952-1971) 14 2.2 Rivalità con Tarchi, lavoro nel Secolo d’Italia e coordinatore nel Fronte della Gioventù (1971-1986) 15 2.3 Tenere accesa la fiamma di Giorgio (1987–1991) 16 2.4 Il partito degli onesti e il progetto di Alleanza Nazionale (1991-1995) 18 2.5 L’epilogo politico (2009-2013) 21 2. Il Movimento Sociale Italiano 22 1. Le origini e la fondazione (1945-1950) 22 2. L’apertura a destra della segreteria De Marsanich (1950-1954) 25 3. Il possibile inserimento e il disastro del governo Tambroni (1954-1960) 27 4. Il fallimento della strategia dell’inserimento: la fine della segreteria Michelini (1960-1969) 29 5.