Heimatkrieg 1939 Bis 1945
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Department of History
UNIVERSITY OF CALGARY Blitzkrieg under Fire: Gennan Rearmarnent, Total Economic Mobilization, and the Myth of the "Blitzkneg Strategy", 1933-1942 by Brett Thomas Gore A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTiAL FULFILLMENT OF THE REQUREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS DEPARTMENT OF HISTORY CALGARY, ALBERTA DECEMBER 2000 O Brett Thomas Gore 2000 National Libaiy Bibliothèque nationale 1+1 of,,, du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliogaphic Services se- bibliographiques 395 WMinStreet 395. rue WeDingîm Ottawa ON K1A ON4 ûUawaON K1AW canada Canada The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive licence aiiowing the exclisïve permettant à la National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de reproduce, loan, distri'bute or seil reproduire, prêter, distri'buer ou copies of this thesis in microform, vendre des copies de cette thése sous paper or electronic formats. la fome de microfiche/film, de reproduction sur papier ou sur format électronique. The author retains ownership of the L' auteur conserve la propriété du copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. thesis nor substantial extracts fiom it Ni la thèse ni des extraits substantiels may be prînted or otherwise de celle-ci ne doivent être imprimés reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son permission. autorisation. The "Blitzkrieg Strategy" as an historid theory has bedthe debate for the last five decades conceming the nature, extent, and purpose of German rearmament during the 1930s, and the performance of the Thini Reich's rnilitary forces and war economy between 1939 and 1941. -

Dive Bomber and Ground Attack Units of the Luftwaffe 1933-45: V. 1 Free
FREE DIVE BOMBER AND GROUND ATTACK UNITS OF THE LUFTWAFFE 1933-45: V. 1 PDF Henry L. de Zeng,Douglas G. Stankey | 192 pages | 01 Mar 2010 | Crecy Publishing | 9781906537081 | English | Manchester, United Kingdom Dive Bombers and Ground Attack Units of the Luftwaffe A Reference Guide Volume 1 Supplier out of stock. If you add this item to your wish list we will let you know when it becomes available. Is the information for this product incomplete, wrong or inappropriate? Let us know about it. Does this product have an incorrect or missing image? Send us a new image. Is this product missing categories? Add more categories. Review This Product. Welcome to Loot. Checkout Your Cart Price. Special order. This item is a special order that could take a long time to obtain. Description Details Customer Reviews The second in this two-volume series will provide aviation historians with an exhaustive reference work on all the Luftwaffe's Dive Bomber and Ground Attack Units of the Luftwaffe 1933-45: v. 1 and ground-attack units, including information on operations. All 16 Stuka Geschwader, 17 ground-attack and 20 night-harassment units are covered along with their component staff flights and Gruppen and specialist anti-tank units. The two volumes are divided into the early and late phases of the war, and cover pre-war formation, designation and reorganisation until the demise of the Luftwaffe, with lists of key operations, locations, bases and transfers together with an Dive Bomber and Ground Attack Units of the Luftwaffe 1933-45: v. 1 breakdown of theatres of operations, key battles and missions flown and aircraft types that were flown by each unit. -

Field-Marshal Albert Kesselring in Context
Field-Marshal Albert Kesselring in Context Andrew Sangster Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctorate of Philosophy University of East Anglia History School August 2014 Word Count: 99,919 © This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that use of any information derived there from must be in accordance with current UK Copyright Law. In addition, any quotation or abstract must include full attribution. Abstract This thesis explores the life and context of Kesselring the last living German Field Marshal. It examines his background, military experience during the Great War, his involvement in the Freikorps, in order to understand what moulded his attitudes. Kesselring's role in the clandestine re-organisation of the German war machine is studied; his role in the development of the Blitzkrieg; the growth of the Luftwaffe is looked at along with his command of Air Fleets from Poland to Barbarossa. His appointment to Southern Command is explored indicating his limited authority. His command in North Africa and Italy is examined to ascertain whether he deserved the accolade of being one of the finest defence generals of the war; the thesis suggests that the Allies found this an expedient description of him which in turn masked their own inadequacies. During the final months on the Western Front, the thesis asks why he fought so ruthlessly to the bitter end. His imprisonment and trial are examined from the legal and historical/political point of view, and the contentions which arose regarding his early release. -

Der Zweite Weltkrieg / Band 08
Der Zweite Weltkrieg / Band 08 Luftkrieg Europa-bezogen Vorwort und Themen dieses Buches Vorwort zum Luftkrieg Europa bezogen Der Verlauf des Luftkrieges in fünf Phasen Zusatzthemen zum Luftkrieg Navigation und Abwurf der Bomben Flugabwehrkanonen und Jäger in Deutschland Luftwaffen der am Krieg in Europa beteiligten Länder Vorwort und Themen dieses Buches Der Zweite Weltkrieg von 1939 bis 1945 war der zweite global geführte Krieg sämtlicher Grossmächte des 20. Jahrhunderts und stellt den grössten militärischen Konflikt in der Geschichte der Menschheit dar. Er begann in Europa mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939. In Ostasien befand sich das mit Deutschland verbündete Japan seit 1938 in einem Grenzkrieg mit der Sowjetunion und seit 1937 im Pazifikkrieg mit China. Im Kriegsverlauf bildeten sich zwei militärische Allianzen, die als Achsenmächte und Alliierte bezeichnet werden. Direkt oder indirekt waren über 60 Staaten an diesem Krieg beteiligt, mehr als 110 Millionen Menschen standen unter Waffen. Der Krieg kostete über 60 Millionen Menschen das Leben und erfasste den ganzen Erdball. Der Zweite Weltkrieg bestand in Europa aus Blitzkriegen, Eroberungsfeldzügen gegen die deutschen Nachbarländer mit Eingliederung besetzter Gebiete, der Einsetzung von Marionettenregierungen, Flächenbombardements sowie im letzten Jahr dem Einsatz von Atomwaffen in Japan; er verlief in drei Hauptphasen. Mittelbar starben Millionen Menschen durch Holocaust (Shoa), Porajmos und weitere Massenmorde, durch Zwangsarbeit und zahllose Kriegsverbrechen. Das vorliegende Buch ist ein Zusammenzug von vorhandenen Daten und Dokumente und der Versuch diese in einen chronologischen Ablauf zu bringen. Die Quellen sind jeweils zu Beginn eines Themas aufgeführt. Keiner dachte nach dem 1. Weltkrieg, dass ein solches furchtbares Ereignis noch übertroffen werden könnte. -

Once in a Blue Moon: Airmen in Theater Command Lauris Norstad, Albrecht Kesselring, and Their Relevance to the Twenty-First Century Air Force
COLLEGE OF AEROSPACE DOCTRINE, RESEARCH AND EDUCATION AIR UNIVERSITY AIR Y U SIT NI V ER Once in a Blue Moon: Airmen in Theater Command Lauris Norstad, Albrecht Kesselring, and Their Relevance to the Twenty-First Century Air Force HOWARD D. BELOTE Lieutenant Colonel, USAF CADRE Paper No. 7 Air University Press Maxwell Air Force Base, Alabama 36112-6615 July 2000 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Belote, Howard D., 1963– Once in a blue moon : airmen in theater command : Lauris Norstad, Albrecht Kesselring, and their relevance to the twenty-first century Air Force/Howard D. Belote. p. cm. -- (CADRE paper ; no. 7) Includes bibliographical references. ISBN 1-58566-082-5 1. United States. Air Force--Officers. 2. Generals--United States. 3. Unified operations (Military science) 4. Combined operations (Military science) 5. Command of troops. I. Title. II. CADRE paper ; 7. UG793 .B45 2000 358.4'133'0973--dc21 00-055881 Disclaimer Opinions, conclusions, and recommendations expressed or implied within are solely those of the author and do not necessarily represent the views of Air University, the United States Air Force, the Department of Defense, or any other US government agency. Cleared for public release: distribution unlimited. This CADRE Paper, and others in the series, is available electronically at the Air University Research web site http://research.maxwell.af.mil under “Research Papers” then “Special Collections.” ii CADRE Papers CADRE Papers are occasional publications sponsored by the Airpower Research Institute of Air University’s (AU) College of Aerospace Doctrine, Research and Education (CADRE). Dedicated to promoting understanding of air and space power theory and application, these studies are published by the Air University Press and broadly distributed to the US Air Force, the Department of Defense and other governmental organiza- tions, leading scholars, selected institutions of higher learn- ing, public policy institutes, and the media. -
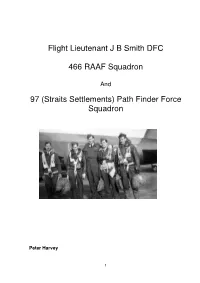
Flight Lieutenant JB Smith DFC 466 RAAF
Flight Lieutenant J B Smith DFC 466 RAAF Squadron And 97 (Straits Settlements) Path Finder Force Squadron Peter Harvey 1 Forward Flight Lieutenant Smith DFC was the pilot / captain of my late uncle’s Lancaster, JB708 OF-J, 97 Path Finder Force (PFF) Squadron, which was shot down on the 11th May 1944 on a 5 Group bombing operation targeting the Lille railway infrastructure. F/L Smith was the Deputy Controller for this sortie and therefore the crew would have been one of the most experienced in the Squadron at that time. The crew were: • 414691 F/L JB Smith DFC RNZAF, Pilot • 537312 Sgt AR Rowlands RAFVR, Flight Engineer • 134059 F/O AR Weston RAFVR, Navigator • 138589 F/L LC Jones DFC RAFVR, Bomb Aimer • 174353 P/O DED Harvey DFM RAFVR, Wireless Operator • R/85522 W/O JR Chapman DFC RCAF, Upper Air Gunner • J/17360 F/O SG Sherman RCAF, Rear Air Gunner There are two websites dedicated to the crew: http://greynomad7.wix.com/a-97-sqn-pff-aircrew#!home/mainPage http://tribalgecko.wix.com/lancasterjb708#!jb708 The following data provides a short history of just one Bomber Command pilot and his crews. F/L Smith served with 466 RAAF Squadron at Leconfield in North Yorkshire, became a flying instructor after 29 operational flights and then volunteered to join 97 PFF Squadron stationed at RAF Coningsby in Lincolnshire. He was a member of the Royal New Zealand Air Force and carried out his flying training in Canada. The data is taken from varying sources listed in the bibliography. -

© Osprey Publishing • © Osprey Publishing • HITLER’S EAGLES
www.ospreypublishing.com © Osprey Publishing • www.ospreypublishing.com © Osprey Publishing • www.ospreypublishing.com HITLER’S EAGLES THE LUFTWAFFE 1933–45 Chris McNab © Osprey Publishing • www.ospreypublishing.com CONTENTS Introduction 6 The Rise and Fall of the Luftwaffe 10 Luftwaffe – Organization and Manpower 56 Bombers – Strategic Reach 120 Fighters – Sky Warriors 174 Ground Attack – Strike from Above 238 Sea Eagles – Maritime Operations 292 Ground Forces – Eagles on the Land 340 Conclusion 382 Further Reading 387 Index 390 © Osprey Publishing • www.ospreypublishing.com © Osprey Publishing • www.ospreypublishing.com INTRODUCTION A force of Heinkel He 111s near their target over England during the summer of 1940. Once deprived of their Bf 109 escorts, the German bombers were acutely vulnerable to the predations of British Spitfires and Hurricanes. © Osprey Publishing • www.ospreypublishing.com he story of the German Luftwaffe (Air Force) has been an abiding focus of military Thistorians since the end of World War II in 1945. It is not difficult to see why. Like many aspects of the German war machine, the Luftwaffe was a crowning achievement of the German rearmament programme. During the 1920s and early 1930s, the air force was a shadowy organization, operating furtively under the tight restrictions on military development imposed by the Versailles Treaty. Yet through foreign-based aircraft design agencies, civilian air transport and nationalistic gliding clubs, the seeds of a future air force were nevertheless kept alive and growing in Hitler’s new Germany, and would eventually emerge in the formation of the Luftwaffe itself in 1935. The nascent Luftwaffe thereafter grew rapidly, its ranks of both men and aircraft swelling under the ambition of its commander-in-chief, Hermann Göring. -

Dive Bomber and Ground Attack Units of the Luftwaffe 1933-45: V. 2 Free
FREE DIVE BOMBER AND GROUND ATTACK UNITS OF THE LUFTWAFFE 1933-45: V. 2 PDF Henry L. de Zeng IV,Douglas G. Stankey | 192 pages | 30 Jun 2013 | Crecy Publishing | 9781906537098 | English | Manchester, United Kingdom BN No Results Page | Barnes & Noble® This close-support Stuka unit fought principally in the southern sector of the Eastern Front in places like Stalingrad and the Caucasus. The early two Schlachtgeschwader 1 and 2 were abbreviated SchlG, the reformed Stukageschwader in were abbreviated SG. Schlachtgeschwader 2 "Immelmann" was formed on 18 October from Sturzkampfgeschwader 2. InStukageschwader 2 was transferred to the Eastern Front. On 26 JuneStuka Geschwader 2 attacked 60 Soviet tanks south of Grodnoand later discovered that only one T had been knocked out. During the rest of andthe inadequacy of dive-bombing tanks became more evident. The most effective way to assault tanks from the air would appear with SG 2 in During the attack, Oblt. During the spring of SG 2 worked up Dive Bomber and Ground Attack Units of the Luftwaffe 1933-45: v. 2 modified Ju 87 G-1 'tank-busters' armed with two Rheinmetall-Borsig 37mm Flak 18 guns mounted under each wing. Prototypes were first used against Russian landing craft in the Black Sea area. In March Rudel knocked out the first tank with the new Stuka. This was a dedicated tank-buster, with no secondary dive-bombing role. While II. By early II. By May the depleted II. By April Stab and II. At the end of Dive Bomber and Ground Attack Units of the Luftwaffe 1933-45: v. -

The Early 20Th Century Produced a Number of Military Aviation Theorists Whose Tactics Guided the Various Air Forces of World War II
The early 20th Century produced a number of military aviation theorists whose tactics guided the various Air Forces of World War II. Italian General Giulio Douhet was one of the earliest proponents of strategic bombing, convinced that heavy bombing of population centers would so demoralize an enemy that their will to fight would disappear. Billy Mitchell proved that aircraft could sink a battleship, Walther Wever of the Luftwaffe showed the value of tactical bombing and Hugh Trenchard developed the RAF’s doctrine. In the Pacific War, these theories were refined and utilized by aviators of both Japan and the Allies. Japan’s aircraft opened the Pacific War by sinking most of America’s Pacific Fleet battleships. Effective tactical air strikes destroyed enemy defenses prior to the Japanese amphibious assaults that conquered all of the western Pacific in the first 6 months of the war. America responded in kind, our aircraft neutralizing the Japanese Navy at Leyte Gulf, later destroying it with raids on Japanese naval bases in the home islands. Now, in fall of 1944, American victories and Japanese setbacks drove changes to the air war. Japan would adopt a strategy of desperation – Special Attack Squadrons flown by suicide pilots. America would switch from tactical air operations to the strategic bombing of Japan itself. Both strategies were shocking and in retrospect, controversial. The B-29’s of the XX Bomber Command, headed by the experienced and able General Curtis LeMay, had been attacking Japan from bases in China since mid-June 1944 but successful offensives by Japanese infantry against Nationalist and Communist Chinese forces - themselves at odds with each other - placed our airfields in peril. -

Luftwaffe Maritime Operations in World War Ii
AU/ACSC/6456/2004-2005 AIR COMMAND AND STAFF COLLEGE AIR UNIVERSITY LUFTWAFFE MARITIME OPERATIONS IN WORLD WAR II: THOUGHT, ORGANIZATION AND TECHNOLOGY by Winston A. Gould, Major, USAF A Research Report Submitted to the Faculty In Partial Fulfillment of the Graduation Requirements Instructor: Dr Richard R. Muller Maxwell Air Force Base, Alabama April 2005 Distribution A: Approved for Public Release; Distribution is Unlimited Ú±®³ ß°°®±ª»¼ λ°±®¬ ܱ½«³»²¬¿¬·±² п¹» ÑÓÞ Ò±ò ðéðìóðïèè Ы¾´·½ ®»°±®¬·²¹ ¾«®¼»² º±® ¬¸» ½±´´»½¬·±² ±º ·²º±®³¿¬·±² ·• »•¬·³¿¬»¼ ¬± ¿ª»®¿¹» ï ¸±«® °»® ®»•°±²•»ô ·²½´«¼·²¹ ¬¸» ¬·³» º±® ®»ª·»©·²¹ ·²•¬®«½¬·±²•ô •»¿®½¸·²¹ »¨·•¬·²¹ ¼¿¬¿ •±«®½»•ô ¹¿¬¸»®·²¹ ¿²¼ ³¿·²¬¿·²·²¹ ¬¸» ¼¿¬¿ ²»»¼»¼ô ¿²¼ ½±³°´»¬·²¹ ¿²¼ ®»ª·»©·²¹ ¬¸» ½±´´»½¬·±² ±º ·²º±®³¿¬·±²ò Í»²¼ ½±³³»²¬• ®»¹¿®¼·²¹ ¬¸·• ¾«®¼»² »•¬·³¿¬» ±® ¿²§ ±¬¸»® ¿•°»½¬ ±º ¬¸·• ½±´´»½¬·±² ±º ·²º±®³¿¬·±²ô ·²½´«¼·²¹ •«¹¹»•¬·±²• º±® ®»¼«½·²¹ ¬¸·• ¾«®¼»²ô ¬± É¿•¸·²¹¬±² Ø»¿¼¯«¿®¬»®• Í»®ª·½»•ô Ü·®»½¬±®¿¬» º±® ײº±®³¿¬·±² Ñ°»®¿¬·±²• ¿²¼ λ°±®¬•ô ïîïë Ö»ºº»®•±² Ü¿ª·• Ø·¹¸©¿§ô Í«·¬» ïîðìô ß®´·²¹¬±² Êß îîîðîóìíðîò λ•°±²¼»²¬• •¸±«´¼ ¾» ¿©¿®» ¬¸¿¬ ²±¬©·¬¸•¬¿²¼·²¹ ¿²§ ±¬¸»® °®±ª·•·±² ±º ´¿©ô ²± °»®•±² •¸¿´´ ¾» •«¾¶»½¬ ¬± ¿ °»²¿´¬§ º±® º¿·´·²¹ ¬± ½±³°´§ ©·¬¸ ¿ ½±´´»½¬·±² ±º ·²º±®³¿¬·±² ·º ·¬ ¼±»• ²±¬ ¼·•°´¿§ ¿ ½«®®»²¬´§ ª¿´·¼ ÑÓÞ ½±²¬®±´ ²«³¾»®ò ïò ÎÛÐÑÎÌ ÜßÌÛ íò ÜßÌÛÍ ÝÑÊÛÎÛÜ ßÐÎ îððë îò ÎÛÐÑÎÌ ÌÇÐÛ ððóððóîððë ¬± ððóððóîððë ìò Ì×ÌÔÛ ßÒÜ ÍËÞÌ×ÌÔÛ ë¿ò ÝÑÒÌÎßÝÌ ÒËÓÞÛÎ ÔËÚÌÉßÚÚÛ ÓßÎ×Ì×ÓÛ ÑÐÛÎßÌ×ÑÒÍ ×Ò ÉÑÎÔÜ ÉßÎ ××æ ë¾ò ÙÎßÒÌ ÒËÓÞÛÎ ÌØÑËÙØÌô ÑÎÙßÒ×ÆßÌ×ÑÒ ßÒÜ ÌÛÝØÒÑÔÑÙÇ ë½ò ÐÎÑÙÎßÓ ÛÔÛÓÛÒÌ ÒËÓÞÛÎ -

WINTER 2010 - Volume 57, Number 4 the Air Force Historical Foundation Founded on May 27, 1953 by Gen Carl A
WINTER 2010 - Volume 57, Number 4 WWW.AFHISTORICALFOUNDATION.ORG The Air Force Historical Foundation Founded on May 27, 1953 by Gen Carl A. “Tooey” Spaatz MEMBERSHIP BENEFITS and other air power pioneers, the Air Force Historical All members receive our exciting and informative Foundation (AFHF) is a nonprofi t tax exempt organization. Air Power History Journal, either electronically or It is dedicated to the preservation, perpetuation and on paper, covering: all aspects of aerospace history appropriate publication of the history and traditions of American aviation, with emphasis on the U.S. Air Force, its • Chronicles the great campaigns and predecessor organizations, and the men and women whose the great leaders lives and dreams were devoted to fl ight. The Foundation • Eyewitness accounts and historical articles serves all components of the United States Air Force— Active, Reserve and Air National Guard. • In depth resources to museums and activities, to keep members connected to the latest and AFHF strives to make available to the public and greatest events. today’s government planners and decision makers information that is relevant and informative about Preserve the legacy, stay connected: all aspects of air and space power. By doing so, the • Membership helps preserve the legacy of current Foundation hopes to assure the nation profi ts from past and future US air force personnel. experiences as it helps keep the U.S. Air Force the most modern and effective military force in the world. • Provides reliable and accurate accounts of historical events. The Foundation’s four primary activities include a quarterly journal Air Power History, a book program, a • Establish connections between generations. -

Flying German Aircraft of World War Ii Pdf, Epub, Ebook
WINGS OF THE LUFTWAFFE : FLYING GERMAN AIRCRAFT OF WORLD WAR II PDF, EPUB, EBOOK Captain Eric Brown | 288 pages | 15 Sep 2010 | Hikoki Publications | 9781902109152 | English | Ottringham, United Kingdom Wings of the Luftwaffe : Flying German Aircraft of World War II PDF Book Wingspan was 65 feet 10 inches, and the plane was driven by a pair of horsepower Junkers Jumo F engines. FAGr Nearly half the subjects died from the experiment, and the others were executed. Item added to your basket View basket. Within just 13 years however, the Nazi regime had formed a new air force that would quickly become one of the most sophisticated in the world. Best Selling in Nonfiction See all. The Philips firm was entrusted to produce the EC tube equipped radar. Despite the developments, the Me still remained a plane that needed big patience. Heater Fuel Filter F 4. Black boards in jacket. Wings of the Luftwaffe : Flying the Captured German Aircraft of World War II Eric Melrose Brown Hikoki Publications , - Seiten 0 Rezensionen During more than two decades of uninterrupted flying Eric 'Winkle' Brown enjoyed the most extraordinary career of any test pilot and no pilot has a logbook that lists a greater variety of aircraft types flown. The pages of Wings of the Luftwaffe present a fascinating and detailed collage of pilot reports on a truly astounding array of German aircraft, all presented in Brown's easy going, concise and imminently readable style. The long range-reconnaissance variants had three copies. Will be clean, not soiled or stained. However, the Luftwaffe was unable to achieve air superiority over Britain in the summer of that year — something that Hitler had set as a precondition for an invasion.