Das Medium Feldpost Als Gegenstand Interdisziplinärer Forschung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va
GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 32. Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police (Part I) The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1961 This finding aid has been prepared by the National Archives as part of its program of facilitating the use of records in its custody. The microfilm described in this guide may be consulted at the National Archives, where it is identified as RG 242, Microfilm Publication T175. To order microfilm, write to the Publications Sales Branch (NEPS), National Archives and Records Service (GSA), Washington, DC 20408. Some of the papers reproduced on the microfilm referred to in this and other guides of the same series may have been of private origin. The fact of their seizure is not believed to divest their original owners of any literary property rights in them. Anyone, therefore, who publishes them in whole or in part without permission of their authors may be held liable for infringement of such literary property rights. Library of Congress Catalog Card No. 58-9982 AMERICA! HISTORICAL ASSOCIATION COMMITTEE fOR THE STUDY OP WAR DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECOBDS MICROFILMED AT ALEXAM)RIA, VA. No* 32» Records of the Reich Leader of the SS aad Chief of the German Police (HeiehsMhrer SS und Chef der Deutschen Polizei) 1) THE AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION (AHA) COMMITTEE FOR THE STUDY OF WAE DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA* This is part of a series of Guides prepared -

The Ultimate Sacrifice
THE ULTIMATE SACRIFICE The Jersey islanders who died in German prisons and concentration camps during the Occupation 1940 - 1945 Paul Sanders © Paul Sanders 2004 COVER IMAGE 'In the Camp' (1940), by Felix Nussbaum. Nussbaum was born in Osnabrueck, Germany, in 1904, and studied in Hamburg, Berlin and Rome. He settled in Belgium in 1935. After the German invasion of May 1940, he was arrested and sent to the camps of Saint Cyprien and Gurs ('The camps of shame'), in southern France. Nussbaum escaped and then went into hiding in Brussels. He was denounced in 1944 and transported to Auschwitz where he perished, on August 2, 1944. 2 Completely revised and updated second edition 2004 First published in Jersey in 1998 by Jersey Heritage Trust Copyright © 2004 Paul Sanders All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. Paul Sanders has asserted his moral right to be identified as the author of this work. ISBN 0 9538858 4 Typeset and layout, Jersey Heritage Trust Printed in Great Britain by Biddles Limited Jersey Heritage Trust Jersey Museum The Weighbridge St Helier Jersey JE2 3NF Tel 01534-633300 Fax 01534-633301 3 DEDICATION To Joe Mière Without whose decades of persistent groundwork the story of the twenty two Jersey prisoners would have remained untold To Peter Hassall Jersey’s ‘Night and Fog’ survivor who shared with the author the -
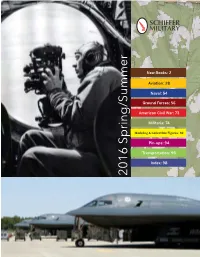
2016 Spring/Summer
SCHIFFER MILITARY New Books: 2 Aviation: 28 Naval: 54 Ground Forces: 56 American Civil War: 73 Militaria: 74 Modeling & Collectible Figures: 92 Pin-ups: 94 Transportation: 96 Index: 98 2016 Spring/Summer 2 2016 NEW BOOKS the 23rd waffen ss volunteer panzer grenadier division contents nederland 2016 new books 10 Enter the uavs: the 27th waffen ss the faa and volunteer drones in america grenadier division 7 langemarck 10 harriet quimby: training the right soldiers flying fair lady stuff: the at the doorstep: aircraft that civil war lore 4 produced america's jet 11 pilots 7 project mercury: suppliers to the matterhorn—the america in space confederacy, v. ii operational history series of the us xx bomber 11 command from india 8 and china, 1944–1945 5 project gemini: last ride of the a pictorial history america in space valkyries: the rise of the b-2a series and fall of the spirit stealth wehrmachthelfer- bomber 8 innenkorps during 5 wwii 12 the history of the german u-boat waffen-ss dyess air force base at lorient, camouflage base, 1941 to the france, august 1942– uniforms, vol. 1 present august 1943, vol. 3 13 6 9 german u-boat ace waffen-ss jet city rewind: peter cremer: camouflage the patrols of aviation history uniforms, vol. 2 u-333 in of seattle and the world war ii pacific northwest 13 6 9 2016 NEW BOOKS 3 german military travel papers of the second world war 14 united states american the model 1891 navy helicopter heroes quilts, carcano rifle patches past and present 24 15 19 united states mitchell’s new a collector’s marine corps general atlas guide to the emblems: 1804 to 1860 savage 99 rifle world war i 20 15 25 privateers american ferrer-dalmau: of the revolution: breechloading art, history, and war on the new mobile artillery miniatures jersey coast, 1875–1953 1775–1783 21 26 16 fighting for making leather bombshell: uncle sam: knife sheaths, the pin-up art of buffalo soldiers vol. -

Deutsche Generäle in Britischer Gefangenschaft 1942–1945. Eine
289 Von vielen deutschen Generälen des Zweiten Weltkriegs sind häufig nur die Laufbahndaten bekannt; Briefe und Tagebücher liegen nur wenige vor. Für die For schung sind sie oft genug nur eingeschränkt zugänglich. So fällt es nach wie vor schwer, zu beurteilen, wie die Generale selbst die militärischen und politischen Geschehnisse der Zeit zwischen 1939 und 1945 rezipiert haben und welche Folgerungen sie daraus zogen. Wichtige Aufschlüsse über ihre Kenntnisse von den nationalsozialistischen Massenmorden oder ihr Urteil über den deutschen Widerstand gegen Hitler bieten jedoch die Abhörprotokolle deutscher Stabsoffiziere in britischer Kriegsgefangen schaft. Sönke Neitzel Deutsche Generäle in britischer Gefangenschaft 1942-1945 Eine Auswahledition der Abhörprotokolle des Combined Services Detailed Interrogation Centre UK Die deutsche Generalität hat sich der öffentlichen Reflexion über ihre Rolle wäh rend des Zweiten Weltkrieges weitgehend verschlossen. Das Bild, das sie vor allem in ihren Memoiren von sich selbst zeichnete, läßt sich verkürzt auf die Formel bringen: Sie hat einen sauberen Krieg geführt, hatte von Kriegsverbrechen größe ren Ausmaßes keine oder kaum Kenntnis, und die militärische Niederlage war zu einem Gutteil den dilettantischen Eingriffen Hitlers als Obersten Befehlshaber in die Kriegführung zuzuschreiben. Es erübrigt sich näher darauf einzugehen, daß dieses Bild von der Geschichts wissenschaft längst gründlich widerlegt worden ist. Aber nach wie vor wissen wir wenig darüber, wie die Generäle die Zeit zwischen 1939 und 1945 rezipiert haben, welche Kenntnis sie von den militärischen und politischen Geschehnissen hatten, die über ihren engen Arbeitsbereich hinausgingen, und welche Schlußfolgerungen sie hieraus zogen. Zur Durchleuchtung dieses Komplexes ist vor allem der Rück griff auf persönliche Quellen wie Briefe und Tagebücher notwendig, die allerdings nur von einem kleinen Personenkreis vorliegen und zudem oft auch nur beschränkt zugänglich sind, da sie sich in Privatbesitz befinden1. -

Men at Arms Books
Osprey Men-at-Arms PUBLISHING German Army Elite Units 1939-45 Gordon Williamson * Illustrated by Ramiro Bujeiro CONTENTS INTRODUCTION ‘GROSSDEUTSCHLAND’ ‘FELDHERRNHALLE* GORDON WILLIAMSON was INFANTERIE-REGIMENTER 119 & 9 ‘LIST’ born in 1951 and currently works for the Scottish Land Register. He spent seven years with the Military Police PANZERGRENADIER-DIVISION TA end has published a ‘BRANDENBURG* number of books and articles on the decorations of the Third Reich and their winners. KAVALLERI E-REGIMENT 5 He is author of a number of World War II titles for Osprey. ‘FELDMARSCHALL VON MACKENSEN’ 44. REICHSGRENADIER-DIVISION ‘HOCH UND DEUTSCHMEISTER’ 116. PANZER-DIVISION {‘Windhund’) 21. PANZER-DIVISION 24. PANZER-DIVISION (130.) PANZER-LEHR-DIVISION RAMIRO BUJEIRO has illustrated many Osprey titles including Warrior 23; US 3. GEBIRGS-DIVISION Afanne in Vietnam and Men- at-Arms 357: Allied Women's 5. GEBIRGS-DIVISION Service. He is an experienced commercial artist who lives and works in his native city THE TIGER TANK BATTALIONS of Buenos Aires, Argentina. His main interests are the political and military history THE PLATES of Europe in the first half of the 20th century. INDEX first published In Great Britain In 2002 by Osprey Publishing. Artist’s Note Qms Court. Chapel Way. BotJay, Oxford 0X2 9LB United Kingdom GERMAN ARMY ELITE UNITS Email] info® osprey publishing, com Readers may care to note that the original paintings from which the colour plates in this book were prepared are available for private © 2002 Osprey Publishing Ltd. sale. All reproduction copyright whatsoever is retained by the 1939-45 Publishers, All enquiries should be addressed to: All rights reserved- Apart From any fair dealing for the purpose of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright, Designs end Ramiro Sujeiro, GC 28, 1602 Florida, Argentina Patents Act, 1983. -

ABSTRACT Title of Document: the FURTHEST
ABSTRACT Title of Document: THE FURTHEST WATCH OF THE REICH: NATIONAL SOCIALISM, ETHNIC GERMANS, AND THE OCCUPATION OF THE SERBIAN BANAT, 1941-1944 Mirna Zakic, Ph.D., 2011 Directed by: Professor Jeffrey Herf, Department of History This dissertation examines the Volksdeutsche (ethnic Germans) of the Serbian Banat (northeastern Serbia) during World War II, with a focus on their collaboration with the invading Germans from the Third Reich, and their participation in the occupation of their home region. It focuses on the occupation period (April 1941-October 1944) so as to illuminate three major themes: the mutual perceptions held by ethnic and Reich Germans and how these shaped policy; the motivation behind ethnic German collaboration; and the events which drew ethnic Germans ever deeper into complicity with the Third Reich. The Banat ethnic Germans profited from a fortuitous meeting of diplomatic, military, ideological and economic reasons, which prompted the Third Reich to occupy their home region in April 1941. They played a leading role in the administration and policing of the Serbian Banat until October 1944, when the Red Army invaded the Banat. The ethnic Germans collaborated with the Nazi regime in many ways: they accepted its worldview as their own, supplied it with food, administrative services and eventually soldiers. They acted as enforcers and executors of its policies, which benefited them as perceived racial and ideological kin to Reich Germans. These policies did so at the expense of the multiethnic Banat‟s other residents, especially Jews and Serbs. In this, the Third Reich replicated general policy guidelines already implemented inside Germany and elsewhere in German-occupied Europe. -

AUTOGRAPHEN 1 BARKS, CARL, (1901-2000), US-Comic-Autor U
AUTOGRAPHEN 1 BARKS, CARL, (1901-2000), US-Comic-Autor u. Zeichner, bekanntester Disney-Zeichner, (u. a. 90 € Donald u. Dagobert Duck), Tinten OU auf s/w Foto, 24x18 cm, um 1990; Beilagen <964683F I- 2 DENTON, A. COOLEY (*1920), US-Herzchirug, 1968 erste erfolgreiche Herztransplantation, OU 20 € auf farb. Foto-AK, m. Versand-Kuvert, Houston 2012 <942071F I- 3 DISNEY, ROY, US-Zeichentrickfilmer, (1930-2009), Sohn v. Walt Disney u. Mitbegründer d. Walt 70 € Disney-Company, Tinten OU auf Farbfoto, 13x12 cm; dazu Buch „Die Disney-Story“, Ron Groover, Bln. 1992, Farbfotos, 416 S., Pappband/SU <964682F I- 4 DISNEY, WALT, US-Amerikanischer Zeichentrick-Filmer, (1901-1966), OU in weißer 300 € Pinselfarbe, auf schwarzem Karton m. Druckportrait, A 4, um 1960; dazu 2 Bücher, „Disneys Welt“, R. Schickel; „Die Welt des Walt Disney“, A. Platthaus, Bln. 2001, Fotos, Abb., ges. 558 S., Pappbde., SU <964681F I- 5 DISNEY, WALT, US-Amerikanischer Zeichentrickfilmer, (1901-1966), Tinten-OU auf 600 € Portraitfoto, Stempel „Foto Felicitas München“, um 1960, 20x15 cm; dazu 4 Führer d. Disneyland, 1957, 1958, u. 1963, sowie Heft „Vacationland-Disneyland“ 1958, m. Zertificat, alle m. zahlr. Farb- fotos <964680F I- 6 FRITSCH, THEODOR, (1852-1933), antijüdischer Verleger in Leipzig, (Hammer-Verlag), hand- 70 € schriftliche Widmung an Heinrich N. Clausen, Lpz., Weihnachten 1926, im Vorsatz d. 1. Bd. „Erinnerung einer Respektlosen“ v. Edith Gräfin Saalburg, Hammer-V. 1927, (Bd. 2 v. 1931 auch vorhanden), 1 Portr., 224 u. 272 S., gld.gepr. Ln. <944815F I- 7 FUCHS, DR. ERIKA, (1906-2005), Dt. Comic-Übersetzerin, (Micky Maus Hefte v. 1951-1988), 4 60 € Farbfotos m. -

Chronik Des Bund Deutscher Pioniere (Stand März 2019)
90 Jahre Bund Deutscher Pioniere e.V. (ehemals Waffenring Deutscher Pioniere e.V.) 1925 – 2015 mit Ergänzung bis einschl.2018 1 Herausgeber: Bund Deutscher Pioniere (BDPi) e.V. Redakteur: Oberstleutnant a.D. Norbert Scholz Archivar BDPi e.V. Ingolstadt, März 2019 2 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 5 ENTWICKLUNG DES WAFFENRINGES DEUTSCHER PIONIERE (WDPi) / BUNDES DEUTSCHER PIONIERE (BDPi) Kapitel 1 Gründung und Aufwuchs des WDPi von 1925 bis 1933 7 Kapitel 2 Der WDPi im Nationalsozialismus von 1933 bis 1938 19 Kapitel 3 Auflösung des WDPi und Neuorganisation der 31 Soldatenverbände und Kameradschaften von 1938 bis 1945 Kapitel 4 Das Verbot des WDPi nach 1945 37 Kapitel 5 Neugründung des WDPi von 1951 bis 1957 39 Kapitel 6 Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Pionieren der 51 Bundeswehr von 1958 bis 2002 Kapitel 7 Der BDPi als Nachfolgeorganisation des WDPi mit neuen Zielen 149 ab 2003 ANHANG 1. Kurzfassung der Chronik - MEILENSTEINE in der Geschichte des Waffenringes 205 Deutscher Pioniere ( WDPi) / des Bundes Deutscher Pioniere (BDPi) 2. Vorsitzende / Präsidenten 211 3. Vorstände 213 4. Vertreter des BDPi in der Region / am Standort 239 5. Ehrenpräsidenten / Ehrenvorsitzende 243 6. Ehrenmitglieder 245 7. Der WDPi / BDPi und seine Pionierkameradschaften / Firmen / Organisationen 249 a. Liste der Gründungsmitglieder (Stand Juli 1925) 253 b. Liste der bestehenden Landesverbände im Waffenring 255 Deutscher Pioniere ( Stand 1935) c. Verzeichnis der bestehenden Pionier-Vereinigungen (Stand 1952) 257 d. Entwicklung der Pionierkameradschaften/ Firmen/ Organisationen 258 ab 1952 (Stand Feb 2018) 8. Bestpreise 267 9. Historie der Satzungen 281 10. Entwicklung der Informationsorgane 299 a. Die Printmedien 299 b. Historie der Website des BDPi 305 11. -

Flüchtlinge Und Grenzverhältnisse in Vorarlberg 1938 - 1944 Einreise- Und Transitland Schweiz
Gerhard Wanner Flüchtlinge und Grenzverhältnisse in Vorarlberg 1938 - 1944 Einreise- und Transitland Schweiz Unmittelbar nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich am 12. März 1938 kam es zu einer Auswanderungsbewegung aus Österreich, um der nationalsozialistischen Verfolgung und dem Terror zu entgehen. Dabei handelte es sich um politische Vertreter und Gesinnungsfreunde des ehemaligen autoritären österreichischen Ständestaates, um Geistliche und vor allem um begüterte Juden, die ihr kommendes schreckliches Schicksal erahnten und die materiellen Mittel für eine Ausreise besaßen. In den ersten Wochen nach dem “Anschluß” reisten über 3000 Österreicher, hauptsächlich aus dem Osten des Landes, legal in der Schweiz ein. Sie waren meist mit der Eisenbahn über Vorarlberg dorthin gelangt. Daß man die Schweiz wählte, dafür gab es besonders einen Grund: Die Staaten Tschechoslowakei und Ungarn hatten Inhabern (noch) österreichischer Pässe die Einreise verwehrt, die Schweiz dagegen gestattete diese vorerst. Von dort führte der Weg der meisten nach Frankreich, England und nach Übersee. Die Auswanderung glich jedoch mehr einer Flucht als einer Ausreise. (Ludwig, 75. Moser, 188) Damals flüchtete auch ein Teil der wenigen Vorarlberger Juden in die Schweiz. (Dreier, 214) Nach der Einführung der Schweizer Visumspflicht für ehemalige österreichische Staatsbürger am 1. April 1938 hörte in den folgenden zwei Monaten die legale Ausreisetätigkeit aus Österreich fast völlig auf. (Keller, 18) Im Juli 1938 setzte eine zweite Massenflucht aus Österreich ein. Im Verlauf des Frühlings hatten Gestapo und SS eine spezielle Auswanderungsstrategie entwickelt: Sie gingen dazu über, die österreichischen Juden zum Verlassen des Staatsgebietes zu bewegen, aufzufordern oder gar zu zwingen. Schikanen, Drohungen und KZ-Verschickungen sollten dazu beitragen. Außerdem trat ein Dekret in Kraft, das Juden die Arbeit in Handel und Industrie untersagte. -

Organizacja Administracji Władz Okupacyjnych Na Ziemiach Polskich
ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom XXII, numer 3 — 2012 JACEK DZIOBEK-ROMAN ´ SKI Pamie˛ci rodziców mojego ojca: Anieli i Józefa II, którzy dnia 26 czerwca 1944 r. zgine˛li w tej straszliwej poz˙odze ORGANIZACJA ADMINISTRACJI WŁADZ OKUPACYJNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1939-1945 W wyniku przegranej wojny obronnej we wrzes´niu 1939 r. Polska utraciła swoj ˛aniezalez˙nos´c´, zas´jej terytorium zostało podzielone na dwie zasadnicze strefy wpływów, co nast ˛apiło w efekcie zarówno napas´ci Niemiec hitlerow- skich, jak i stalinowskiej Armii Czerwonej. Formalnie granice˛mie˛dzy Niem- cami hitlerowskimi a Zwi ˛azkiem Sowieckim ustalono w tajnym protokole do- datkowym do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r., w s´wietle re- gulacji którego m.in. pan´stwo polskie miało znalez´c´sie˛ w strefie wpływów zarówno Niemiec, jak i ZSRS. Granica miała zostac´ okres´lona na linii: Narew-Wisła-San 1. Celem prezentowanego krótkiego studium be˛dzie ukazanie kształtu ustro- jowego cywilnej administracji obu okupantów. Poniewaz˙ jednak sytuacja polityczna w omawianym okresie sie˛zmieniała, s´ladem zmian terytorialnych zmieniała sie˛ i administracja, co takz˙e be˛dzie w niniejszym materiale przes´ledzone. 1 E,8D,H>Z6 *@B@:>4H,:\>Z6 BD@H@8@: 8 )@(@&@DJ @ >,>"B"*,>44 <,0*J ',D<">4,6 4 E@&,HF84< E@`2@< @H 23 "&(JFH" 1939 (., [w:] )@8J<,>HZ &>,T>,6 B@:4H484 . 1940-22 4`>b 1941 , H. XXIII, ks. 2, ;@F8&" 1992, s. 321, pkt 2. 272 JACEK DZIOBEK-ROMAN ´ SKI 1. ORGANIZACJA ADMINISTRACJI CYWILNEJ NA ZIEMIACH WŁ ˛ACZONYCH DO RZESZY Od strony zmian terytorialnych wypadki potoczyły sie˛szybko, gdyz˙pierw- szym aktem prawnym zmieniaj ˛acym ustrój polityczny była ustawa Reistagu z 1 wrzes´nia 1939 r. -
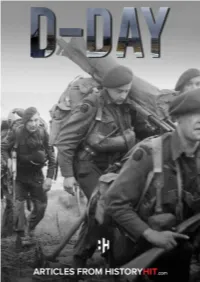
D-Day HISTORYHIT.COM
D-Day HISTORYHIT.COM 1 D-Day HISTORYHIT.COM On 6 June 1944, the Allies launched the greatest amphibious invasion in history. Codenamed “Overlord” but best known today as “D-Day”, the operation saw Allied forces landing on the beaches of Normandy in Nazi-occupied France in huge numbers. By the end of the day, the Allies had established a foothold on the French coastline. The statistics for the invasion force involved in the operation are staggering. By midnight on 6 June, 132,000 Allied forces had landed in France, while more than 2 million were eventually shipped there, comprising a total of 39 divisions. Thousands of vessels took part in the operation including 139 major warships; 221 smaller combat vessels; more than 1000 minesweepers and auxiliary vessels; 4,000 landing craft; 805 merchant ships; 59 blockships; and 300 miscellaneous small craft. Eleven thousand aircraft also took part including fighters, bombers, transports and gliders. The invasion force also had the support of around 350,000 members of the French Resistance, who launched hit-and-run attacks on German targets. From Omaha Beach to Operation Bodyguard this eBook explores D-Day and the beginning of the Battle of Normandy. Detailed articles explain key topics, edited from various History Hit resources. Included in this eBook are articles written for History Hit by some of the world’s leading World War Two historians, including Patrick Eriksson and Martin Bowman. Features written by History Hit staff past and present are also included. You can access all these articles on historyhit.com. D-Day was compiled by Tristan Hughes. -

Österreichs Bundesheer - Uniformen Und Abzeichen - Dienstgrade 16.11.12 08:04
Österreichs Bundesheer - Uniformen und Abzeichen - Dienstgrade 16.11.12 08:04 Österreichs Bundesheer Dienstgrade Das Rangverhältnis der Soldaten des Bundesheeres untereinander ist durch Dienstgrade geregelt. Diese erleichtern die Einordnung des einzelnen Soldaten in die militärische Hierarchie. Im Österreichischen Bundesheeres sind zu diesem Zweck 21 verschiedene Dienstgrade eingeführt, die sich in vier Gruppen untergliedern: In Rekruten, Chargen, Unteroffiziere und Offiziere. Rekruten Rockkragen Anzug 75 / 03 Tellerkappe Beschreibung Rang: Rekrut Abkürzung: Rekr Waffenfarbe: Jäger, Militärstreife Chargen Rockkragen Anzug 75 / 03 Tellerkappe Beschreibung Rang: Gefreiter Abkürzung: Gfr Waffenfarbe: ABC-Abwehr Rang: Korporal Abkürzung: Kpl Waffenfarbe: Jagdkommando, Heeressport Rang: Zugsführer Abkürzung: Zgf Waffenfarbe: Pioniere Unteroffiziere Rockkragen Anzug 75 / 03 Tellerkappe Beschreibung http://www.bmlv.gv.at/abzeichen/dienstgrade.shtml Seite 1 von 4 Österreichs Bundesheer - Uniformen und Abzeichen - Dienstgrade 16.11.12 08:04 Rang: Wachtmeister Abkürzung: Wm Waffenfarbe: Flieger Rang: Oberwachtmeister Abkürzung: OWm Waffenfarbe: Sanität Rang: Stabswachtmeister Abkürzung: StWm Waffenfarbe: Aufklärer Rang: Oberstabswachtmeister Abkürzung: OStWm Waffenfarbe: Garde Rang: Offiziersstellvertreter Abkürzung: OStv Waffenfarbe: Artillerie, Fliegerabwehr Rang: Vizeleutnant Abkürzung: Vzlt Waffenfarbe: Fernmelder Offiziere Rockkragen Anzug 75 / 03 Tellerkappe Beschreibung Rang: Fähnrich Abkürzung: Fhr Waffenfarbe: Theresianische Militärakademie