Landesnahverkehrsplan 2013 – 2017 Impressum
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Retrospective of Preservation Practice and the New York City Subway System
Under the Big Apple: a Retrospective of Preservation Practice and the New York City Subway System by Emma Marie Waterloo This thesis/dissertation document has been electronically approved by the following individuals: Tomlan,Michael Andrew (Chairperson) Chusid,Jeffrey M. (Minor Member) UNDER THE BIG APPLE: A RETROSPECTIVE OF PRESERVATION PRACTICE AND THE NEW YORK CITY SUBWAY SYSTEM A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts by Emma Marie Waterloo August 2010 © 2010 Emma Marie Waterloo ABSTRACT The New York City Subway system is one of the most iconic, most extensive, and most influential train networks in America. In operation for over 100 years, this engineering marvel dictated development patterns in upper Manhattan, Brooklyn, and the Bronx. The interior station designs of the different lines chronicle the changing architectural fashion of the aboveground world from the turn of the century through the 1940s. Many prominent architects have designed the stations over the years, including the earliest stations by Heins and LaFarge. However, the conversation about preservation surrounding the historic resource has only begun in earnest in the past twenty years. It is the system’s very heritage that creates its preservation controversies. After World War II, the rapid transit system suffered from several decades of neglect and deferred maintenance as ridership fell and violent crime rose. At the height of the subway’s degradation in 1979, the decision to celebrate the seventy-fifth anniversary of the opening of the subway with a local landmark designation was unusual. -

1. August 1922 1923 7. Oktober 1924 1925 1931
1. August 1922 Gründung des Fußballvereins Letschin 1922 als Abtei- lung des Männerturnvereins (gegr. 1891), erster Vorsit- zender wird Friseurmeister Martin Sprengberg. 1923 Trennung vom Männerturnverein, der Letschiner Fußball- verein 22 (LFV 22) wird eigenständig. 7. Oktober 1924 Aufruf zur Gründung eines Reitervereins in der “Zeitung für das Oderbruch” 1925 Am Gerichtsweg (Parkstraße) entsteht ein eigener Sport- platz für den LFV 22. 1931/ 32 Der LFV 22 verfügt über 2 Schüler-, 1 Jugend-, 3 Männer- Die “Gründungself” auf einem Stoppelfeld bei Prenkeberg, 1922 mannschaften und 1 Alte Herren-Elf. v.l.n.r.: Schmitchen, Wohlfeil, Mohrstedt, Geist, Sauer, Hutschinski, Bammler, Letschiner Reiter beim Training (Bild: Sammlung Hans-Joachim Kurz) Rintelmann, Striek, Schierling, Schulz, Küchler, Sprengberg 1932 (Bild: Sammlung Sportverein) Das 10jährige Bestehen wird mit einem zünftigen Sportfest begangen. 1933/1934 Auflösung des Fachamtes Fußball und Neugliederung in 16 Gaue, Gau Bran- denburg teilt sich in zwei Abteilungen auf (Berlin-Potsdam und Frankfurt (Oder)- Lausitz (Bezirksklassen). Der LFV 22 spielt in der Kreisklasse 2 (Abteilung A). 1934 Der Bezirksschornsteinfeger Erwin Elske wird Vereinsvorsitzender. 16. Januar 1942 Der Sportplatz wird durch einen Bombentreffer zerstört. Ein Feld in der So- phienthaler Straße, liebevoll “Paul-Koch-Platz” genannt, wird genutzt. 1942 – 1944 Herbert Merkel organisiert monatlich zwei Fußballspiele mit Fußballern aus dem Ort und französischen Kriegsgefangenen. 1946 Die Sportgruppe Grün-Weiß Letschin wird auf Initiative von Otto Melcher gebil- det. Auf dem Weg zu einem Spiel in Ziebingen (Cybinka) im Sternberger Land, Ostern Spielort: “Paul-Koch-Platz”, die Letschiner spielen gegen Berlin-Haselhorst 2:2 1931 (Bild: Sammlung Erich Liedtke) unentschieden, Ostern 1948 (Bild: Sammlung Sportverein) 1947/1948 Bildung der Kreisklasse „Oberbarnim-Lebus“. -
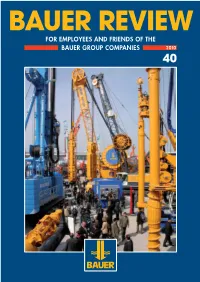
Enu1 U4 Layout 1
BAUER REVIEW FOR EMPLOYEES AND FRIENDS OF THE BAUER GROUP COMPANIES 2010 40 Contents Status report 5 20 years since reunification 6 Thomas Bauer on reunification 20 20 years of environmental technology 23 Construction in southern Germany 24 Bauma 2010 26 Equipment for customer use 28 Projects all over the world 30 Bauer Resources 38 25 years of cutter technology 40 Central Services 41 News in brief 43 In-house news ctober 3rd, 1990 culminated in a massive fireworks display and Oringing of bells throughout the country. Less than 11 months after the fall of the Berlin Wall, East and West Germany – which as a result of the Sec- ond World War had endured 40 years of separation and confrontation – were now reunited. Even before the official reunification took place, Bauer, like many companies in West Germany, had been very keen to move into the former German Demo- cratic Republic (GDR) firstly in order to expand its markets and, secondly, to assist in the transition from a planned economy to a free market economy. Twenty years on, this Review looks at how Bauer went about this undertaking, returning once again to focus on the early days of the reunification process. The story is told not so much on the basis of documents and records, but rather through the voices of the man- agers responsible for running the busi- ness at the time. Most of them are still in senior management posts today, though some have retired. Witnesses on the Schrobenhausen side who were consulted in compiling the report in- cluded Chairman of the Management Board Thomas Bauer and Heinz Kalten - ecker, as well as Wolfgang Brunner, Alexander Hofer, Josef Goller and Ernst Stümpfle. -

Märkisch Oderland LK
Für die einzelnen Vergleichsräume gelten folgende Bruttokaltmieten Unterkunft und Heizung (Nettokaltmiete + Betriebskosten): Regelbedarf (RB) in Euro % vom RB Monatliche aktuelle Kosten für WW- Aufbereitung in Euro (Obergrenze ab Angemessenheitsgrenzen für Kosten der Unterkunft in € (Bruttokaltmiete) Welche Wohnungsgröße ist angemessen? 01.01.2021) Bedarfsgemeinschaft 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. Jede 446 2,3 10,26 Die Bedarfe für die Unterkunft werden im Rahmen des (BG) mit … Personen weitere 401 2,3 9,22 Person Arbeitslosengeldes II in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen 357 2,3 8,21 erbracht, soweit sie angemessen sind. Dabei richtet sich die Vergleichsraum 1 415,50 476,45 625,60 703,80 847,00 84,70 Vergleichsraum 2 333,00 416,65 533,60 557,10 668,00 66,80 373 1,4 5,22 Frage der Angemessenheit sowohl nach den Bedarfen für Vergleichsraum 3 336,50 386,75 496,80 522,00 571,00 57,10 309 1,2 3,71 Unterkunft und Heizung als auch nach der Größe des Vergleichsraum 4 319,00 387,40 467,20 527,40 577,00 57,70 283 0,8 2,26 Wohnraumes. Vergleichsraum 5 314,00 401,05 483,20 612,00 670,00 67,00 Vergleichsraum 6 322,50 398,45 476,80 549,90 601,00 60,10 Werden die Belastungen für mein eigenes Haus übernommen? Danach werden folgende Wohnflächen als angemessene Höchstgrenzen anerkannt: Quelle: Mietwerterhebung Landkreis Märkisch-Oderland 2018 Koopmann Analytics KG/ Als Hauslasten bei Eigenheimen können einige Kosten Fortschreibung 2020 berücksichtigt werden (z.B.Grundsteuer ,Wohngebäude- Alleinstehende bis zu 50 m² versicherung,Schornstein-/Emissionsmessung, Kosten der Werden die Nebenkosten für die Mietwohnung übernommen? BG/ Haushalt mit 2 Personen bis zu 65 m² Wasserversorgung ,Kosten der Entwässerung/Abwasser, BG/ Haushalt mit 3 Personen bis zu 80 m² Ja. -

Landkreis Märkisch-Oderland Der Landrat
Landkreis Märkisch-Oderland Der Landrat Tierseuchenallgemeinverfügung zur Feststellung und Bekämpfung der Geflügelpest – H5N8 – vom 19.02.2021 Aufgrund des am 17.02.2021 amtlich festgestellten Ausbruchs der Geflügelpest im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 Geflügelpest-VO in einem Geflügelbestand des Landkreises Märkisch-Oderland wird zum Schutz der Hausgeflügelbestände vor der Einschleppung des Erregers der Geflügelpest Folgendes angeordnet: A. Festlegung von Restriktionsgebieten Um den Seuchenbestand werden als Restriktionsgebiete ein „Sperrbezirk“ von mindestens 3 km sowie um diesen ein „Beobachtungsgebiet“ festgelegt. 1. als Sperrbezirk die Städte und Gemeinden mit ihren Gemarkungen: Bliesdorf – nördlicher Teil - der Straße aus Richtung Thöringswerder folgend bis Bochows Loos, weiter Straße „Am alten Kanal“ bis Bliesdorf, weiter Dornbuschstr., Bliesdorfer Straße bis B 167, dieser nord-westlich folgend bis Mariannenhof, weiter Straße Landhof bis Landhof von dort weiter Feldwege Richtung Waldgebiet Naturschutzgebiet Biesdorfer Kehlen; Neulewin – teilweise: Heinrichsdorf nur westlich der Straße von Altwriezen nach Beauregard; Oderaue – Altmädewitz, Rüsterwerder; Altreetz (nur südlich der „Wriezener Str.“); Neumädewitz; Wriezen – Altwriezen (nur westlich der „Wriezener Str.“); Beauregard (nur westlich der Straße von Altwriezen nach Beauregard, westlich der Straße nach Thöringswerder); Eichwerder (nur westlich der Straße von Beauregard nach Thöringswerder, der L33 folgend bis westlich Straße nach Thöringswerder); Jäckelsbruch; Lüdersdorf/Biesdorf -

Ohv Pm Hvl Tf Lds Los Mol Bar Pr Opr Um Ee Osl
RE66 vbb.de Bike-Sharing-Standorte in Berlin und Stralsund Hbf RE3 RB66 Szczecin Główny Brandenburg und Berlin Szczecin Główny Berlin-Brandenburg Verkehrsverbund uar 2021 uar an im Umland sowie Fahrradverleiher J 1. ab Gültig Nechlin Tantow n 2021 2021 n io Liniennetz Regionalverkehr Route map regional railways in Brandenburg finden Sie über die RB62 Tarinformat Prenzlau Petershagen (Uckermark) VBB-Livekarte unter vbb.de/livekarte RE2 Wismar RB74 Meyenburg RE5 Neustrelitz Hbf Rostock Hbf/Stralsund Hbf Seehausen (Uckermark) Casekow Brügge (Prignitz) UM Falkenhagen Gewerbepark Prignitz Fürstenberg (Havel) Warnitz (Uckermark) Schönow (Uckermark) RB12 RB63 Pritzwalk-Hainholz* Hammelspring Templin Stadt Wilmersdorf Templin-Ahrensdorf Passow (Uckermark) RB74 Liebenthal Wittstock Rheinsberg (Mark) RB54 Dannenwalde (b Angermünde) RB73 RB74 Templin Milmersdorf Pinnow Schwedt Pritzwalk West* Pritzwalk (Prignitz) (Dosse) Vogelsang Karstädt Götschendorf (Uckermark) (Oder) Mitte RE3 RB61 Groß Pankow Lindow (Mark) Zehdenick-Neuhof Schwedt (Oder) Heiligen- Gransee Ringenwalde (b Templin) Sarnow Dossow (Prignitz) Angermünde grabe Zehdenick (Mark) Bölzke Fretzdorf Friedrichswalde (b Eberswalde) RB61 RB62 RB66 Herzberg (Mark) Bergsdorf RB63 PR Perleberg Blumenthal (Mark) Netzeband Joachimsthal Walsleben (b Neuruppin) RB27 Joachimsthal Kaiserbahnhof Chorin Rosenwinkel Löwenberg (Mark) Weisen Neuruppin West RB54 Groß Schönebeck Althüttendorf (Schorfheide) RE2 RE6 Wutike Neuruppin Rheinsberger Tor Golzow (b Eberswalde) Grüneberg Klandorf Wittenberge OPR Wustrau-Radensleben -

External Locations of Modern Railway Stations – a Departure from Sustainable Mobility?
Systemy transportowe Jacek Wesołowski External locations of modern railway stations – a departure from sustainable mobility? Will people come to the railway regardless of station location or in 1894. Rotterdam was a rare example of a long cross-city line should rather the railway come to where people are? The pursue for built on iron viaduct (1877; line relocated underground in 1993). central locations for stations was probably the most characteristic The long lasting ‘battle’ of railways with authorities of Paris, won feature of Victorian railways urging them to cover huge costs of in- by the latter, is particularly emblematic. Mainline railways have ner city lots and approaches. It has been often stressed the station to wait till the 1970s to gain access directly to the heart of the has changed it character becoming far more than the pure trans- city which materialised in a limited form as a big suburban hub at port node. The evolution towards a retail and service centre was Châtelet-les-Halles. In the last decades of the 19th century even possible thanks to its inner city location [1]. Recent developments a reverse tendency was born, to whom good excuse were the in some countries with most advanced railway systems show that need for large areas for central stations and the need to free the modern stations are often neither central nor even easily accessible. cities from any physical constraints for expansion. Truncation of The time gained on quick train travel and lack of check in times is inner parts of railways approaching Frankfurt am Main in order then lost by most customers on long access travels. -
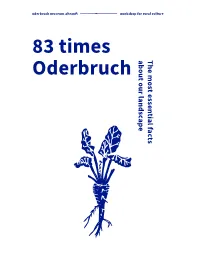
83 Times Oderbruch the Mo
oderbruch museum altranft workshop for rural culture 83 times about our landscape essential facts The most Oderbruch oderbruch museum altranft workshop for rural culture Oderbruch Museum Altranft 1st edition Programme Office Dezember 2020 Schneiderstraße 18 16259 Bad Freienwalde OT Altranft Layout Fine Heininger | Denken & Handeln 0 33 44 — 155 39 01 [email protected] We do not accept any liability for the accuracy of the contents of this brochure. oderbruchmuseum.de #oderbruchmuseum Printing /oderbruchmuseum Druckzone Cottbus Funded by: TRAFO — Models for Culture in Transformation In close cooperation with partners on location, TRAFO aims to develop concepts for transforming existing cultural organisations in selected model regions. Supported by: 83 times about our landscape essential facts The most Oderbruch Published by Oderbruch Museum Altranft CONTENT 7 About this booklet 8 Water 16 Agriculture 20 Crafts 26 Building culture 30 People ABOUT THIS BOOKLET About this booklet The following short texts originate from our annual topics of 2016 — 2020. We do not raise any claims on their absolute, let alone everlasting, significan- ce. They are an attempt to summarise the results of our research and surveys in the Oderbruch, which have yielded a fairly precise characterisation of the landscape, its residents and its cultural, geographical and economic distincti- ons as well as the changes it has undergone. Because of the interviews conduc- ted by varying teams of researchers, including Kenneth Anders, Lars Fischer, Georg Weichardt, Tobias Hartmann, Pamela Kaethner, Katja Lehnert, Almut 9 Undisz and Tina Veihelmann, a total of some 150 people have eventually con- tributed to these results. As we have come to see them as quite substanciated, we would like to present them here for you to take away. -

Schulentwicklungsplan 2017/18 Bis 2021/22
Landkreis Märkisch- Oderland Schulentwicklungsplanung 5. Fortschreibung 2017/18 bis 2021/22 Impressum Herausgeber: Landkreis Märkisch-Oderland Fachbereich II Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt Puschkinplatz 12 15306 Seelow Verantwortlich: Herr Seyfarth Amtsleiter Schulverwaltungs-, Kultur und Sportamt Frau Haake Fachdienstleiterin Schulverwaltung, Elterngeld und BuT Druck: Eigendruck Auflage: 50 Seelow, Dezember 2017 Schulentwicklungsplan des Landkreises Märkisch-Oderland 2017/18-2021/22 Seite 1 I Inhalt II Vorwort .......................................................................................... 6 III Abschnitt – Analysen, Prognosen, Ergebnisse ...................................... 7 1. Grundlagen ..................................................................................... 7 1.1. Strukturdaten des Landkreises Märkisch-Oderland .......................... 7 1.2. Gesetzliche Grundlage ................................................................ 9 1.3. Schulstruktur im Landkreis Märkisch-Oderland ............................... 9 1.4. Schulplanungsbereiche............................................................... 12 1.5. Bevölkerungsentwicklung und Schüleraufkommen ......................... 14 1.6. Anforderungen an einen geordneten Schulbetrieb .......................... 26 1.7. Struktur- und Übergangsquoten .................................................. 28 1.8. Entwicklung der Schülerzahlen für den gesamten Landkreis Märkisch- Oderland ........................................................................................... -

Optimierungsbedarf an Stationen Mit Unter 50 Ein- Und Aussteigern Pro Tag
Abb. 5.2: Optimierungsbedarf an Stationen mit unter 50 Ein- und Aussteigern pro Tag 80 VERKEHRSINFRASTRUKTUR bare Bahnsteiglängen von mindestens 60 m bis maximal 170 m gebaut. Das Land Brandenburg prüft den Einsatz von Doppelstockwendezügen mit sechs Wagen neben dem RE 1 [Magdeburg Pots- dam – Frankfurt (Oder)] auch für den RE 5 (Elsterwerda – Rostock) in den Sommermo- naten sowie den Einsatz von Doppelstock- wendezügen mit fünf Wagen für den RE 3 (Lutherstadt Wittenberg – Angermünde – Stralsund), um dem Verkehrsbedürfnis auf diesen Verbindungen Rechnung zu tragen. Die notwendigen Bahnsteiglängen sind an diesen Strecken bei neuen Anlagen zu be- rücksichtigen. Bild 5.4: Neue Bahnsteiganlage Bahnhof Prenzlau Auf den übrigen Strecken mit elektrischem Regionalexpressverkehr (RE 2, RE 4, RE 7, RE 11, RE 15 und RE 18) sind grundsätzlich Bahnsteiglängen für Doppelstockwendezü- ge mit vier Einzelwagen plus Lokomotive zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die nicht elektrifizierte Ostbahn (RB 26). Auf dem die- selbetriebenen RE 6 (PrignitzExpress) sind die bisher realisierten Bahnsteiglängen mit 100 m Nutzlänge ausreichend. Mit dieser Bahnsteiglänge ist auch für die Regionalbah- nen RB 12, 33, 35, 36, 46, 51, 54, 65 und 66 zu planen, während für die Regionalbahnen 25, 27, 60 und 63 Bahnsteiglängen von 85 m ausreichen. Die im LNVP enthaltenen Angaben zu Bahn- steiglängen und -höhen berücksichtigen nur die aus dem SPNV erwachsenden Anforde- rungen. VERKEHRSINFRASTRUKTUR 81 Abb. 5.3: Ausbaustand der Bahnsteige 82 VERKEHRSINFRASTRUKTUR Abb. 5.4: Konzept Bahnsteighöhen und -längen VERKEHRSINFRASTRUKTUR 83 6. Zielkonzepte 6.1 Weiterentwicklung des integrierten träger des üÖPNV gemeinsam mit dem Verkehrssystems Aufgabenträger des SPNV zu erstellen. • VBB Die im LNVP 2008 – 2012 begonnenen Po- Im Auftrag der Länder Berlin und Branden- tenzialanalysen für einzelne Linien als Kor- burg bestellt der VBB den Regional- und ridoruntersuchung haben sich bewährt und den S-Bahnverkehr. -

Amtsblatt Für Die Stadt Bad Freienwalde (Oder)
Amtsblatt für die Stadt Bad Freienwalde (Oder) 8. Jahrgang Bad Freienwalde (Oder), den 08.11.2016 Nr. 8 Seite I. Amtlicher Teil 1. Beschlussregister der 21. Sitzung der 6. Stadtverordnetenversamm- 2 – 4 lung vom 20.10.2016 II. Nichtamtlicher Teil 1. Informationen aus dem Rathaus 5 – 7 - Bericht des Bürgermeisters, Stadtverordnetenversammlung am 20.10.2016 2. Sitzungstermine November / Dezember 2016 8 3. Pressemitteilungen des LK MOL 9 – 10 - Haus- und Straßensammlung – Volksbund Deutsche Kriegsgräber- fürsorge e.V. im November 2016 - Präsentation des Jahrbuches Märkisch – Oderland 2017 4. Hilferuf vom Oderbruchzoo 11 5. Elternbriefe Brandenburg, Elternbrief Nr. 40: 6 ½ Jahre: Kinder vor 12 – 13 sexuellem Missbrauch schützen 6. Pressemitteilung des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 14 Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 7. Hinweise auf Veranstaltungen 15 – 16 Impressum 16 2 Bad Freienwalde (Oder), den 08.11.2016 Amtsblatt der Stadt Bad Freienwalde (Oder) Nr. 8 I Amtlicher Teil BESCHLUSSREGISTER über die gefassten Beschlüsse der 21. Sitzung der 6. Stadtverordnetenversammlung vom 20.10.2016 A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 109/2016 Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Planungsleistungen zum Bau- vorhaben: Ersatzneubau Feuerwehrdepot und Rettungsdienst am Standort Wriezener Straße Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Vergabe der Planungsleistungen für den Rückbau und Neubau des Feuerwehrdepots und des Rettungsdienstes in Höhe von 716.000,00 € zzgl. USt als Pauschalangebot für die Leistungsphasen 1-9 an das Büro Stadtwerkstatt Teupitz, Lindenstr. 1, 15755 Teupitz. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Finanzierung im Haushalt 2017 sicher zu stellen. Abstimmungsergebnis: 18 Stimmen dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 111/2016 Beratung und Beschlussfassung über die Prioritätenliste der Investitionsmaß- nahmen der Stadt Bad Freienwalde (Oder) ab 2016 Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Prioritätenliste der Investitionsmaßnah- men der Stadt Bad Freienwalde (Oder) – Stand 25.8.2016 – als Grundlage für die Haus- haltsplanung ab 2016. -

Nummer 04 Wriezen, Den 02.04.2012 12. Jahrgang Bürgersprechstunde
Nummer 04 Wriezen, den 02.04.2012 12. Jahrgang Inhaltsverzeichnis BbgKVerf ausgeschlossen: 0 Abstimmungsergebnis: Dafür: 12, Dage- Amtlicher Teil gen: 0, Enthaltung: 0 • Bekanntmachung der Beschlüsse der Beschluss Nr: GV Ntr/20120223/Ö13 Gemeindevertretung der Gemeinde Neutrebbin vom 26.01.2012 ................... S. 1 Beschluss: • Bekanntmachung der Beschlüsse Amt Barnim-Oderbruch Die Gemeindevertretung Neutrebbin der Gemeindevertretung der befürwortet den beiliegenden Entwurf Gemeinde Neutrebbin vom 23.02.2012 ...... S. 1 Gemeinde Neutrebbin der Verwaltungsvereinbarung zwischen • 5. Änderung des Flächennutzungs- BEKANNTMACHUNG planes (FNP) mit integriertem dem Landkreis Märkisch-Oderland und Landschaftplan der Gemeinde Die Gemeindevertretung Neutrebbin hat der Gemeinde Neutrebbin zum Bau der Neutrebbin, OT Alttrebbin ................ S. 1 + 2 auf ihrer Sitzung am 26.01.2012 auf Grund Kreisstraße K 6408, Straßenabschnitt L • Bekanntmachung der Beschlüsse der 43 – Horst – Wuschewier – Sietzing. Gemeindevertretung der Gemeinde des § 3 der Kommunalverfassung nachfol- Neutrebbin vom 26.01.2012 ................... S. 3 genden Beschluss gefasst: Der Amtsdirektor wird beauftragt die Ver- tragsunterzeichnung vorzunehmen. • Vorhabenbezogener Bebauungsplan Vorlage Nr.: S-BOA/856/12-03 Nr. 6 „Solarpark Alttrebbin III“ ................. S. 3 Beschlussfähigkeit: Beschluss-Nr.: GVNtr./20120126/Ö18 • Bekanntmachung der Beschlüsse der Mitglieder: 13, davon anwesend: 12, davon Gemeindevertretung der Gemeinde Die Gemeindevertretung Neutrebbin be- Oderaue