Vertiefende Wanderungsanalyse in Der Ostregion
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aufteilung Gemeinden Niederösterreich
Gemeinde Förderbetrag Krems an der Donau 499.005 St. Pölten 1.192.215 Waidhofen an der Ybbs 232.626 Wiener Neustadt 898.459 Allhartsberg 38.965 Amstetten 480.555 Ardagger 64.011 Aschbach-Markt 69.268 Behamberg 60.494 Biberbach 41.613 Ennsdorf 54.996 Ernsthofen 39.780 Ertl 23.342 Euratsfeld 48.110 Ferschnitz 31.765 Haag 101.903 Haidershofen 66.584 Hollenstein an der Ybbs 31.061 Kematen an der Ybbs 47.906 Neuhofen an der Ybbs 53.959 Neustadtl an der Donau 39.761 Oed-Oehling 35.097 Opponitz 18.048 St. Georgen am Reith 10.958 St. Georgen am Ybbsfelde 51.812 St. Pantaleon-Erla 47.703 St. Peter in der Au 94.276 St. Valentin 171.373 Seitenstetten 61.882 Sonntagberg 71.063 Strengberg 37.540 Viehdorf 25.230 Wallsee-Sindelburg 40.446 Weistrach 40.557 Winklarn 29.488 Wolfsbach 36.226 Ybbsitz 64.862 Zeillern 33.838 Alland 47.740 Altenmarkt an der Triesting 41.057 Bad Vöslau 219.013 Baden 525.579 Berndorf 167.262 Ebreichsdorf 199.686 Enzesfeld-Lindabrunn 78.579 Furth an der Triesting 15.660 Günselsdorf 32.320 Heiligenkreuz 28.766 Hernstein 28.192 Hirtenberg 47.036 Klausen-Leopoldsdorf 30.525 Kottingbrunn 137.092 Leobersdorf 91.055 Mitterndorf an der Fischa 45.259 Oberwaltersdorf 79.449 Pfaffstätten 64.825 Pottendorf 125.152 Pottenstein 54.330 Reisenberg 30.525 Schönau an der Triesting 38.799 Seibersdorf 26.619 Sooß 19.511 Tattendorf 26.674 Teesdorf 32.727 Traiskirchen 392.653 Trumau 67.509 Weissenbach an der Triesting 32.005 Blumau-Neurißhof 33.690 Au am Leithaberge 17.474 Bad Deutsch-Altenburg 29.599 Berg 15.938 Bruck an der Leitha 145.163 Enzersdorf an der Fischa 57.236 Göttlesbrunn-Arbesthal 25.915 Götzendorf an der Leitha 39.040 Hainburg a.d. -

NÖ Gemeindeverbändeverordnung Seuchenvorsorgeabgabe (NÖ GVS)
NÖ Gemeindeverbändeverordnung Seuchenvorsorgeabgabe (NÖ GVS) 3620/1–0 Stammverordung 123/05 2005-12-30 Blatt 1-6 3620/1–1 1. Novelle 17/06 2006-02-27 Blatt 1, 2 3620/1–7 3620/1–2 2. Novelle 92/06 2006-10-25 Blatt 1 3620/1–3 3. Novelle 132/11 2011-12-29 Blatt 2, 3 3620/1–4 4. Novelle 54/12 2012-06-25 Blatt 2 3620/1–5 5. Novelle 144/12 2012-12-28 Blatt 2 3620/1–6 6. Novelle 14/13 2013-03-08 Blatt 2 3620/1–7 7. Novelle 147/13 2013-12-20 Blatt 1, 2 0 Ausgegeben am Jahrgang 2013 20. Dezember 2013 147. Stück Die NÖ Landesregierung hat am 26. November 2013 auf Grund des § 9 Abs. 4 des NÖ Seuchenvorsorgeabgabe- gesetzes, LGBl. 3620–2, sowie der §§ 23 und 24 des NÖ Gemeindeverbandsgesetzes, LGBl. 1600–5, ver- ordnet: Änderung der NÖ Gemeindeverbändeverordnung Seuchenvorsorgeabgabe (NÖ GVS) 3620/1–7 Artikel I Die NÖ Gemeindeverbändeverordnung Seuchenvor- sorgeabgabe, LGBl. 3620/1, wird wie folgt geändert: 1. Im § 1 Z. 1 entfällt die Wortfolge “und der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs”. 2. Im § 1 Z. 8 wird nach dem Wort “Aggsbach,” die Wort- folge “Albrechtsberg an der Großen Krems,” einge- fügt. 3. Im § 1 Z. 8 wird nach dem Wort “Lengenfeld,” die Wortfolge “Lichtenau im Waldviertel,” eingefügt. Artikel II Artikel I tritt am 1. Jänner 2014 in Kraft. Niederösterreichische Landesregierung: Pernkopf Landesrat 0 1. Abschnitt Gemeindeverbände §1 Name, Sitz, beteiligte Gemeinden Es werden folgende Gemeindeverbände gebildet: 1. “Gemeindeverband zur Einhebung der Seuchenvor- sorgeabgabe in der Region Amstetten” (GVS Amstet- ten) mit dem Sitz in Oed-Oehling, bestehend aus den Gemeinden Allhartsberg, Amstet- ten, Ardagger, Aschbach-Markt, Behamberg, Biber- 3620/1–7 bach, Ennsdorf, Ernsthofen, Ertl, Euratsfeld, Ferschnitz, Haag, Haidershofen, Hollenstein a. -

NÖ Statistisches Handbuch 2017
NÖ Landesstatistik Statistisches Handbuch Eine Servicestelle des Landes Niederösterreich des Landes Niederösterreich 41 Auskunfts- und Servicestelle Informationen nach Verfügbarkeit für alle Interessierten 41. Jahrgang 2017 Projektarbeit Beratung, Mitarbeit und Durchführung Datenauswertung Auf Anfrage und projektbezogen Statistische Erhebungen Im Interesse des Landes Niederösterreich Kontakt Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik – Statistik Landhausplatz 1 3109 St. Pölten E-Mail: [email protected] Tel.: 02742 9005-14241 2 1 5 NÖ Statistisches Handbuch 2017 Statistisches Handbuch des Landes Niederösterreich 41. Jahrgang 2017 1| 215 2 Bezirkstabellen und -grafiken ohne Wien-Umgebung beziehen sich auf den ab 1. 1. 2017 gültigen Gebietsstand (LGBl. Nr. 4/2016), jene mit Werten für Wien-Umgebung auf den bis 31. 12. 2016 gültigen. Datenstände vor 2017 wurden nach Möglichkeit umgerechnet, Sonderfälle sind gekennzeichnet. Falls nicht ausdrücklich anders angegeben, beziehen sich die Tabellen in diesem Handbuch ausschließlich auf das Bundesland Niederösterreich. Die enthaltenen Daten, Tabellen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Trotz sorgfältiger Prüfung des Inhalts kann für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Qualität der in dieser Publikation enthaltenen Informationen keine Gewähr übernommen werden. NÖ Schriften 215 – Information Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Markus Hemetsberger Abteilung Raumordung und Regionalpolitik – Statistik Datenkonvertierung: Laudenbach, 1070 Wien Druck: Druckerei Haider Manuel e. U., 4274 Schönau i. M. Erschienen im Oktober 2017 ISBN 978-3-85006-215-2 3 Vorwort Dynamische Entwicklung und Mut zu Innovation sind zwei wesentliche Eck- pfeiler einer erfolgreichen Landesentwicklung. Um diesen Erfolg auch stetig weiterführen zu können, braucht es eine Art Kontrollinstanz, die in regelmäßigen Abständen die Entwicklung des Bundeslandes aus unterschiedlichen Blick- winkeln beleuchtet. -

Ausflugsziele Radfreundliche Gastbetriebe
© dphoto.at © weinfranz.at© © Bischofreiter © © schwarz-koenig© © GH Kerschbaumer AUSFLUGSZIELE > TIPPS ENTLANG DER RADROUTEN RADFREUNDLICHE schwarz-koenig.at© GASTBETRIEBE YBBSTALRADWEG ÖTSCHERLAND- RADROUTE AN YBBSTALRADWEG, ÖTSCHERLAND- 1 2 3 4 5 6 © eisenstrasse.info© UND MERIDIAN-RADROUTE Babenbergerhof Hotel Exel Gasthaus Kerschbaumer Schlosswirt Hotel Das Schloss an der Frühstückspension © Waidhofen a/d Ybbs Eisenstrasse**** Haus Hoher Markt © weinfranz.at© Viele Gastgeber entlang der Radrouten – vom Café bis zu gemütlichen Direkt am Donauradweg gelegen, Idealer Ausgangspunkt für Aus- Milchprodukte von regionalen Wunderschöner Gastgarten im Erleben Sie die einzigartige Ruhige, moderne Zimmer, Ybbstalradweg, Ötscherland- & Meridian-Radroute © Ernst Miglbauer Landgasthöfen und Hotels – haben sich besonders auf radelnde saisonale Küche, familiäre Atmos- flüge im gesamten Most viertel, Bauern, Obst und Gemüse aus Innenhof von Schloss Rothschild, Atmosphäre am Felsen der teilweise mit Balkon, Terrasse Gäste eingestellt. Sie bieten spezielle phäre, gemütliche Blumenterrasse. Wellnessbereich, à la carte dem eigenen Garten, selbst- saisonale und regionale Speziali- Ybbs mit Blick auf die Altstadt mit Ausblick über die Dächer 6 Schloss Rothschild, 9 Bikepark Königsberg, geprüfte Services, zum Beispiel einen ZEICHENERKLÄRUNG Neu ab Juli 2019: Donau Lodge Restaurant, regionale Küche, gemachtes Eis, Kerschbaumer- täten, Kulinarik- und Kulturveran- Waidhofens. der Stadt, Lift Waidhofen an der Ybbs Hollenstein an der Ybbs sicheren Abstellplatz fürs Fahrrad, Essen – moderne Zimmer mit Balkon mediterrane Terrasse Radtrikots sind erhältlich staltungen, 1 Gabel bei Falstaff 1 Straußenhof Ebner, Reparatur-Sets sowie Informationen Waidhofen an der Ybbs Als weltweit erster Bike- Betten und Donaublick, Frühstückscafé Winklarn trägt den Beinamen „Stadt park setzen die Königs- 12 Haubiversum, rund um die Radwege. Erkennbar Boutique mit Produkten sind die Gastgeber an der grünen Gastgarten/Terrasse der Türme“. -
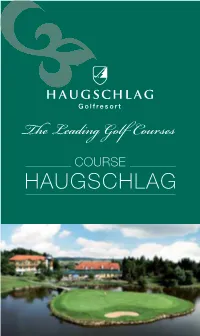
Birdiebook Course Haugschlag
COURSE HAUGSCHLAG Spitzensport – die starke Seite des Golfresort Haugschlag • 3 x Gastgeber der Austrian Open im Rahmen der PGA European Tour • 2 x Gastgeber der internationalen EPD Tour • 4 x Ausrichter der internationalen Alps Tour • 3 x Ausrichter der internationalen Pilsner Urquell Tour • Ausrichter zahlreicher österreichischer Meisterschaften Liebe Golferinnen und Golfer, Mit der Vereinsgründung des GC Waldviertel im Jahre 1987 kann das Golfresort Haugschlag heute auf eine sehr erfolgreiche und beachtliche Geschichte zurückblicken. Die mehrmalige Austra- gung von Großveranstaltungen, wie den Austrian Open im Rah- men der PGA European Tour, sowie unsere jahrelange Erfahrung im Golfsport garantieren eine Platzqualität und einen Spielkomfort erster Klasse. Neben der einzigartigen landschaftlichen Kulisse des Waldviertels schätzen unsere Gäste die besondere Gastfreundschaft unseres Golfhotels. Uns liegt es am Herzen, Sie bestmöglich mit unserem Service zu verwöhnen und Ihr Spiel so aufregend wie nur möglich zu gestalten. Ich freue mich sehr, Sie in unserem Hause begrüßen zu dürfen, und wünsche Ihnen ein schönes Spiel. Dear golfer, Since the foundation of the GC Waldviertel in 1987, the Golfresort Haugschlag can look back on a very successful and respectable history. The repeated organisation of various major events, like the Austrian Open in line with the PGA European Tour, as well as the long-lasting golf experience guarantee highest quality in our greenkeeping and secures best comfort on our fairways. Along the unique and impressive landscape of the Waldviertel, our guests appreciate the specific hospitality of our Golf Hotel. Spoil- ing you at the best with our service and turning your rounds of golf into a unique experience is close to our staff’s heart. -

Alphabetisches Register - Blaue Mappen 1
Alphabetisches Register - blaue Mappen 1 Stand: 31.12.2014 Titel Stück Zahl 15a B-VG -- Vereinbarung gemäß Art. über den Ausbau der ganztägigen 011/12 0831-0 Schulformen 15a B-VG -- Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß 079/08 0825-0 Art. über das Verwaltungs- und Kontrollsystem in Österreich für die EU- Strukturfonds in der Periode 2007-2013 15a B-VG -- Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß 126/12 0826-1 Art. über die gemeinsame Förderung der 24-Stunden-Betreuung 15a B-VG -- Vereinbarung zwischen den Ländern gemäß Art. über die 002/09 6301-0 Errichtung einer gemeinsamen Sachverständigenkommission in Tierzuchtangelegenheiten (Tierzuchtrat) 1 Alphabetisches Register - blaue Mappen A Stand: 31.12.2014 Titel Stück Zahl Abfallbehandlungsanlage -- Seebenstein 041/89 8240/2-0 Abfallstoffe -- Ablagerungsverbot Donau 110/77 6950/10-0 Abfallwirtschaftsgesetz 1992 -- NÖ 131/13 8240-6 Abgabenbehördenorganisationsgesetz 2009 -- NÖ 069/13 3400-1 Abgabeneinhebung -- Verwaltungsgemeinschaft Eggenburg 040/73 1610/2-0 Ablagerungsverbot -- Abfallstoffe Donau 110/77 6950/10-0 Absdorf-Hippersdorf -- Verwaltungsgemeinschaft 196/74 1610/9-0 Wasserversorgungsanlage Abwasserbeseitigung -- Verwaltungsgemeinschaft Ravelsbach-Maissau 102/76 1610/13-0 Abwehr des Rauschbrandes -- Verordnung über Maßnahmen zur der 050/90 6400/24-2 Rinder Achau -- Wappen Gemeindefarben 104/93 1212/41-0 Aderklaa -- Kundmachung über die Verleihung eines Gemeindewappens 047/09 1213/22-0 und die Genehmigung der Gemeindefarben für die Gemeinde Aggsbach -- Wappen -

Masterarbeit
MASTERARBEIT Titel der Masterarbeit Können anthropogen beeinflusste Rutschungen durch Gefahrenhinweiskarten abgedeckt werden? Quantitative Validierung der Gefahrenhinweiskarte für Rutschungen mittels rezenter Ereignisse in Westniederösterreich Verfasserin Karin Alexandra Gokesch, BSc angestrebter akademischer Grad Master of Science (MSc) Wien, 2015 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 066 855 Studienrichtung lt. Studienblatt: Masterstudium Geographie Betreuer: Univ.-Prof. Dipl.-Geogr. Dr. Thomas Glade Mathematical analysis and computer modelling are revealing to us that the shapes and processes we encounter in nature in their seemingly magical complexity can be described by the interaction of mathematical processes that are, if anything, even more magical in their simplicity. (Douglas Adams, 1952-2001) Eidesstattliche Erklärung Hiermit versichere ich, dass die ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubter Hilfe bedient habe, dass ich dieses Masterarbeitsthema bisher weder im In- noch im Ausland in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe und dass diese Arbeit mit der vom Begutachter beurteilten Arbeit vollständig übereinstimmt. Wien, 03. März 2015 Karin Gokesch Danksagung An dieser Stelle möchte ich allen Personen, die mich bei der Erstellung dieser Arbeit unterstützt und mir tatkräftig zu Seite gestanden haben, meinen herzlichsten Dank aussprechen. Allen voran möchte ich meinem Betreuer Univ.-Prof. Dipl.-Geogr. Dr. Thomas Glade besonderen Dank für die jahrelange Unterstützung und die Motivation in diesem Forschungsfeld zu arbeiten aussprechen. Ein großer Dank gilt Herrn Mag. Dr. Joachim Schweigl und Herrn Dipl. Ing. Michael Bertagnoli der Abteilung Allgemeiner Baudienst – Geologischer Dienst des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung für die Bereitstellung zahlreicher Informationen zu den gemeldeten Schäden und Ereignissen. -

Einladung Einladung
Zugestellt durch Post.at Nr.431/15.05.2007 Franz Woltron als neuer GR angelobt Hannes Woltron neuer Vizebürgermeister von Würflach Nach dem Ausscheiden von Vizebgm. Robert Pürzl wurde Umbesetzung im Gemeinderat notwendig Nachdem der bisherige Vizebürgermeister Robert Pürzl sein Amt mit 30. April 2007 zurückgelegt hat, wurde ein Platz im Gemeinderat frei. Bei der Gemeinderatssitzung am 10. Mai d.J. wurde Hr. Franz Woltron zu Beginn als neuer Gemeinderat angelobt und in Folge in einer geheimen Wahl zum Geschäftsführenden Gemeinderat gewählt. Der bisherige GGR Hannes Woltron wurde ebenfalls in einer geheimen Wahl zum Vizebürgermeister gewählt. Beide versprachen ihr Amt nach besten Wissen und Gewissen auszuüben. Foto (v.l.n.r.): GGR Franz Woltron und Vizebgm. Johann Woltron Einladung zum 70. Geburtstag unseres Hw. Herrn Pfarrers P. Gottfried Eder O’Cist am Sonntag, den 20. Mai 2007 um 9:00 Uhr Festmesse in der Pfarrkirche anschl. Festakt und Agape im Pfarrstadl Der Pfarrgemeinderat INFOS Gemeindeamt: Parteienverkehr: Kindergarten I: Willendorfer Straße 150 Montag - Mittwoch 10:00 bis 12:00 Tel: 02620 / 2410 - 15 2732 Würflach Donnerstag: 10:00 bis 12:00 Kindergarten II: Tel: 02620 / 2410 15:00 bis 18:00 Tel: 02620 / 2430 Fax: 02620 / 2410 - 20 Gemeindebücherei: e-mail: [email protected] Donnerstag: 17:00 bis 19:00 Wellness Welt: web: www.wuerflach.at und jeden letzten Samstag im Monat von Tel: 02620 / 2411 10:00 bis 12:00 Gemeindemitteilung - 2 - 15.05.2007 Würflach Vorwort / Editorial Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Jugend! Mandatsrücklegung / Robert Pürzl Nachdem Hr. Vizebürgermeister Robert Pürzl sein Gemeinderatsmandat aus privaten und beruflichen Gründen zurückgelegt hat, wurde eine Ergänzungswahl notwendig. -

Download/Pdf/1633587?Originalfilename=True
DIPLOMARBEIT / DIPLOMA THESIS Titel der Diplomarbeit / Title of the Diploma Thesis „Ökonomische, demographische und soziale Auswirkungen von Zweitwohnsitzen, dargestellt am Beispiel ausgewählter niederösterreichischer Tourismusgemeinden“ verfasst von / submitted by Caroline Schnabel angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Magistra der Naturwissenschaften (Mag. rer. nat.) Wien, 2018/ Vienna, 2018 Studienkennzahl lt. Studienblatt / degree programme code as it appears on the student record sheet: A 190 482 456 Studienrichtung lt. Studienblatt / Lehramtsstudium degree programme as it appears on UF Bewegung und Sport the student record sheet: UF Geographie und Wirtschaftskunde Betreut von / Supervisor: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Christian Vielhaber I Erklärung Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig verfasst, andere als die angegebe- nen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient habe, dass ich dieses Diplomarbeitsthema bisher weder im In- noch im Ausland in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe und dass diese Arbeit mit der vom Begutachter beurteilten Arbeit vollständig übereinstimmt. Wien, Mai 2018 II III Danksagung Zuerst möchte ich mich bei meinem Diplomarbeitsbetreuer Herrn ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Christian Vielhaber bedanken. Er hat mir mit seiner schnellen Hilfe und seinen Anregungen sehr geholfen, die Arbeit zu einem Abschluss zu bringen. Besonderer Dank gilt auch Herrn Univ.-Doz. Dr. Peter Jordan, der die erste Korrektur der Arbeit vorgenommen hat. Seine Ratschläge haben mir Orientierung in der weiteren Behandlung des Themas gegeben. Ich möchte mich darüber hinaus auch bei den Menschen bedanken, die mich auf meinem Weg begleitet haben. Insbesondere meine Eltern, Gerhard und Sigrid, und meine Brüder, Georg und Clemens, sind immer an meiner Seite gestanden. -

DRUIDENWEG YSPERKLAMM Tour
Fischereimöglichkeit. samt Charme 551 m/820 m m/820 551 Punkt: Tiefster/Höchster Das alles erwartet Sie im Hallenbad Yspertal. Hallenbad im Sie erwartet alles Das Erwachsenen. Erwachsenen. Am Campus 1, 3683 Yspertal 3683 1, Campus Am www.hluwyspertal.ac.at DICH Römische Wärmekammer, Solarium und eine separate Saunawelt für die die für Saunawelt separate eine und Solarium Wärmekammer, Römische (teilweise anspruchsvolle Stufen, Stege) Stufen, anspruchsvolle (teilweise Ein frei zugänglicher Naturbadeteich mit Waldviertler Waldviertler mit Naturbadeteich zugänglicher frei Ein Die Umwelt braucht Umwelt Die 32 Grad warmes Wasser, eine Wasserrutsche für die Kinder, Dampfbad, Dampfbad, Kinder, die für Wasserrutsche eine Wasser, warmes Grad 32 Waldweg Streckencharakteristik: Puschacherteich zukunftsorientierten Ausbildung zukunftsorientierten Gehzeit: 1,5 – 2 Stunden 2 – 1,5 Gehzeit: Die Privatschule, mit der mit Privatschule, Die www.hallenbad-yspertal.at 4 km (Auf- und Abstieg); und (Auf- km 4 Streckenlänge: Ausbildungszentrums. Sauna Umwelt und Wirtschaft und Umwelt für für e. 41 473 74 / 15 74 0 Tel.: Gasthaus Forellenhof, Eingang zur Klamm zur Eingang Forellenhof, Gasthaus Ausgangspunkt: 3683 Yspertal 3683 Höhere Lehranstalt Höhere Austoben, Tennis- und Beachvolleyballplätzen – südlich des des südlich – Beachvolleyballplätzen und Tennis- Austoben, Ysperklamm Tour Badgasse 3 Badgasse Landschaftsteich zum Entspannen und Spielgeräten zum zum Spielgeräten und Entspannen zum Landschaftsteich Ein attraktiver Treffpunkt für Spiel, Spaß und Bewegung, mit mit Bewegung, und Spaß Spiel, für Treffpunkt attraktiver Ein Wir empfehlen Wanderschuhe mit rutschfester Sohle! rutschfester mit Wanderschuhe empfehlen Wir www.hallenbad-yspertal.at www.prannleithen.at Generationenpark [email protected] [email protected] rung und der Lichtverhältnisse. der und rung Tel.: +43 7415 7473 7415 +43 Tel.: Tel.: +43 680 302 27 88 27 302 680 +43 Tel.: - Wasserfüh der Jahreszeiten, der Wechselspiel im - Klamm biente erleben. -

Niederösterreich Landesübersicht
Haugschlag AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG Reingers Tschechien Litschau Waldkirchen an der Thaya Kautzen Eisgarn Eggern Dobersberg Karlstein an Gastern der Thaya Heidenreichstein Pfaffen- Raabs Brand- Thaya schlag bei an der Nagelberg Amalien- Drosendorf- Waidhofen Thaya Zissersdorf NIEDERÖSTERREICH dorf- Aalfang a.d.Thaya Hardegg Langau WAIDHOFEN Waidhofen an LANDESÜBERSICHT AN DER der Thaya-Land Schrems THAYA Dietmanns Japons Geras Groß-Siegharts Ludweis- Aigen Hoheneich Windigsteig Otten- Weitersfeld Retz- GMÜND Wildendürnbach thal bach Vitis Großdietmanns Hirschbach Göpfritz Retz Drasenhofen Waldenstein an der Schratten- Schwarzenau Neudorf Wild Irnfritz-Messern Pernegg thal Al- Unserfrau- Seefeld- im Weinviertel bern- Altweitra Kirchberg am Walde Haugs- Kadolz Echsenbach dorf dorf Schrattenberg Moorbad Pulkau im Laa an Falken- Harbach Sigmunds- Weitra Pernersdorf Pulk- Hadres der Thaya stein Herrnbaum- St. Bernhard- herberg Allentsteig Brunn an au- garten der Wild Frauenhofen Zellerndorf tal Unter- Bernhardsthal Schweiggers HORN Mailberg stinken- Meiseldorf Röschitz Großharras brunn St. Martin Röhrenbach Staatz Poysdorf Altlichtenwarth Rabensburg Großschönau Altenburg Eggenburg Guntersdorf Großkrut Stronsdorf Pölla Gaubitsch Fallbach Bad Rosenburg-Mold Wullersdorf Großpertholz Sitzendorf Straning- Haus- Haus- an der Neusiedl Hohenau an ZWETTL Burgschleinitz- Grafenberg Nappersdorf- kirchen brunn Verwaltungsgrenzen Schmida an der der March Kühnring Kammersdorf Grabern Zaya Paltern- Gars am Gnaden- Wilfersdorf dorf- Krumau Kamp St. Leonhard -

Region Region
Lernende Bildungskalender Region Erwachsenenbildung in der Region Kursprogramm Herbst 2015 September 2015 – Jänner 2016 I QualifizierungI Sprachen I EDV I Senioren I Kinder und Familie Südliches Waldviertel I Kochen I Naturschule I Gesundheit und Bewegung I Körper Nibelungengau und Seele I Kreativ und Handwerk I Tanz und Musik I Vorträge Hofamt Priel Mühldorf Ybbs Marbach Yspertal Pöggstall Golling Nöchling St. Oswald Bärnkopf Krummnußbaum Persenbeug-Gottsdorf Münichreith / Laimbach Schönbach Ottenschlag Pöchlarn Raxendorf Maria Taferl Weiten Albrechtsberg Erlauf Hauptstraße 9, 3683 Yspertal E-mail: [email protected] Tel. 07415/6767-30 www.lernenderegion.at An einen Haushalt Post.at durch Zugestellt Lernen mit einem Lächeln SA 10.10.15, 20.00 Uhr Kultursaal Albrechtsberg Albrechtsberg pholc - Irish Night Kartenvorverkauf: Raika-Filialen und www.ticketgarden.com Bärnkopf 3. Waldviertler Museumstag SO 20.09.15, 14.00 – 18.00 Uhr Holzhackermuseum Tourismusbüro Bärnkopf, 0 28 74 / 84 01, [email protected] Brotbacken, Zugsägeschneiden, Rätselralley für Groß und Klein Maria Taferl Käsemarkt SO 25.10.15, ab 08.00 Uhr Ottenschlag Schlosscafé jeden DO, von 14.00 - 18.30 Uhr (ausgenommen Feiertage) Von den Schülerinnen und Schülern des 2. Jahrganges betreut. Fachschule Schloss Ottenschlag Tag der offenen Tür Infos über die Ausbildungsschwerpunkte der Fachschule. FR 06.11.15 Lehrabschluss Koch/Köchin und Restaurantfachmann/frau. Fachschule Schloss Ottenschlag Veranstaltungen Advent im Schloss Zum 11. Mal findet heuer der Adventmarkt