Gewalt Gegen/Durch Polizei
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kriminalprävention in Deutschland Länder-Bund-Projektsammlung
Polizei + Forschung Infopool Prävention ojektsammlung 2001 Bundeskriminalamt (Hg.) Der Infopool Prävention des Bundeskriminalamts ist eine im November 1995 begonnene Informationssammlung zu natio- nalen und internationalen Präventionsakteuren, -aktivitäten, -projekten und -modellen. Ziele des Infopool Prävention sind u. a. das Erkennen von Entwicklungen, Schwerpunkten, aber auch Defiziten im Bereich der Kriminalprävention, das Erkennen von relevanten The- Länder-Bund-Pr Kriminal- menfeldern für die präventionsbezogene Forschung inklusive der Initiierung und Durchführung von Forschungsprojekten. Der Infopool Prävention ist auch als Angebot eines Forums für den nationalen und internationalen Erfahrungsaustausch prävention zwischen Polizei und sonstigen Akteuren der Kriminalpräven- tion zu verstehen. Nachahmenswerte Präventionsprojekte werden regelmäßig in Deutschland in Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern in Form der vorliegenden „Länder-Bund-Projektsammlung“ oder themen- spezifischen Sonderbänden veröffentlicht. Unter http://www.bka.de stellt das Bundeskriminalamt zudem Länder-Bund-Projektsammlung eine Datenbank mit bisher veröffentlichten Präventionspro- jekten aus dem Infopool Prävention zur Verfügung. 2001 Kriminalprävention www.luchterhand.de Luchterhand Kriminalprävention in Deutschland Länder-Bund-Projektsammlung Polizei + Forschung Bd. 13 herausgegeben vom Bundeskriminalamt (BKA) Kriminalistisches Institut Beirat: Prof. Dr. Hans-Jürgen Kerner Direktor des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen Wolfgang Sielaff -
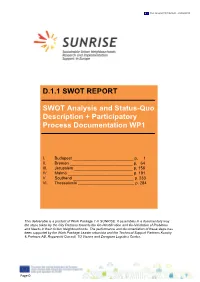
D.1.1 SWOT REPORT SWOT Analysis and Status
Ref. Ares(2019)1367647 - 28/02/2019 D.1.1 SWOT REPORT SWOT Analysis and Status-Quo Description + Participatory Process Documentation WP1 I. Budapest ___________________________ p. 1 II. Bremen ____________________________ p. 64 III. Jerusalem __________________________ p. 156 IV. Malmö _____________________________ p. 191 V. Southend ___________________________ p. 233 VI. Thessaloniki _________________________ p. 284 This deliverable is a product of Work Package 1 in SUNRISE. It assembles in a documentary way the steps taken by the City Partners towards the Co-Identification and Co-Validation of Problems and Needs in their Action Neighbourhoods. The performance and documentation of these steps has been supportet by the Work Package Leader urbanista and the Technical Support Partners Koucky & Partners AB, Rupprecht Consult, TU Vienna and Zaragoza Logistics Center. Page 0 D.1.1 SWOT REPORT | BUDAPEST SWOT Analysis and Status-Quo Description + Participatory Process Documentation City: Budapest ReportinG Period: February 2019 Responsible Author(s): Antal Gertheis, Noémi Szabó (Mobilissimus Ltd.) Responsible Co-Author(s): Urbanista, TU Vienna, Rucpprecht Consult Date: February 28th, 2019 Status: Final Dissemination level: Confidential Page 1 SWOT Analysis and Status-Quo Description | BUDAPEST Find first options for action in your neighbourhood and check the conditions for their implementation! • Collect all relevant data for your neiGhbourhood • Have a closer look at strength, weaknesses, opportunities and threats • Find »Corridors of Options« • Do a »Bottom-up review« • Get a set of thoughtful options for actions that will be developed further in WP2 Page 2 Executive Summary DurinG the process of co-identification in the area of Törökőr, we reached many different groups who were ready to tell their opinion and problems concerning the mobility in the neighbourhood. -

Bewertung Der Unterlagen Der Polizei in Baden-Württemberg
Staatliche Archivverwaltung Baden-Württemberg - Bewertungsmodell Polizei - Stand: März 2003 Vertikale und horizontale Bewertung der Unterlagen der Polizei in Baden-Württemberg Dokumentation Stand: März 2003 Fortschreibung: Generallandesarchiv Karlsruhe 1 Staatliche Archivverwaltung Baden-Württemberg - Bewertungsmodell Polizei - Stand: März 2003 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2. Abkürzungen und Siglen 3. Organisation 4. Verwaltung 5. Öffentlichkeitsarbeit 6. Nachwuchswerbung und –einstellung 7. Aus- und Fortbildung 8. Einsatz 9. Kriminalitätsbekämpfung 10. Technik 11. Verkehr 12. Ärztlicher Dienst 13. Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg (SEK) 14. Wirtschaftskontrolldienst (WKD) 15. Polizeihunde 16. Polizeipferde 17. Reviere 18. Positivliste der Unterlagen der Polizei (nach Dienststellen geordnet) 2 Staatliche Archivverwaltung Baden-Württemberg - Bewertungsmodell Polizei - Stand: März 2003 1. Einleitung Das vorliegende Bewertungsmodell ermöglicht den Staatsarchiven ein rationelles und einheitliches Vorgehen bei der Aussonderung von Unterlagen der Polizei. Den Polizeidienststellen gibt es eine erste Orientierung darüber, welchen Stellenwert bestimmte Aktengruppen bei der Überlieferungsbildung haben und wie die Bewertungsentscheidung des Staatsarchivs ausfallen wird. 1999 konstituierte sich die Projektgruppe zur vertikalen und horizontalen Bewertung der Unterlagen der Polizei in Baden-Württemberg. Ihr gehörten an: Dr. Jürgen Treffeisen (LAD, Projektleitung), Gebhard Füßler (StAS), Dr. Elke Koch (StAL), Jochen Rees (StAF), Sabine Schnell -

'Networking Peace' Comprehensive Strategies for Sustainable Conflict Management in a Complex Security Environment – the German Approach
'Networking Peace' Comprehensive strategies for sustainable conflict management in a complex security environment – the German approach. Jael Aheram, “War & Peace”, creative common license Master Thesis by Frauke Seebass s4837800 Supervisor: Dr. Bert Bomert Radboud University M.A. Human Geography Conflict, Territories and Identities 2016-2017 Contents Page Figures and Tables iii List of Abbreviations iii Acknowledgments vi Executive Summary vi 1) Introduction 1 2) Methodological structure: data collection and research design 2 2.1) Literature Review 4 2.2) Semi-structured guided expert interviews 4 2.3) Focus Study: Mixed methods 6 2.4) Evaluation of the research process 7 3) Literature review: theoretical framework and conceptual outline 8 3.1) The Security-Development Nexus and International Peacekeeping: critical assessment on 'global security' 8 3.2) Of peacekeeping and nation-building: current intervention culture 9 3.3) 'Nation-building': reconstructing 'fragile' states 10 3.4) Civil-military interaction for peace and security 12 3.5) The Comprehensive Approach 15 4) The German discourse 18 4.1) Timeline German Comprehensive Approach 19 4.1.1) Preventing Crises, Managing Conflicts, Supporting Peace: Guidelines of the Federal Government 21 4.2) National actors 25 4.2.1) Foreign Office 29 4.2.2) Interior Ministry 31 4.2.3) Ministry of Defense 34 4.2.4) Ministry for Economic Cooperation and Development 37 4.2.5) Non-governmental actors 39 4.3) International Cooperation: NATO, EU, UN & OSCE 41 5) Practicing Comprehension: The Berlin Center for International Peacekeeping 45 Operations 6) Discussion 47 6.1) Focus on prevention: anticipatory politics versus political diffidence 48 6.2) Focus on sustainability: national, international and human security 50 6.3) Focus on ownership: top-down vs. -

German Police Dictionary
POLICE DICTIONARY A – Z (DEUTSCH –> ENGLISCH) Abgeordneter deputy, member of parliament abhalten (von) to prevent (from) Abhören wiretapping Ablage filing Ablauf (e. Frist) expiry Ablaufkalender diary of events ablenken (Aufmerksamkeit) to distract Abschirmung shield Abteilung division, department Abteilungspräsident Deputy Assistant, Commissioner, Head of Division, Deputy Assistant, Head of Division Abzug, freien - erzwingen to force the granting of safe conduct Adapter adapter Adressat (der Forderung) recipient (of the demand) Agenturmeldung news agency report Akku rechargeable battery, accumulator Akte file, document Alarmierung alert(ing) Amtsleitung Executive Office Heads Analoggerät analog device Analogleitung analog circuit Anfangsforderung initial demand Anforderungsprofil (job/personal) requirements Angehörige dependants, next-of-kin 1 Angehörigenbenachrichti- notification of family gung/-verständigung members Angehörigenbetreuung family support Angesicht zu Angesicht face-to-face Angestellter employee Anrufbeantworter answering machine Ansprechpartner contact, reference person, counterpart Anteilnahme sympathy Anzeichen (für) indicator (of) Appell (öffentlicher) an (public) appeal to Arbeitgeber employer Arbeitsgruppe unit Arbeitsplatzbeschreibung description of the workplace/ workstation Aufbaulehrgang advanced course Aufenthaltsort location Aufenthaltsort (aktueller -) (current) location Aufgabe haben to be in charge of Aufgaben, gesetzliche statutory duties, duties by law aufgeben to surrender Aufnahmedatum (Foto) date when -

Commander's Guide to German Society, Customs, and Protocol
Headquarters Army in Europe United States Army, Europe, and Seventh Army Pamphlet 360-6* United States Army Installation Management Agency Europe Region Office Heidelberg, Germany 20 September 2005 Public Affairs Commanders Guide to German Society, Customs, and Protocol *This pamphlet supersedes USAREUR Pamphlet 360-6, 8 March 2000. For the CG, USAREUR/7A: E. PEARSON Colonel, GS Deputy Chief of Staff Official: GARY C. MILLER Regional Chief Information Officer - Europe Summary. This pamphlet should be used as a guide for commanders new to Germany. It provides basic information concerning German society and customs. Applicability. This pamphlet applies primarily to commanders serving their first tour in Germany. It also applies to public affairs officers and protocol officers. Forms. AE and higher-level forms are available through the Army in Europe Publishing System (AEPUBS). Records Management. Records created as a result of processes prescribed by this publication must be identified, maintained, and disposed of according to AR 25-400-2. Record titles and descriptions are available on the Army Records Information Management System website at https://www.arims.army.mil. Suggested Improvements. The proponent of this pamphlet is the Office of the Chief, Public Affairs, HQ USAREUR/7A (AEAPA-CI, DSN 370-6447). Users may suggest improvements to this pamphlet by sending DA Form 2028 to the Office of the Chief, Public Affairs, HQ USAREUR/7A (AEAPA-CI), Unit 29351, APO AE 09014-9351. Distribution. B (AEPUBS) (Germany only). 1 AE Pam 360-6 ● 20 Sep 05 CONTENTS Section I INTRODUCTION 1. Purpose 2. References 3. Explanation of Abbreviations 4. General Section II GETTING STARTED 5. -

Women in Police Services Eu 2012
WOMEN IN POLICE SERVICES IN THE EU FACTS AND FIGURES - 2012 © 2013 Institut for Public Security of Catalonia Ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5 08100 - Mollet del Vallès www.gencat.cat/interior/ispc Editor: Lola Vallès [email protected] Design: Conxita Gandia February 2013 Women in police services in the EU 2012 Summary Introduction.......................................................................................................................... 5 The researchers................................................................................................................. 7 Acknowledgements............................................................................................................ 7 The questionnaire .............................................................................................................. 9 Austria ................................................................................................................................ 11 Belgium .............................................................................................................................. 13 Cyprus ................................................................................................................................ 15 Denmark ............................................................................................................................. 17 England and Wales............................................................................................................ 19 Estonia............................................................................................................................... -

Germany 2020 Human Rights Report
GERMANY 2020 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE SUMMARY Germany is a constitutional democracy. Citizens choose their representatives periodically in free and fair multiparty elections. The lower chamber of the federal parliament (Bundestag) elects the chancellor as head of the federal government. The second legislative chamber, the Federal Council (Bundesrat), represents the 16 states at the federal level and is composed of members of the state governments. The country’s 16 states exercise considerable autonomy, including over law enforcement and education. Observers considered the national elections for the Bundestag in 2017 to have been free and fair, as were state elections in 2018, 2019, and 2020. Responsibility for internal and border security is shared by the police forces of the 16 states, the Federal Criminal Police Office, and the federal police. The states’ police forces report to their respective interior ministries; the federal police forces report to the Federal Ministry of the Interior. The Federal Office for the Protection of the Constitution and the state offices for the protection of the constitution are responsible for gathering intelligence on threats to domestic order and other security functions. The Federal Office for the Protection of the Constitution reports to the Federal Ministry of the Interior, and the state offices for the same function report to their respective ministries of the interior. Civilian authorities maintained effective control over security forces. Members of the security forces committed few abuses. Significant human rights issues included: crimes involving violence motivated by anti-Semitism and crimes involving violence targeting members of ethnic or religious minority groups motivated by Islamophobia or other forms of right-wing extremism. -

Organisiertes Verbrechen
Organisiertes Verbrechen , au NDEsKRI MI NALAMT WI ES BADE N.. Neben der .Vortragsreihe< gibt das Bundeskriminalamt die Schriftenreihe des Bundeskriminalamtes heraus. Sie enthllt systematische und erschöpfende EinzeldarSlellungen aus dem Gebiet der Kriminologie und Kriminalistik und ist in erster Linie für MiniSlerien, Polizei-, Zoll- u. ä. Behörden, Gerichte, Stuuanwaltschaften und deren Angehörise bestimmL Der Bezug ist nicht über den Buchhandel, sonde,rn nur unmittelbar uber das Bundeskriminalamt - Kl 1 4 - mösrich. Die jährliche GeSl.mtlieferung umfaßt drei Hefte. Als Geschliftsjahr (Lieferungsjahr) ist das Kalenderjahr zugnmde gelegt. Fur das laufende Abonnement ist der Betrag jeweils innerhalb eines Monats nach lieferung des ersten Heftes fällig. Ist bis zum Ablauf dieses Monats keine schriftliche Kündigung erfolgt, verlängert sich das jahresabonnement automatisch um ein weiteres Jahr. Die Rech nu ng wird der ersten Lieferung des jeweiligen jah rgangs beigelegt. Der Preis für das jahresabonnement beträgt 12,- DM. Auch bei Abgabe einzelner Hefte ist der volle Abonnement preis zu bezahlen. Im Interesse einer reibungslosen Verbuchung wird gebeten, bei Einzahlung unbedingt die Im Anschriftenfeld der Rechnung stehende feste Beziehernummer (K ..•) ;anzugeben. Konten der Bundeskasse Frankfurt am Main: P05!Scheckamt Frankfurt am Main Nr. 8971-608 landeszentralbank Frankfurt am Main Nr. 50001020 Zur Vermeidung von Rückfrasen sind bei der Bestellung der .Schriftenreihe. in iedem Falle Beruf oder Dienstgrad sowie die Prlvalilttschrift anzugeben. Verzögerungen bei der Zustellung und unnötige Mehrausgaben sind vermeidbar, wenn Adressenänderungen umgehend dem Bundeskriminalamt - K/1 4 - mitgeteilt werden. Bisher sind folgende noch lieferbare Hefte erschienen: Jah rgang 1960 f1. 4. 1960 bis 31. 12. 1960) Jahrgang 1968 (1. 1.1968 bis 31. 12. 19(8) 5<lchfahndung (MuSlerkatalog) (als Heft 1-3 1. -

Statewatch Analysis Germany Permanent State of Pre-Emption
Statewatch analysis Germany Permanent state of pre-emption By Katrin McGauran Reform of the Federal Police Authority is the latest in a series of legal, institutional and technological developments underpinning Germany’s increasingly authoritarian “security architecture”. It has been widely observed that the security architecture of post-Cold War western Europe is defined by a conflation of the police and security services: political intelligence gathering, that is the tailing, bugging, surveillance, data collection and profiling of citizens, has become part and parcel of the modus operandi of police forces. The use of surveillance is not restricted to foreigners or domestic political activists and terrorists, but can now affect the population as a whole. Legally, institutionally and technologically, this development manifests itself in the expansion and merging of databases, 'projects', personnel, remits and police force instruments, with the internal and external security services. One consequence of this conflation of activities is that law enforcement acts in an increasingly repressive and authoritarian fashion towards its own citizens, particularly those who challenge the status quo, such as social movements and investigative journalists. The causalities of this new security architecture are civil liberties and basic democratic rights such as privacy, data protection, the right to protest and freedom of the press, with systematic discrimination against particular groups (political activists and foreigners) profiled as potential terrorist -

Propolizei September/Oktober 2017
pro OLIZEI P INFORMATIONEN FÜR NIEDERSACHSENS POLIZEI HEFT SEPTEMBER / OKTOBER – 2017 www.polizei.niedersachsen.de POLIZEI EXTRABLATT VON 1985 G20 Polizeieinsatz am 7. und 8. Juli in Hamburg STRATEGIE 2020 Demografischer Wandel: Entwicklungspotenzial nutzen SPRACHKURS Plattdeutsch für Polizisten JUBILÄUM 70 Jahre Wasserschutzpolizei in Niedersachsen Inhalt | Impressum ✘ TITEL G20 – Gipfeltreffen und Polizeieinsatz am 7. und 8. Juli in Hamburg 4 G20 – Einsatz der Spezialkräfte im Schanzenviertel 5 G20 – BFHu Niedersachsen kehrt mit 32 Verletzten aus Einsatz zurück 9 G20 – 140 Einschläge an Wasserwerfern 11 G20 – „Danke, dass ihr hier seid!“ 12 G20 – Im Einsatz: Konfliktmanager aus Niedersachsen 13 Seite 17 G20 – Auch für den Reiterzug war der Einsatz eine Herausforderung 14 G20 – Phönix über Hamburg 15 G20 – Zwischen Berliner ‚Partypolizisten‘, dem Gipfel und der Gewalt 16 ✘ AKTUELL Sommerreise des Innenministers 17 ✘ NIEDERSACHSEN Strategie 2020 – Demografischer Wandel 18 Seite 24 Lüneburg – 4.500 Gäste bei Verkehrssicherheitstag 20 Meldungen 21 PolizeiClient – Pilotbetrieb in der PI Diepholz gestartet 22 Straßenverkehr – Aktion „Helfen statt Gaffen“ 23 22. Deutscher Präventionstag 24 Verkehrssicherheit – Landesweite Präventionsaktion 25 Sprachkurs – Plattdeutsch für Polizisten 26 Jubiläum – 70 Jahre Wasserschutzpolizei in Niedersachsen 27 Seite 27 Safe Tourist Season 2016 (Teil 3) 28 ✘ SPORT NPM Leichtathletik 2017 – Großer Sport, tolle Stimmung 29 ✘ INTERN PI Stade – Kindertagesstätte: Was lange währt, wird endlich gut 30 TITELBILD: -

Broszura Informacyjna Informationsbroschüre
Informationsbroschüre Broszura informacyjna Verwaltungsgliederung in Deutschland und Polen, Struktur und Arbeit der Sicherheitsbehörden in der Grenzregion Podział administracyjny w Polsce i w Niemczech, struktura i praca organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w regionie przygranicznym Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg–Polen 2014-2020 Dofinansowanie transgranicznej współpracy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg–Polen 2014-2020 Dofinansowanie transgranicznej współpracy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 Studienreise zum Deutschen Bundestag, Berlin/Wyjazd Schulung zum Vergleich der administrativen Strukturen in studyjny do niemieckiego Bundestagu, 08.03.2018, Berlin Polen und Deutschland/Szkolenie dotyczące porównania struktur administracyjnych w Polsce i w Niemczech, 06.11.2019, Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) Impressum Impressum Euroregion Spree-Neiße-Bober Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Berliner Straße 7 “Sprewa - Nysa - Bóbr” 03172 Guben ul. Piastowska 18 Tel.: +49 3561 3133 66-620 Gubin Fax: +49 3561 3171 Tel.:/Fax: +48 68 455 80 50 [email protected] [email protected] www.euroregion-snb.de www.euroregion-snb.pl Euroregion PRO EUROPA VIADRINA Euroregion PRO EUROPA VIADRINA Mittlere Oder e.V. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Holzmarkt 7 „Pro Europa Viadrina” 15230 Frankfurt (Oder) ul. Władysława Łokietka 22 Tel.: +49 335 66 594 0 66-400 Gorzów Wlkp.