(SPNV) in Berlin Und Brandenburg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Retrospective of Preservation Practice and the New York City Subway System
Under the Big Apple: a Retrospective of Preservation Practice and the New York City Subway System by Emma Marie Waterloo This thesis/dissertation document has been electronically approved by the following individuals: Tomlan,Michael Andrew (Chairperson) Chusid,Jeffrey M. (Minor Member) UNDER THE BIG APPLE: A RETROSPECTIVE OF PRESERVATION PRACTICE AND THE NEW YORK CITY SUBWAY SYSTEM A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts by Emma Marie Waterloo August 2010 © 2010 Emma Marie Waterloo ABSTRACT The New York City Subway system is one of the most iconic, most extensive, and most influential train networks in America. In operation for over 100 years, this engineering marvel dictated development patterns in upper Manhattan, Brooklyn, and the Bronx. The interior station designs of the different lines chronicle the changing architectural fashion of the aboveground world from the turn of the century through the 1940s. Many prominent architects have designed the stations over the years, including the earliest stations by Heins and LaFarge. However, the conversation about preservation surrounding the historic resource has only begun in earnest in the past twenty years. It is the system’s very heritage that creates its preservation controversies. After World War II, the rapid transit system suffered from several decades of neglect and deferred maintenance as ridership fell and violent crime rose. At the height of the subway’s degradation in 1979, the decision to celebrate the seventy-fifth anniversary of the opening of the subway with a local landmark designation was unusual. -
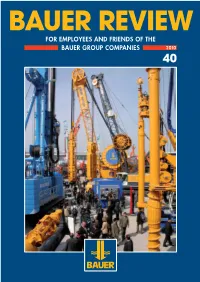
Enu1 U4 Layout 1
BAUER REVIEW FOR EMPLOYEES AND FRIENDS OF THE BAUER GROUP COMPANIES 2010 40 Contents Status report 5 20 years since reunification 6 Thomas Bauer on reunification 20 20 years of environmental technology 23 Construction in southern Germany 24 Bauma 2010 26 Equipment for customer use 28 Projects all over the world 30 Bauer Resources 38 25 years of cutter technology 40 Central Services 41 News in brief 43 In-house news ctober 3rd, 1990 culminated in a massive fireworks display and Oringing of bells throughout the country. Less than 11 months after the fall of the Berlin Wall, East and West Germany – which as a result of the Sec- ond World War had endured 40 years of separation and confrontation – were now reunited. Even before the official reunification took place, Bauer, like many companies in West Germany, had been very keen to move into the former German Demo- cratic Republic (GDR) firstly in order to expand its markets and, secondly, to assist in the transition from a planned economy to a free market economy. Twenty years on, this Review looks at how Bauer went about this undertaking, returning once again to focus on the early days of the reunification process. The story is told not so much on the basis of documents and records, but rather through the voices of the man- agers responsible for running the busi- ness at the time. Most of them are still in senior management posts today, though some have retired. Witnesses on the Schrobenhausen side who were consulted in compiling the report in- cluded Chairman of the Management Board Thomas Bauer and Heinz Kalten - ecker, as well as Wolfgang Brunner, Alexander Hofer, Josef Goller and Ernst Stümpfle. -

External Locations of Modern Railway Stations – a Departure from Sustainable Mobility?
Systemy transportowe Jacek Wesołowski External locations of modern railway stations – a departure from sustainable mobility? Will people come to the railway regardless of station location or in 1894. Rotterdam was a rare example of a long cross-city line should rather the railway come to where people are? The pursue for built on iron viaduct (1877; line relocated underground in 1993). central locations for stations was probably the most characteristic The long lasting ‘battle’ of railways with authorities of Paris, won feature of Victorian railways urging them to cover huge costs of in- by the latter, is particularly emblematic. Mainline railways have ner city lots and approaches. It has been often stressed the station to wait till the 1970s to gain access directly to the heart of the has changed it character becoming far more than the pure trans- city which materialised in a limited form as a big suburban hub at port node. The evolution towards a retail and service centre was Châtelet-les-Halles. In the last decades of the 19th century even possible thanks to its inner city location [1]. Recent developments a reverse tendency was born, to whom good excuse were the in some countries with most advanced railway systems show that need for large areas for central stations and the need to free the modern stations are often neither central nor even easily accessible. cities from any physical constraints for expansion. Truncation of The time gained on quick train travel and lack of check in times is inner parts of railways approaching Frankfurt am Main in order then lost by most customers on long access travels. -

Optimierungsbedarf an Stationen Mit Unter 50 Ein- Und Aussteigern Pro Tag
Abb. 5.2: Optimierungsbedarf an Stationen mit unter 50 Ein- und Aussteigern pro Tag 80 VERKEHRSINFRASTRUKTUR bare Bahnsteiglängen von mindestens 60 m bis maximal 170 m gebaut. Das Land Brandenburg prüft den Einsatz von Doppelstockwendezügen mit sechs Wagen neben dem RE 1 [Magdeburg Pots- dam – Frankfurt (Oder)] auch für den RE 5 (Elsterwerda – Rostock) in den Sommermo- naten sowie den Einsatz von Doppelstock- wendezügen mit fünf Wagen für den RE 3 (Lutherstadt Wittenberg – Angermünde – Stralsund), um dem Verkehrsbedürfnis auf diesen Verbindungen Rechnung zu tragen. Die notwendigen Bahnsteiglängen sind an diesen Strecken bei neuen Anlagen zu be- rücksichtigen. Bild 5.4: Neue Bahnsteiganlage Bahnhof Prenzlau Auf den übrigen Strecken mit elektrischem Regionalexpressverkehr (RE 2, RE 4, RE 7, RE 11, RE 15 und RE 18) sind grundsätzlich Bahnsteiglängen für Doppelstockwendezü- ge mit vier Einzelwagen plus Lokomotive zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die nicht elektrifizierte Ostbahn (RB 26). Auf dem die- selbetriebenen RE 6 (PrignitzExpress) sind die bisher realisierten Bahnsteiglängen mit 100 m Nutzlänge ausreichend. Mit dieser Bahnsteiglänge ist auch für die Regionalbah- nen RB 12, 33, 35, 36, 46, 51, 54, 65 und 66 zu planen, während für die Regionalbahnen 25, 27, 60 und 63 Bahnsteiglängen von 85 m ausreichen. Die im LNVP enthaltenen Angaben zu Bahn- steiglängen und -höhen berücksichtigen nur die aus dem SPNV erwachsenden Anforde- rungen. VERKEHRSINFRASTRUKTUR 81 Abb. 5.3: Ausbaustand der Bahnsteige 82 VERKEHRSINFRASTRUKTUR Abb. 5.4: Konzept Bahnsteighöhen und -längen VERKEHRSINFRASTRUKTUR 83 6. Zielkonzepte 6.1 Weiterentwicklung des integrierten träger des üÖPNV gemeinsam mit dem Verkehrssystems Aufgabenträger des SPNV zu erstellen. • VBB Die im LNVP 2008 – 2012 begonnenen Po- Im Auftrag der Länder Berlin und Branden- tenzialanalysen für einzelne Linien als Kor- burg bestellt der VBB den Regional- und ridoruntersuchung haben sich bewährt und den S-Bahnverkehr. -

Der Weihnachtsbaum Fährt Regionalexpress
Inseln im Winter Wohlfühlen – Urlaub in an den kalten Tagen Mecklenburg-Vorpommern – Angebote der TMB Ī Seite 20 Ī Seite 23 TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH ᵸ Bahn Berlin Deutsche Bahn Gruppe 9. Dezember punkt Mitmachaktion von DB Regio Der Weihnachtsbaum Nr. 23/2004 Nr. 3 Reisen in Berlin und Brandenburg fährt RegionalExpress BAHNHOFSERNEUERUNG Provisorium ur jeder dritte Weihnachts- baum, der zu den Festtagen für Warschauer Ndeutsche Wohnzimmer schmückt, hat in einem echten Wald gestanden. Straße Wer wissen möchte, wo sein Schmuck- stück gewachsen ist und wer es natur- Derzeit wird ein proviso- belassen genießen will, holt es sich – rischer Zugang für die legal natürlich – aus dem Wald. S-Bahnsteige Warschauer Gemeinsam mit Brandenburger Straße nördlich des jetzigen Forstämtern organisiert DB Regio Bahnhofs errichtet, um das am 11. und 18. Dezember den alter- Empfangsgebäude und die nativen „Weihnachtsbaumein- alten Zugänge im ersten schlag“. Mit dem Regionalzug geht Quartal 2005 zu beseitigen. es bis dicht an den Wald, der Förster So ergibt sich am Wochenen- sorgt für fachmännische Anleitung de 18./19. Dezember auf der und die Gulaschkanone für Warmes Stadtbahn eingeschränkter im Bauch. Die ganze Aktion wird da- S-Bahnverkehr. mit natürlich nicht nur der übliche Die Bauarbeiten für das neue „Baumkauf“, sondern ein herrliches Empfangsgebäude beginnen Vergnügen für die Familien oder den erst im Jahr 2008, wegen Freundeskreis. Der Weihnachts- des schlechten Bauzustands mann kommt auch! Vier Bahnziele wird das alte schon jetzt ab- ermöglichen unterschiedlich lange gerissen. Für die Fahrgäste Waldspaziergänge zum Ort des Ge- verlängert sich der Um- schehens und haben verschiedene steigeweg zum U-Bahnhof Baumarten im Angebot. -

3 Bahnknoten Von Nord Und Süd Offen
Berlin Mit Kind und Kegel ganz und gar das Reiseland auf Fahrrad eingestellt Brandenburg erleben Ī Seiten 4/5 Ī Seite 23 TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH ᵸ Bahn Berlin Deutsche Bahn Gruppe 12. Mai punkt DB Regio-Angebote 2006 nach Tunnelfreigabe Nr. 9/2005 Nr. 3 Bahnknoten von Reisen in Berlin und Brandenburg Nord und Süd offen AUSSTELLUNG chnellere Verbindungen, kürzestem Wege die Berliner City Regionalbahnhöfe hinzu. Ande- Die Berliner kürzere Wege, optimale durchqueren, sie müssen nicht re RE-Linien verändern ihren SAnschlüsse – wenn am mehr über den Außenring auf die Laufweg, um – wie auf der Stre- S-Bahn 28. Mai 2006 der neue Nord-Süd- Stadtbahn fahren. Am zentralen cke nach Cottbus – eine höhere vor 60 Jahren Fernbahntunnel für den Verkehr Hauptbahnhof-Lehrter Bahnhof Pünktlichkeit zu gewährleisten. freigegeben wird, verbessern sich steigt man dann in alle Richtun- Mehr dazu auf Ī Seite 3 und in den fol- Eine Sonderausstellung des die Bahnverbindungen für Zehntaus- gen um, mit optimalen Anschlüs- genden punkt 3-Ausgaben. Berliner S-Bahn-Museums ende Brandenburger in Richtung sen. Es kommen eine 7. RE-Linie, dokumentiert anlässlich des Berlin und für Zehntausende Berliner drei neue Strecken und neun Jahrestages des Kriegsendes die ins schöne Umland der Verwüstungen bei der Berliner Hauptstadt. S-Bahn, die eine Folge des „totalen Die Luckenwalder Krieges“ waren. beispielsweise wer- Beleuchtet wird der Zeitraum vom den dann statt bisher Herbst 1944 bis Ende 1945. 66 Minuten mit dem Foto: D. Ulrich Zustand und Niedergang des RegionalExpress nur Ī S-Bahn-Netzes zu dieser Zeit noch 39 Minuten bis werden auf Tafeln und mit zum Potsdamer Platz originalen Museumsstücken brauchen, umsteigen beschrieben. -

Landesnahverkehrsplan 2013 – 2017 Impressum
Landesnahverkehrsplan 2013 – 2017 Impressum Herausgeber: Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg Referat 10 Koordination, Kommunikation, Internationales Henning-von-Tresckow-Straße 2 – 8 14467 Potsdam [email protected] www.mil.brandenburg.de Fachliche Koordination: Referat 43 ÖPNV, Eisenbahnen Unter Mitwirkung von: Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH Redaktionelle Begleitung: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD, Aachen/Berlin Stand: 6. Dezember 2012 Gestaltung und Druck: LGB (Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg) Auflage: 5.000 Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers Hinweis: Diese Broschüre wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Infrastruktur und Land- wirtschaft des Landes Brandenburg herausgegeben. Sie darf nicht während des Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunal- wahlen sowie auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Unabhängig davon, wann, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Schrift den Empfängern zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet wer- den, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Vorwort Ich freue mich, Ihnen den Landesnahverkehrsplan 2013 bis 2017 vorlegen zu können. Der Fortschreibung ging eine Evaluierung des Landesnahverkehrs- plans 2008 bis 2012 voraus. Eine durchaus -

Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt Starts Operations
NEWSLETTER Wednesday, 04.11.2020 © Thomas Trutschel/Photothek Berlin Brandenburg Airport IATA CODE: BER Willy Brandt starts operations area size 1,470 ha = 2,000 football pitches The new Terminal 1 at Berlin Bran- the Federal Minister of Trans- denburg Airport Willy Brandt port and Digital Infrastructure, (BER) was opened on 31 October Andreas Scheuer MdB, and the Passenger check-in 2020 with the landing of the two Chairman of the Supervisory Board 25 passenger aircrafts operated by easyJet and of the airport company, Rainer Lufthansa. Upon arrival, the pas- Bretschneider. jet bridges sengers, including easyJet CEO Johan Lundgren and Lufthansa On Sunday, 1 November 2020, reg- Runways CEO Carsten Spohr, were welcomed ular operations began at Terminal North: 3,600 m in Terminal 1 by the head of the 1 of Berlin Brandenburg Airport South: 4,000 m airport company, Engelbert Lütke Willy Brandt (BER) with the Daldrup. first commercial departures. Standing slots At 6.45 in the morning, an 100 aircrafts The symbolic opening act took easyJet aircraft took off for place in a small circle and was London Gatwick. In the course of attended by the Minister Presi- the day, a total of 23 departures Retail dent of the State of Brandenburg, with over 3,000 passen- 120 shops, restaurants Dietmar Woidke, the Govering gers took place from the new and service facilities Mayor of Berlin, Michael Müller, Terminal 1. > 20,000 m² BUSINESS LOCATION THREE QUESTIONS FOR Berlin Brandenburg Airport BER - Driver of Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup, growth for the entire region Chief Executive Officer of FBB GmbH Following the opening of BER, the Airport Region Berlin levels again until 2024. -

2022 Des Landes Brandenburg
Stellungnahme zum Landesnahverkehrsplan 2018 - 2022 des Landes Brandenburg 1. Einleitung Die Industrie- und Handelskammern (IHK) sind die gesetzlich verankerten Selbstverwaltungsorganisationen der gewerblichen Wirtschaft im Land Brandenburg. Die Industrie- und Handelskammern vertreten die Interessen von mehr 150.000 Unternehmen (36.000 Mitglieder Cottbus, 39.000 Mitglieder Ostbrandenburg, 78.000 Mitglieder Potsdam). Für eine gute wirtschaftliche Entwicklung ist die Erreichbarkeit der Unternehmen für die Mitarbeiter und Kunden in der gesamten Fläche Brandenburgs und Berlins elementar. Darüber hinaus sind gute Eisenbahnverbindungen in die angrenzenden Bundesländer und nach Polen unverzichtbar. Vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel und Bevölkerungszuwachs in der Metropole wird eine gute ÖPNV-Anbindung immer entscheidender. Aus dieser Betroffenheit haben die Industrie- und Handelskammern Cottbus, Potsdam und Ostbrandenburg ihre strategischen Überlegungen bezüglich des ÖPNV nachfolgend zusammengetragen. Das Land Brandenburg als größtes Flächenland der ostdeutschen Bundesländer bietet mit dem Berliner Verflechtungsraum und den eher ländlich geprägten Regionen unterschiedliche Rahmenbedingungen für einen ausgewogenen ÖPNV. In den letzten Jahren ist im gesamten Land Brandenburg - sowohl innerhalb des Landes als auch auf den Strecken von und nach Berlin - ein Zuwachs zu verzeichnen, siehe dazu die Korridoruntersuchungen des VBB. Es hat sich eine hohe Dynamik entwickelt, ein reger Zuzug nach Berlin, der sich auch positiv auf die Einwohnerentwicklung -

Tion with the Conduit System of Ejectric Traction?~ L:;.·Ri on Those Tracks?-That Is So
Harry sydneiDb:, . 19th lune, 1911. 8677. You could not have that type of construc :-:69 2 . J II tInt case the Malvern cars cannot be tion with the conduit system of eJectric traction?~ l:;.·ri on those tracks?-That is so. That is so. 8693. So Illat it would be better, in order to 8678. What is your opinion 3S to the most effec hcilitate through traffic from the Melbourne system tive electric system in operation to-day for tram to your syst~m, to have a type of car which could ways ?-The most effective undoubtedly is the over- nm on both tracks ?~-Yes. head trolly system. 8694. Your carS represent a capital value of 8679. Would you state what advantages that £:w,ooo at the present time?-That is true, but system possesses over any other ?-My chief reason the only portion of the cars that would need to be for preference is perhaps its lower capital cost, altered would be the body, which represents, and that is a very important reason. Another is roughly, 50 per cent., so that the loss would really that it is easily maintained; much more so than be £ ro,ooo--;that is, assuming that the bodies the conduit. It is also freer from qreakdown. would have M be scrapped entirely. 8680. I suppose you could readily locate anr 8695. Unless you could sell them ?--That is so. thing that goes wrong and get at it?-That is so. 8696 .. Perhaps the' Adelaide, or some other sys 868I. Have you had anv nersonal exoerience of tem, might take them, when the loss might not ex the conduit svstem ?-None.' I have 'never been ceed £5,000 ?~That might be so. -

Auswahl): Aufsichtsratsvorsitzender Staatssekretär S-Bahn Christian Gaebler
Presseinformation 3. Dezember 2015 Fahrplanwechsel im Dezember 2015 VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH Regionalzüge in Berlin Ostkreuz - NEB und ODEG auf neuen Li- Hardenbergplatz 2 10623 Berlin nien - RE3 und RE5 tauschen Linienäste – S-Bahn nach Straus- Telefon 0 30-25 41 40 berg Nord im 20-Minutentakt Telefax 0 30-25 41 41 12 [email protected] VBB.de Zum europaweiten Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2015 tritt auch im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) der neue Fahrplan in Bahn- und Busanbindung: S+U Zoologischer Garten Bhf Kraft. Im Fahrplan 2016 werden im S-Bahn- und Regionalverkehr teil- weise umfangreiche Änderungen umgesetzt. So werden neben den S- Bahnen erstmals auch Regionalzüge am wichtigen Verkehrsknoten Berlin Ostkreuz halten. Die Eröffnung der neuen Fernverkehrsstrecke Pressesprecherin: zwischen Halle bzw. Leipzig und Erfurt hat auch Auswirkungen auf Elke Krokowski den Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg, da die Fahrpläne an VBB Tel.: 030 - 25 414 - 130 die veränderten Zeiten der ICE- und IC-Züge zwischen Leipzig, Berlin Mobil: 0175 / 436 17 42 und Hamburg angepasst werden müssen. Betroffen hiervon sind unter [email protected] anderem die Linien RE2, RE3, RE5, RB10 und RB14. Nach Abschluss der Bauarbeiten zwischen Strausberg und Strausberg Nord wird dort neu ein 20-Minuten-Takt möglich. Weitere Details zum Fahrplanwech- sel und zu den An- und Abfahrzeiten aller Bahnen und Busse in Berlin und Brandenburg gibt es im Internet unter www.VBB.de, der VBB App Bus&Bahn und bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen. Geschäftsführerin Susanne Henckel Die wichtigsten Neuerungen im Überblick (Auswahl): Aufsichtsratsvorsitzender Staatssekretär S-Bahn Christian Gaebler Handelsregister S41/S42 Berlin-Südkreuz – Ostkreuz – Gesundbrunnen – Westkreuz – HRB 54 603 Amtsgericht Südkreuz Charlottenburg USt-IdNr.: DE 170 900 Der in den Hauptverkehrszeiten auf den Ringlinien angebotene 5-Minuten- 133 Takt wird am Vormittag auf beiden Linien und auf der S41 zusätzlich auch Bankverbindung Berliner Volksbank eG am Abend rund 30 Minuten länger als bisher gefahren. -

Berlin: Border Control
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Supervised Undergraduate Student Research Chancellor’s Honors Program Projects and Creative Work 5-2016 Berlin: Border Control David Berry architecture and design, [email protected] Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj Part of the Historic Preservation and Conservation Commons, and the Urban, Community and Regional Planning Commons Recommended Citation Berry, David, "Berlin: Border Control" (2016). Chancellor’s Honors Program Projects. https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/1990 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by the Supervised Undergraduate Student Research and Creative Work at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Chancellor’s Honors Program Projects by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. siting division in germany the death strip| hamburg bremen tegel berlin gatow tempelhof dresden bonn weimar schonefeld frankfurt munchen USA France UK USSR a nation divided Following the conclusion of World War II, according to the Potsdam agreement, Germany was divided into four occupation zones. Berlin as capital, was divided in a similar way. France, Britain, and the United States met to combine non-Soviet zones into a single zone for reconstruction according to the Marshall Plan. As West Germany developed into a capitalist country, the economy began to rebuild. However, the German Democratic Republic (East Germany) followed in Soviet form with a communist economy heavily owned by the state. With a standard of living gap that continued to widen, huge numbers of citizens from the GDR emigrated to West Germany.