Der Hangeweiher
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
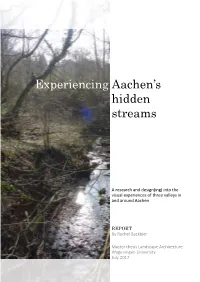
Experiencing Aachen's Hidden Streams
Experiencing Aachen’s hidden streams A research and design(ing) into the visual experiences of three valleys in and around Aachen REPORT By Rachel Backbier Master thesis Landscape Architecture Wageningen University July 2017 II Experiencing Aachen’s hidden streams A research and design(ing) into the visual experiences of three valleys in and around Aachen Master thesis report MSc Landscape Architecture, Wageningen University Rachel Backbier 910105 025 050 Wageningen, July 2017 Supervisors Dr. Ir. Ingrid Duchhart (Wageningen University) Kevin Raaphorst MSc (Wageningen University) External supervisor Ir. Jhon van Veelen (Landschap in Verandering) Prof. Dr. Ir. Adri van den Brink (Examiner) (Wageningen University) Dr. Ir. Marlies Brinkhuijsen (Second reviewer) (Wageningen University) III Colophon Rachel Backbier [email protected] All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of either the author or the Wageningen University Landscape Architecture Chair group. This publication is written as a final master thesis in landscape architecture by order of the chair group of landscape architecture at Wageningen University. Landscape Architecture Chair group Phone: +31 317 484 056 Fax: +31 317 482 166 E-mail: [email protected] www.lar.wur.nl Postal address Postbus 47 6700 AA Wageningen The Netherlands Visiting address Gaia, building number 101 Droevendaalsesteeg 3 6708 PB Wageningen The Netherlands IV Examiner Prof. Dr. Ir. Adri van den Brink ....................................................... (Second) Supervisor Kevin Raaphorst MSc ....................................................... External supervisor Ir. Jhon van Veelen ....................................................... Second reviewer Dr. Ir. Marlies Brinkhuijsen ...................................................... -

King of the Danes’ Stephen M
Hamlet with the Princes of Denmark: An exploration of the case of Hálfdan ‘king of the Danes’ Stephen M. Lewis University of Caen Normandy, CRAHAM [email protected] As their military fortunes waxed and waned, the Scandinavian armies would move back and forth across the Channel with some regularity [...] appearing under different names and in different constellations in different places – Neil Price1 Little is known about the power of the Danish kings in the second half of the ninth century when several Viking forces ravaged Frankia and Britain – Niels Lund2 The Anglo-Saxon scholar Patrick Wormald once pointed out: ‘It is strange that, while students of other Germanic peoples have been obsessed with the identity and office of their leaders, Viking scholars have said very little of such things – a literal case of Hamlet without princes of Denmark!’3 The reason for this state of affairs is two-fold. First, there is a dearth of reliable historical, linguistic and archaeological evidence regarding the origins of the so-called ‘great army’ in England, except that it does seem, and is generally believed, that they were predominantly Danes - which of course does not at all mean that they all they came directly from Denmark itself, nor that ‘Danes’ only came from the confines of modern Denmark. Clare Downham is surely right in saying that ‘the political history of vikings has proved controversial due to a lack of consensus as to what constitutes reliable evidence’.4 Second, the long and fascinating, but perhaps ultimately unhealthy, obsession with the legendary Ragnarr loðbrók and his litany of supposed sons has distracted attention from what we might learn from a close and separate examination of some of the named leaders of the ‘great army’ in England, without any inferences being drawn from later Northern sagas about their dubious familial relationships to one another.5 This article explores the case of one such ‘Prince of Denmark’ called Hálfdan ‘king of the Danes’. -

Wasserweg Wurm/Worm (Herzogenrath/Kerkrade, NL)
WasserWeg Wurm/Worm (Herzogenrath/Kerkrade, NL) Nederlands boven! An der Wurm bei Herzogenrath (bei Aachen) und Kerkrade (NL) wurde nördlich von Herzogenrath im deutsch-niederländischen Grenzbereich zwischen Herzogenrath und Haanrode (Kerkrade) seit dem Winter 2018/2019 ein WasserWeg für das Projekt WasserWege der NaturFreunde NRW entwickelt. Die Wurm entspringt im Aachener Wald (Diepenbenden) und fließt, durch die Aachener Bäche hauptsächlich unterirdisch gespeist, kanalisiert und begradigt aus dem Aachener Becken nach Kohlscheid und Würselen. Hier wird sie durch die Kläranlage Soers gespeist und belastet. Ab Kohlscheid wird die Wurm durch das Naturschutzgebiet "Wurmtal" in einem engen Tal geleitet. Anschließend fließt sie als deutsch-niederländischer Grenzfluss über Herzogenrath, Kerkrade und über Übach-Palenberg bis nach Heinsberg, wo sie in die Rur mündet. Mit den NaturFreunden Herzogenrath-Merkstein und mit lokalen Akteuren und AnwohnerInnen haben wir seit Ende 2018 einen grenzüberschreitenden und damit auch zweichsprachigen WasserWeg entlang der Wurm erarbeitet. Der Schwerpunkt dieses Wasserwegs liegt auf den gewässerspezifischen relevanten Themen dieses Gewässers: der anthropogenen Überprägung und der Gewässerökologie. Themen sind die Gewässerökologie (Eisvogel, Biber) und Abwasser (14 Kläranlagen speisen die Wurm), die kulturhistorische Bedeutung und Nutzung (unzählige Mühlen sind und lagen an der Wurm), die Geschichte und Siedlungsenwicklung (Das "Wurmrevier" ist das ehemalige Bergbaugebiet um Herzogenrath) und die deutsch-niederländische Grenzgeschichte (die Wurm ist Grenzfluss). Der Weg ist nun nach über einem Jahr Arbeit fertig gestellt. Der Rundweg ist 5,4 km lang und geht von der Baalsbrugger Mühle, entlang der Grenzstraße und der Wurm (auf NL-Seite) über Nievelstein (Anna-Nöhlen-Brücke) auf der deutschen Seite zurück über den Naturpark Worm-Wildnis. -

Rund Um Heinsberg Weite Felder Und Grüne Wiesen
Radwandertipp Rund um Heinsberg Weite Felder und grüne Wiesen Vom Knotenpunkt 20 (● KP 20) gegenüber des alten Amtsgerichts auf der ‚Sittarder Straße‘ (Ecke Hochstraße, Kreisverkehr) in Heinsberg, radeln Sie diese Straße in Richtung Westen aus der Stadt hinaus. Über das freie Feld geht es zum ● KP 12 und in Richtung Norden zum ● KP 39 in Waldfeucht Haaren. Der ● KP 13 in Karken leitet Sie dann direkt an die Rur und den ● KP 23. Am Fluss entlang radelnd erreichen Sie bei Orsbeck den ● KP 22. Durch die Rurauen geht es weiter zum ● KP 16. Der ● KP 17 bei Himmerich ist das nächste Ziel. Entlang der Wurm führt die Strecke zum ● KP 05 und über die offenen Feldfluren gelangen Sie zu den Wegepunkten ● KP 18, ● KP 19 und ● KP 12. Ab hier fahren Sie auf bekannter Strecke zurück an den Start der Tour, dem ● KP 20. > ca. 50 km ● KP 20 - ● KP 12 - ● KP 39 - ● KP 13 - ● KP 23 - ● KP 22 - ● KP 16 - ● KP 17 - ● KP 05 - ● KP 18 - ● KP 19 - ● KP 12 - ● KP 20 Nachdem Sie vom Startpunkt, dem ● KP 20 (‚Sittarder Straße‘/Ecke ‚Hochstraße‘) in Heinsberg aus der Stadt herausgeradelt sind, haben Sie ab dem ● KP 12 auf der freien Flur westlich von Heinsberg eine schöne Sicht in das weite offene Rurtal, dessen Hänge sich auf der Heinsberger Seite sanft zum Flusslauf neigen. Im 2. Weltkrieg bildete die Rur 1944/45 für mehrere Monate die Frontlinie zwischen deutscher und alliierter Seite. Die Ortschaften rechts und links des Flusses gehörten zu den am stärksten zerstörten in ganz Deutschland. Weithin sichtbar ist die auf dem Burgberg in Heinsberg gelegene Gangolfuskirche, das Wahrzeichen der Stadt. -

Umwelt-Rundbrief Nr. 83
Aachener Umwelt Rundbrief Dezember 2018 Nr. 83 • Pau und Paunelle • Trinkwasserversorgung in Aachen • Kampf um den Hambacher Forst • Neues Museum in Kelmis Ökologie-Zentrum 1 Aachen e.V. Wir bitten um Spenden für unsere Arbeit Liebe Leserinnen und Leser, auch in diesem Jahr werden wir wahrscheinlich knapp mit schwarzen Zahlen abschließen. Dafür danken wir von Herzen allen unseren UnterstützerInnen. Besonders genannt sei die Stadt Aachen, ohne die unsere Arbeit so nicht möglich wäre. Wichtig sind aber auch unsere privaten SpenderInnen, die uns mit Ihrem Beitrag ermutigen, unsere Arbeit mit Engagement weiter zu führen. Unverzichtbar sind aber auch alle die Menschen, die uns mit Ihrer aktiven Arbeit unterstützen, die Führungen und Vorträge machen, die forschen und recherchieren, die Artikel schreiben, das Rundbrief-Layout machen und so unsere Arbeit tragen. Ohne sie ginge gar nichts. Vielen Dank an euch Alle. Auf Spenden sind wir auch in Zukunft angewiesen und bitten daher um Eure/Ihre Unterstützung für unsere Arbeit. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen, über Buchungen unserer Angebote, über Teilnahme an unseren Veranstaltungen und besonders über aktive Mitarbeit. Vielen Dank für jede Form der Unterstützung! Wir wünschen allen LeserInnen wunderbare und erholsame Festtage und ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr! Das Team des Ökologie-Zentrums Ich möchte die Arbeit des Ökologie-Zentrum Aachen e.V. mit einer Spende unterstützen. Hiermit werde ich Fördermitglied des Ökologie-Zentrums Ich richte zur Überweisung meiner Spende von ..............EURO einen Dauerauftrag ein. Konten des Ökologie-Zentrums: Postbank Köln, IBAN: DE29 3701 0050 0005 2665 03 BIC: PBNKDEFF Sparkasse Aachen, IBAN: DE34 3905 0000 0023 0256 38 BIC: AACSDE33 Datum ................. -

Der Westlichste Kreis Deutschlands Stellt Sich Vor Sehr Geehrte Leserinnen Und Leser, Vorwort Sehr Geehrte Mitbürgerinnen Und Mitbürger Aus Dem Kreis Heinsberg!
Der westlichste Kreis Deutschlands stellt sich vor Sehr geehrte Leserinnen und Leser, Vorwort sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Kreis Heinsberg! Mit der neuen Broschüre über den Kreis Heinsberg möchte ich Ihnen eine umfassende Information über den Kreis Heinsberg an die Hand geben. Infor- mation in gedruckter Form hat auch in Zeiten von Internet und Multimedia ihren Platz, genau wie es Radio, Fern- sehen und Computer noch nicht geschafft haben, die Zeitung oder das gute Buch zu verdrängen. Als Landrat des Kreises Heinsberg möchte ich Ihnen einen Überblick über diese Region geben. Leben, lernen, arbeiten und wohnen im westlichsten Kreis der Bundesrepublik, darüber erfahren Sie alles in dieser Broschüre. Daten und Fakten, einen Wegweiser für Behördengänge, Hinweise, Telefonnummern und viele nützliche Informationen finden Sie auf 42 redak- tionell gestalteten Seiten. Wenn Sie mehr über die Kreisverwaltung wissen wollen, wenden Sie sich einfach an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man wird Ihnen gerne helfen, was in einer bürgerfreundlichen, serviceorientierten Kreisverwaltung selbstverständlich ist. Nutzen Sie aber auch unser übriges Informationsangebot, zum Beispiel den neuen Videofilm über den Kreis Heinsberg und unsere Internetseiten unter www.kreis-heinsberg.de. Und nun viel Spaß beim Lesen. Ihr Karl Gruber Landrat des Kreises Heinsberg 1 Freiraum ist eine Grundvoraussetzung für neue Ideen Wir schaffen Raum und mehr … Besuchen Sie uns: www.industriepark-oberbruch.de 2 Inhaltsverzeichnis AG Grenzland 75 Kreisverwaltung -
Aachener Fahrradsommer 2019 K
die durch die Innenstadt von Aachen richtet. Sie sollte in ihrem ursprüng- Das Grundwasser wurde damals Aachener fließt und verläuft heute unter- lichen Zweck der Wasserversorgung mit Hilfe einer Dampfmaschine aus irdisch kanalisiert durch die Stadt. der Tuchindustrie in Burtscheid die- dem Boden gepumpt. Sie ist immer 1 Fahrradsommer 2019 Der Kanal folgt dabei bis zur Franz- nen. Heute ist sie als Naherholungs- noch erhalten. Heute bestimmt straße in etwa dem historischen gebiet nicht mehr wegzudenken. jedoch modernste Technik die Was- Verlauf, wird dann aber bis zum sergewinnung in der Anlage. Kreislauf des Wassers 7 Kapuzinergraben und Friedrich- 6 Kupferbach Wilhelm-Platz Richtung Peterstraße Der Kupferbach entspringt beim Gut 8 Kläranlage Soers 2019 findet der Aachener Fahrradsommer zum 25. Mal Quelle: ISK 2022, Stadt Aachen weiter geführt. „Hirtzpley“ nahe der Eupener Straße In der Kläranlage Soers werden statt. Alljährlich wird eine Rundstrecke für den Fahrrad- 500 m lang in einer steinernen Rinne und ist der Hauptzufluß des Kupfer- jährlich 25 Millionen Kubikmeter sommer ausgeschildert, die auch für Familien und weniger den Straßenverlauf von Annuntiaten- bachweihers. Dieser wird außerdem Abwasser gereinigt und anschlie- geübte Radfahrer geeignet ist und bis zum Herbst auf bach und Augustinerbach bis zur von den Vorflutern Schildwacht und ßend in die Wurm eingeleitet. Das eigene Faust nachgefahren werden kann. Pontstraße. Mittelbruch, deren Quellen am sind etwa 70 Prozent des Wasser, Eine genaue Streckenbeschreibung finden Sie unter Brückchenweg im Stadtwald liegen, das die Wurm bis zur Einmündung 2 Westpark wie auch der Pionierquelle gespeist. in die Rur führt. www.aachen.de/radfahren. Die Streckenlänge beträgt Der Westparkweiher wird durch In der Kreuzung Eupener Straße/ Im Abwasser findet sich eine Viel- cirka 15 Kilometer und ist für Familien geeignet. -

Geological Traverse Across the Wurm Syncline to the Lower Rhine Embayment
Geologische Traverse von der Wurm-Mulde in die Niederrheinische Bucht (Exkursion G am 1. April 2016) Geological traverse across the Wurm syncline to the Lower Rhine Embayment Von Christoph Hilgers1 Mit 26 Abbildungen Fahrtroute: Aachen – Würselen – Herzogenrath – Baesweiler – Aachen. Top. Karten: TK 25 Bl. 5002 Geilenkirchen, 5102 Herzogenrath. Geol. Karten: Geologische Karte der nördlichen Eifel 1:100.000 (Knapp 1980a). Zusammenfassung Die Exkursion durchquert auf drei Wanderungen das flözführende Ober - karbon der Wurmmulde nordwestlich der variszischen Front und endet in den känozoischen Sedimenten der Niederrheinischen Bucht. Neben dem NE–SW streichenden, variszischen Falten- und Überschiebungsgürtel werden die diskor- dant auflagernden oberkretazischen Sande und Karbonatgesteine des Lousbergs, die tertiären Küstensande des rückschreitenden Nordseebeckens sowie die quar- tären Terrassenschotter der Ost-Maas „angesprochen“. Dabei wird auch die Berg- baugeschichte der Region, 1353 urkundlich belegt und somit einer der ältesten Steinkohlebergbaue weltweit, diskutiert. Abstract This field trip crosses the coal-bearing Upper Carboniferous Wurm syncline NW of the Variscan front and ends at the Cenozoic sediments of the Lower Rhine embayment. It covers the NE–SW striking Variscan fold- and thrust belt, the uncon- formably overlying Upper Cretaceous sands and carbonate rocks of the Lousberg, the Tertiary coastal sands of the regressing North Sea basin and the Quaternary gra- vels of the East-Maas terraces. Meanwhile the history of mining, documented 1353 AD and thus one of the world’s oldest hard coal mine districts, is discussed. Schlüsselwörter: Varizische Tektonik, Steinkohle, tertiäre Sande, Diagenese Keywords: Variscan tectonics, hard coal, Tertiary sands, diagenesis 1Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. C. Hilgers, Institute of Reservoir-Petrology, RWTH Aachen, Wüllnerstr. -

Ordnungsbehördliche Verordnung Zur Festsetzung Des
Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes der Wurm zwischen der Stadt Heinsberg, der deutsch-niederländischen Grenze und der Stadt Aachen im Regierungsbezirk Köln BBB Überschwemmungsgebietsverordnung ```Wurm AAA BBB Das derzeit geltende Überschwemmungsgebiet der Wurm entspricht infolge von Ausbaumaßnahmen und anderen Abflussveränderungen nicht mehr den Gegebenheiten. Die Grenzen des Überschwemmungsgebietes der Wurm im Regierungsbezirk Köln sind daher von mir für ein 100-jährliches Hochwasserereignis ermittelt worden. Aufgrund B der '' 76 B78, 103 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz B WHG) vom 31. Juli 2009 in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2009 (BGBl. Teil I, Nr. 51 S. 2585 ff). B der '' 14 Abs. 3, 112 Abs. 1 Sätze 1 B3 und 5, 113 Abs. 2, 3, 5 und 6 B7, 114, 136, 138, 141, 161 und 167 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz B LWG) vom 25. Juni 1995 (GV. NRW S. 926/SGV NW 77) B der '' 12, 25, 27 bis 30, 31 und 33 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz B OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528/SGV. NRW. 2060), zuletzt geändert durch Artikel 9 vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 765/SGV. NRW. 060) sowie B '' 1 Abs. 2 Nr. 2, 4 und Ziffer 21.61 der Anlage II der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 2007 S. 662, ber. 14. Februar 2008 S. 155) SGV. NRW. 282 in der jeweils zurzeit geltenden Fassung wird verordnet: ''' 1 Grundlage und räumlicher Geltungsbereich ( 1 ) Das Überschwemmungsgebiet der Wurm wird neu festgesetzt. -

„WRRL-Umsetzungsfahrplan“ Für Das Einzugsgebiet Der Eifel-Rur Unterhalb Obermaubach
Programm Lebendige Gewässer Bericht „WRRL-Umsetzungsfahrplan“ für das Einzugsgebiet der Eifel-Rur unterhalb Obermaubach (Kooperationen: KOE_54, KOE_55, KOE_56 und KOE_57) Auftraggeber/Leitung der Regionalen Kooperationen: Wasserverband Eifel-Rur Auftragnehmer: Schulstraße 37 40721 Hilden Tel: 02103 / 90884-0 Fax: 02103 / 90884-19 Bearbeitung: Dipl.-Ing.(FH). Sebastian Döbbelt-Grüne Dipl.-Geogr. Christian Hartmann Dipl.-Ing.(FH) Dipl.-Ökol. Hans-Peter Henter Dipl.-Geogr. Christian Reuvers Dipl.-Geogr. Roman Rittner Dipl.-Ing. Sven Theophil Datum: 27.03.2012 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ........................................................................................................... 1 1.1 Grundlagen des Umsetzungsfahrplans ................................................................ 1 1.2 Abgrenzung des Planungsraums ......................................................................... 3 2 Vorgehensweise ................................................................................................ 5 2.1 Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept ................................................................. 7 2.2 Beteiligungsprozess ............................................................................................ 10 3 Charakterisierung des Planungsraums ........................................................ 16 3.1 Allgemeine Charakterisierung ............................................................................ 16 3.1.1 Mühlenteiche ................................................................................................... -
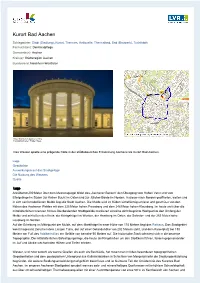
Kurort Bad Aachen
Kurort Bad Aachen Schlagwörter: Stadt (Siedlung), Kurort, Thermen, Heilquelle, Thermalbad, Bad (Bauwerk), Tuchfabrik Fachsicht(en): Denkmalpflege Gemeinde(n): Aachen Kreis(e): Städteregion Aachen Bundesland: Nordrhein-Westfalen Elisenbrunnen in Aachen (2015) Fotograf/Urheber: Holger Klaes .Das Wasser spielte eine prägende Rolle in der städtebaulichen Entwicklung Aachens als Kurort Bad Aachen. Lage Geschichte Auswirkungen auf das Stadtgefüge Die Nutzung des Wassers Quelle .Lage Annähernd 200 Meter über dem Meeresspiegel bildet das „Aachener Becken“ den Übergang vom Hohen Venn und vom Eifelgebirge im Süden zur Kölner Bucht im Osten und zur Jülicher Börde im Norden. In dieser nach Norden geöffneten, weiten und in sich sanft modellierten Mulde liegt die Stadt Aachen. Die Mulde wird im Süden sichelförmig umfasst und geschützt von den Höhen des Aachener Waldes mit dem 335 Meter hohen Preusberg und dem 348 Meter hohen Klausberg. Im heute weit über die mittelalterlichen Grenzen hinaus überbordenden Stadtgebilde markieren einzelne dicht begrünte Hochpunkte den Umfang der Mulde und schließen den Kreis: der Königshügel im Westen, der Haarberg im Osten, der Salvator- und der 263 Meter hohe Lousberg im Norden. Auf der Erhebung im Mittelpunkt der Mulde, auf dem Markthügel in einer Höhe von 174 Metern liegt das Rathaus. Das Stadtgebiet weist insgesamt zwischen dem Langen Turm, der auf einer Geländehöhe von 202 Metern steht, und dem Kaiserplatz bei 158 Metern am Fuß des Adalbertstiftes ein Gefälle von beinahe 50 Metern auf. Die historische Stadt schmiegt sich in die bewegte Topographie. Die mittelalterlichen Befestigungsringe, die heute als Ringstraßen um den Stadtkern führen, lassen gegeneinander im Auf und Ab die wechselnden Höhen und Tiefen erleben. -

Download.Geofabrik.De
Wolf et al. Environ Sci Eur (2021) 33:15 https://doi.org/10.1186/s12302-021-00460-8 RESEARCH Open Access Infuence of 200 years of water resource management on a typical central European river. Does industrialization straighten a river? Stefanie Wolf1* , Verena Esser2 , Holger Schüttrumpf1 and Frank Lehmkuhl2 Abstract Background: Over the last 200 years, the courses of most European rivers have experienced signifcant irreversible changes. These changes are connected to diferent kinds of anthropogenic river use and exploitation, which have varied from running water mills and rafting to large-scale hydroelectric power plants, industrial water withdrawal and food protection measures. Today, in most developed countries, water quality and ecological river development are important factors in water management. The aim of this study is to evaluate the specifc impacts of diferent time periods during the last 200 years on river courses and their efects on current river management using the example of the 165-km-long German Rur River (North Rhine-Westphalia). The Rur River is a typical central European upland-to- lowland river whose catchment has been afected by various phases of industrial development. Methods: In this study, a range of morphological changes over the last 200 years are determined based on historic maps and up-to-date orthophotos. River length, sinuosity, oxbow structures, sidearms and the number of islands are used to investigate human impact. The results are correlated with historic time periods. Results: This analysis shows that river straightening increases, especially during the Industrial Revolution, even with- out direct hydraulic channelization. The period and grade of river straightening have a direct morphodynamic impact on today’s river restorations.