Bilder-Recycling Mit Rubens
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

October 17, 2017 – January 21, 2018 Rubens the Power Of
OCTOBER 17, 2017 – RUBENS JANUARY 21, 2018 THE POWER OF TRANSFORMATION Peter Paul Rubens (1577–1640) was a star during his lifetime, and he remains a star today. His name is synonymous with an entire period, the Baroque. But his novel pictorial inventions continue to influence and appeal to artists. Now two leading museums, the Kunsthistorisches Museum Wien and the Städel Museum in Frankfurt, are hosting a major exhibition entitled “Rubens. The Power of Transformation”. The exhibition focuses on some little-studied aspects of Rubens’ creative process, illustrating the profound dialogue he entered into with works produced by other great masters, both precursors and contemporaries, and how this impacted his work over half a century. His use or referencing of works by various artists from different periods is generally not immediately apparent, and the exhibition invites visitors to discover these sometimes surprising correlations and connections by directly comparing the works in question. Comprising artworks in various media, the exhibition brings together paintings, drawings, prints, sculptures and objets d’art. Exemplary groups of works will demonstrate Rubens’ methods, which allowed him to dramatize well-known and popular as well as novel subject matters. This offers a fascinating glimpse into the genesis of his compositions and his surprising changes of motifs, but also how he struggled to find the perfect format and the ideal form. Rubens’ extensive œuvre reflects both the influence of classical sculpture and of paintings produced by artists - both in Italy and north of the Alps - from the late fifteenth century to the Baroque. Selected examples will help to illustrate the powerful creative effort that underpins Rubens’ compositions, and the reaction-chains they, in turn, set off in his artistic dialogue with his contemporaries. -

Marcia Pointon No
Marcia Pointon no. 79 2019 Peter Paul Rubens and the Mineral World If we think of early seventeenth-century European court por- traits, their surfaces spangled with jewels, we think above all of Frans Pourbus the Younger (1569–1622). When Rubens ar- rived at the Gonzaga court in 1600 Pourbus was offi cial court artist. Why Rubens went to Mantua is not known but he may, like Pourbus, have met the Duke on one of his many visits to Flanders.1 Despite frequent absences including a visit to Rome 1601–1602, a journey to Spain on behalf of the Duke in 1603 e-print and© a furtherIRSA period in Rome from 1606 until the last week of October 1608, he remained in the Duke’s service throughout his stay in Italy.2 The display of large quantities of precious stones that characterized Pourbus’s court portraits was less a fl attering fi ction of wealth than a requirement. Moreover an understanding (cognitio) of gems was regarded in the early modern period as a necessity for great princes and prelates who were expected to be able to identify stones and distinguish authentic from fake.3 Marie de’ Médicis, for whom Rubens would work later in his career, was typically knowledgeable about gem-stones: as the daughter of the Grand Duke Francesco I (1541–1587), a lapi- darist and practitioner in alchemical research, she had been taught gemmology.4 Rubens’s career following his sojourn in Mantua was so stellar that it is easy to forget that he was a part of this world in which precious stones were ornament, currency, magical, cosmogonic. -

Beleef De Vlaamse Meesters
BELEEF DE VLAAMSE MEESTERS PROGRAMMA 2018 - 2020 1 De gegevens in deze brochure kunnen wijzigen. Ga voor actuele informatie naar visitflanders.com/flemishmasterstrade. 2 VLAAMSE MEESTERS 2018-2020 OP HET HOOGTEPUNT VAN DE POSTMIDDELEEUWSE ARTIS- TIEKE VERNIEUWING WAS VLAANDEREN DE INSPIRATIEBRON ACHTER DE VERMAARDE KUNSTBEWEGINGEN VAN DIE TIJD: DE VLAAMSE PRIMITIEVEN, DE RENAISSANCE EN DE BAROK. 250 JAAR LANG WAS DEZE REGIO HET TREFPUNT OM DE ALLERGROOTSTE WEST-EUROPESE KUNSTENAARS TE ONT- MOETEN EN HUN WERK TE ZIEN. DRIE KUNSTENAARS IN HET BIJZONDER, VAN EYCK, BRUEGEL EN RUBENS, TRADEN PRO- MINENT OP DE VOORGROND EN VERWIERVEN HUN PLAATS AAN HET FIRMAMENT VAN DE ALLERGROOTSTE MEESTERS ALLER TIJDEN. 3 VLAANDEREN WAS TOEN EEN SMELTKROES VAN KUNST EN CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN UITVINDING. OOK NU NOG BRUIST DEZE REGIO VAN VITALITEIT EN VERNIEUWING. Het project “Vlaamse Meesters” is en werkte, de landschappen die is ongetwijfeld veel authentieker op poten gezet voor nieuwsgierige Pieter Bruegel de Oude inspireerden en indrukwekkender als je ze reizigers die graag over anderen en zien en een origineel schilderij van in Vlaanderen zelf ziet, waar de over zichzelf leren. Het is bestemd Eyck op de precieze plek van de kunstwerken tot leven kwamen. voor mensen die, net als de Vlaamse afgebeelde scène ontdekken. Vlaanderen investeert aanzienlijk Meesters in hun tijd, gretig nieuwe in toeristische infrastructuur culturen en nieuwe inzichten en cultuur zodat bezoekers een aftasten. PROJECT ‘VLAAMSE fantastische belevenis te wachten MEESTERS’ 2018-2020 staat. Verder organiseren we een Van 2018 tot 2020 organiseert programma vol kwaliteitsevents Toerisme Vlaanderen een hele reeks Het project ‘Vlaamse Meesters’ focust en tentoonstellingen met activiteiten en evenementen om op het leven en de nalatenschap van internationale weerklank in 2018, bezoekers van over de hele wereld Van Eyck, Bruegel en Rubens, actief 2019 en 2020. -

Vlaamse Meesters 2018-2020
VLAAMSE MEESTERS 2018-2020 BELEEF DE VLAAMSE MEESTERS PROGRAMMA 2018 - 2020 1 VLAAMSE MEESTERS 2018-2020 OP HET HOOGTEPUNT VAN DE POSTMIDDELEEUWSE ARTIS- TIEKE VERNIEUWING WAS VLAANDEREN DE INSPIRATIEBRON ACHTER DE VERMAARDE KUNSTBEWEGINGEN VAN DIE TIJD: DE VLAAMSE PRIMITIEVEN, DE RENAISSANCE EN DE BAROK. 250 JAAR LANG WAS DEZE REGIO HET TREFPUNT OM DE ALLERGROOTSTE WEST-EUROPESE KUNSTENAARS TE ONT- MOETEN EN HUN WERK TE ZIEN. DRIE KUNSTENAARS IN HET BIJZONDER, VAN EYCK, BRUEGEL EN RUBENS, TRADEN PRO- MINENT OP DE VOORGROND EN VERWIERVEN HUN PLAATS AAN HET FIRMAMENT VAN DE ALLERGROOTSTE MEESTERS ALLER TIJDEN. De gegevens in deze brochure kunnen wijzigen. Ga voor actuele informatie naar visitflanders.com of www.flemishmasters.com 2 3 NEDERLAND BRUGGE ANTWERPEN GENT MECHELEN BRUSSEL LEUVEN DUITSLAND FRANKRIJK WALLONIË VLAANDEREN WAS TOEN EEN SMELTKROES VAN KUNST EN CREATIVITEIT, WETENSCHAP EN UITVINDING. OOK NU NOG BRUIST DEZE REGIO VAN VITALITEIT EN VERNIEUWING. Het project “Vlaamse Meesters” is door het huis waar Rubens leefde Veel werken van deze Vlaamse DEZE DRIE HOOGTEPUNTEN Vlaamse primitieven, zoals Jan herfst van 2019 komt Bruegel op poten gezet voor nieuwsgierige en werkte, de landschappen die Meesters kun je over de hele wereld MAG JE NIET MISSEN: van Eycks “Heilige Barbara” en naar Antwerpen, waar het reizigers die graag over anderen en Pieter Bruegel de Oude inspireerden bewonderen, maar de ervaring “Madonna bij de fontein” en Ro- gerenoveerde Museum voor over zichzelf leren. Het is bestemd zien en een origineel schilderij van is ongetwijfeld veel authentieker 1. In 2018 viert de stad Antwerpen gier van der Weydens altaarstuk Schone Kunsten Antwerpen voor mensen die, net als de Vlaamse Eyck op de precieze plek van de en indrukwekkender als je ze haar barokke erfgoed en de “De zeven sacramenten”. -

HNA April 2016 Cover.Indd
historians of netherlandish art NEWSLETTER AND REVIEW OF BOOKS Dedicated to the Study of Netherlandish, German and Franco-Flemish Art and Architecture, 1350-1750 Vol. 33, No. 1 April 2016 Anthony van Dyck, Portrait of a Woman, ca. 1640. Oil on canvas, Speed Art Museum, Louisville (Kentucky); Museum Purchase, Preston Pope Satterwhite Fund Exhibited in Van Dyck: The Anatomy of Portraiture, The Frick Collection, New York, March 2 – June 5, 2016. HNA Newsletter, Vol. 23, No. 2, November 2006 1 historians of netherlandish art 23 S. Adelaide Avenue, Highland Park, NJ 08904 Telephone: (732) 937-8394 E-Mail: [email protected] www.hnanews.org Historians of Netherlandish Art Offi cers President – Amy Golahny (2013-2017) Lycoming College Williamsport PA 17701 Vice-President – Paul Crenshaw (2013-2017) Providence College Department of Art History 1 Cummingham Square Providence RI 02918-0001 Treasurer – David Levine Southern Connecticut State University 501 Crescent Street New Haven CT 06515 European Treasurer and Liaison - Fiona Healy Seminarstrasse 7 D-55127 Mainz Germany Board Members Contents Stephanie Dickey (2013-2017) Arthur DiFuria (2016-2020) President's Message .............................................................. 1 Walter Melion (2014-2018) Obituary ................................................................................. 1 Alexandra Onuf (2016-2020) HNA News ............................................................................2 Bret Rothstein (2016-2020) Gero Seelig (2014-2018) Personalia .............................................................................. -

In Situ Macro X-Ray Fluorescence (MA-XRF) Scanning As a Non-Invasive Tool to Probe for Subsurface Modifications in Paintings by PP Rubens
This item is the archived peer-reviewed author-version of: In situ macro X-ray fluorescence (MA-XRF) scanning as a non-invasive tool to probe for subsurface modifications in paintings by PP Rubens Reference: van der Snickt Geert, Legrand Stijn, Slama Ina, Van Zuien Eva, Gruber Gerlinde, Van der Stighelen Katlijne, Klaassen Lizet, Oberthaler Elke, Janssens Koen.- In situ macro X-ray fluorescence (MA-XRF) scanning as a non-invasive tool to probe for subsurface modifications in paintings by PP Rubens Microchemical journal - ISSN 0026-265X - 138(2018), p. 238-245 Full text (Publisher's DOI): https://doi.org/10.1016/J.MICROC.2018.01.019 To cite this reference: https://hdl.handle.net/10067/1515640151162165141 Institutional repository IRUA Accepted Manuscript In situ macro X-ray fluorescence (MA-XRF) scanning as a non- invasive tool to probe for subsurface modifications in paintings by P.P. Rubens Geert Van der Snickt, Stijn Legrand, Ina Slama, Eva Van Zuien, Gerlinde Gruber, Katlijne Van der Stighelen, Lizet Klaassen, Elke Oberthaler, Koen Janssens PII: S0026-265X(17)30877-9 DOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2018.01.019 Reference: MICROC 3011 To appear in: Microchemical Journal Received date: 3 September 2017 Revised date: 12 January 2018 Accepted date: 12 January 2018 Please cite this article as: Geert Van der Snickt, Stijn Legrand, Ina Slama, Eva Van Zuien, Gerlinde Gruber, Katlijne Van der Stighelen, Lizet Klaassen, Elke Oberthaler, Koen Janssens , In situ macro X-ray fluorescence (MA-XRF) scanning as a non-invasive tool to probe for subsurface modifications in paintings by P.P. -

Erleben Sie Die Flämischen Meister
ERLEBEN SIE DIE FLÄMISCHEN MEISTER PROGRAMM 2018 - 2020 1 Inhaltliche Änderungen der Broschüre vorbehalten. Für aktuelle Informationen besuchen Sie unsere Website: visitflanders.com/flemishmasterstrade 2 FLÄMISCHE MEISTER 2018-2020 FLANDERN WAR BEI DER KÜNSTLERISCHEN BILDFINDUNG AB DEM MITTELALTER FÜHREND UND INSPIRIERTE DIE BE- RÜHMTEN KUNSTRICHTUNGEN IN DIESER ZEIT: (FLÄMISCHE) PRIMITIVE, RENAISSANCE UND BAROCK. ÜBER 250 JAHRE KONNTE MAN HIER EINIGE DER AM MEISTEN BEWUNDER- TEN KÜNSTLER WESTEUROPAS ANTREFFEN UND ERLEBEN. INSBESONDERE DREI MALER - VAN EYCK, BRUEGEL UND RUBENS - ERLANGTEN IN DIESEM ZEITRAUM BEKANNTHEIT UND SCHUFEN SICH EINEN PLATZ IN DER RUHMESHALLE DER GRÖSSTEN MEISTER ALLER ZEITEN. 3 FLANDERN WAR DAMALS EIN SCHMELZTIEGEL VON KUNST UND KREATIVITÄT, WISSENSCHAFT UND ERFINDUNGSREICHTUM. UND NOCH HEUTE IST DIES EINE REGION, IN DER INNOVATION UND VITALITÄT BOOMEN. Das Projekt „Flämische Meister“ DAS PROJEKT durch das Haus spazieren, in dem wurde für den neugierigen Besucher „FLÄMISCHE MEISTER” Rubens gelebt und gearbeitet hat, konzipiert, der genauso gern etwas sie können in die Landschaften über andere erfährt, wie über sich 2018-2020 eintauchen, die Pieter Bruegel den selbst. Es ist für Menschen gedacht, Älteren inspiriert haben, und ein die - wie die flämischen Meister Das Projekt „Flämische Meister“ legt Original von Van Eyck an genau dem in ihrer Zeit - danach trachten, in seinen Schwerpunkt auf Leben und Ort entdecken, der auch im Gemälde neue Kulturen und Erkenntnisse Vermächtnis von Van Eyck, Bruegel zu sehen ist. einzutauchen. und Rubens - tätig im 15., 16. und 17. Jahrhundert - sowie vielen anderen Für ein eindrucksvolles Von 2018 bis 2020 ist VISITFLANDERS namenhaften Künstlern dieser Zeit. Besuchererlebnis werden in Gastgeber einer Fülle von Aktivitäten ganz Flandern beträchtliche und Veranstaltungen, die Besucher Viele Werke dieser ursprünglich Investitionen in die Tourismus- aus aller Welt verleiten werden, die flämischen Meister sind rund um und Kulturinfrastruktur getätigt. -

OCTOBER 17, 2017 – JANUARY 21, 2018 RUBENS the POWER of TRANSFORMATION an Exhibition Organised by the Kunsthistorisches Museu
OCTOBER 17, 2017 – RUBENS JANUARY 21, 2018 THE POWER OF TRANSFORMATION An exhibition organised by the Kunsthistorisches Museum Vienna and the Städel Museum, Frankfurt Peter Paul Rubens (1577–1640) was a star during his lifetime, and he remains a star today. His name is synonymous with an entire period in art history, the Baroque, but contemporary art too cannot ignore him. The extraordinary œuvre of this artistic genius comprises large-scale altarpieces more dynamic and full of coloristic punch than anything produced by his contemporaries, as well as sensual nudes and dramatic compositions. But Rubens is also renowned for his intimate and private paintings, such as his celebrated “The Fur” now in the Kunsthistorisches Museum Vienna; it is the artist’s declaration of his love for his beautiful second wife, Hélène Fourment. And “Stormy Landscape with Philemon and Baucis”, a painting Rubens probably began because he became interested in the problems of depicting landscape and which he continued to work on throughout his life, is a magnificent and vibrant composition. This special exhibition invites visitors to see these and other masterpieces now in Vienna in the context of Rubens’ preparatory drawings, oil sketches, panel paintings and canvases. The works on show – among them around seventy loans from the world’s foremost collections such as the State Hermitage Museum in St. Petersburg, the Prado in Madrid or the National Gallery of Art in Washington D.C. – have been carefully selected to create juxtapositions and confrontations that document how Rubens worked, how he created his vivid, carefully contrived artworks. The show thus focuses on the most fascinating aspect of Rubens’ art: his critical analysis and use of external sources and ideas. -
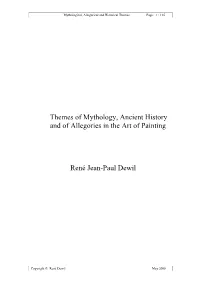
Mythological and Historical Themes
Mythological, Allegorical and Historical Themes Page: 1 / 125 Themes of Mythology, Ancient History and of Allegories in the Art of Painting René Jean-Paul Dewil Copyright © René Dewil May 2008 Mythological, Allegorical and Historical Themes Page: 2 / 125 Copyright Clause Copyright © René Jean-Paul Dewil 2008 René Jean-Paul Dewil is identified as the sole author of this work. All rights reserved. No part of this publication may be altered without the written permission of the author. The ebook may be copied in electronic or other forms for personal use only. It may not be printed, introduced in any retrieval system, electronic or otherwise, photocopied or otherwise recorded without the prior written permission of the author. The only system where the ebook may be retrieved from is the Internet website www.theartofpainting.be, which holds the only and original text acknowledged by the author. This publication remains under copyright. Copyright © René Dewil May 2008 Mythological, Allegorical and Historical Themes Page: 3 / 125 Introduction Painters have used many mythological themes as well as themes of history. The aim of the following is to classify the paintings according to those themes and sub-themes. The paintings are classified according to main themes, called macro themes, and then they are further classified within each macro theme to micro themes. The themes have been discovered by the classification of tens of thousands of paintings presented in the main museum of the world. A list of these paintings, plus their classification in macro themes and micro themes is available in Microsoft Excel © spreadsheet format (see the Internet site www.theartofpainting.be ). -

Van Achilleus Tot Zeus. Thema's Uit De Klassieke Mythologie in Literatuur, Muziek, Beeldende Kunst En Theater
Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve bron Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. SUN, Nijmegen 1995 (5de, herziene en vermeerderde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moor028vana01_01/colofon.php © 2017 dbnl / Eric M. Moormann / Wilfried Uitterhoeve 5 Verantwoording Mythen, vertellingen over goden, halfgoden en legendarische stervelingen, hadden in de oudheid vele functies. Ze verschaften verklaringen voor het ontstaan van wereld en mensdom, voor natuurverschijnselen, voor de oorsprong van steden en volkeren en voor de genealogie van belangrijke geslachten. Ze dienden als uitdrukking van het religieuze denken en van de reflectie op het menselijk bestaan en op de contradicties ervan. Ze waren vehikel voor de inprenting van moraal, onuitputtelijke bron voor poëzie en epos, soms zelfs instrument van staatspropaganda. Deze veelzijdigheid van functie verklaart dat de mythen in de antieke cultuur alomtegenwoordig waren, en dat zij als het ware een stramien vormden waarop voortdurend nieuwe varianten werden geweven. Mythologie is dan ook niet voor niets object geworden van zoveel disciplines: godsdienstgeschiedenis, antropologie, kunsten literatuurgeschiedenis, psychoanalyse. We zullen niet al deze paden, varianten en interpretaties volgen. Wel menen we aan het karakter van de mythe, een stramien immers en niet een ‘eindtekst’, recht te doen door in de weergave van de mythe meer aandacht te schenken aan de varianten in het verhaal dan in beknopte beschrijvingen gebruikelijk is. We hebben de belangrijkste mythen geordend in 134 uiteenzettingen rond de belangrijkste gestalten: van Achilleus tot Zeus. -

Administratieve Bijlagen Bij Het Jaarverslag 2018 Van Het KIK
Administratieve bijlagen bij het jaarverslag 2018 van het KIK Annexes administratives du rapport annuel 2018 de l’IRPA TABLE DES MATIÈRES / INHOUDSTAFEL DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES OPERATIONELEN DIRECTIES I. Département documentation Departement documentatie Documentation photographique 4 Foto documentatie Infothèque 18 Infotheek Cellule imagerie 20 Cel beeldvorming Cellule recherche en histoire de l’art et inventaire 28 Cel kunsthistorish onderzoek en inventaris Centre d’étude des Primitifs flamands 43 Studiecentrum Vlaamse Primitieven II. Département Laboratoires Departement Laboratoria Labo de datation radiocarbone 44 Labo radiokoolstofdatering Labo des métaux 47 Labo metaal Labo des verres 49 Labo glas Labo des monuments et décors monumentaux 51 Labo monumenten en monumentale decoratie Labo des peintures 66 Labo schilderkunst Labo des papiers, cuirs et parchemins 78 Labo papier, leder en perkament Labo des textiles 83 Labo textiel Labo dendrochronologie 89 Labo des polychromies 99 Labo polychromie III. Département Conservation-Restauration Departement Conservatie-Restauratie Atelier des sculptures en pierre 103 Atelier steensculptuur Atelier des verres 109 Atelier glas Cellule des décors de monuments 114 Cel decoratie van monumenten Atelier des peintures 118 Atelier schilderkunst Atelier des textiles 129 Atelier textiel Atelier des sculptures en bois polychromé 136 Atelier polychrome houtsculptuur Cellule de conservation préventive 141 Cel preventie conservatie Atelier des peintures murales 145 Atelier muurschilderkunst p. 2 / 178 -

1 Peter Paul Rubens and the Mineral World Marcia Pointon
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Norwich University of the Arts Repository 1 Peter Paul Rubens and the mineral world Marcia Pointon If we think of early seventeenth-century European court portraits, their surfaces spangled with jewels, we think above all of Frans Pourbus the Younger (1569-1622). When Rubens arrived at the Gonzaga court in 1600 Pourbus was official court artist. Why Rubens went to Mantua is not known but he may, like Pourbus, have met the Duke on one of his many visits to Flanders. 1 Despite frequent absences including a visit to Rome 1601-2, a journey to Spain on behalf of the Duke in 1603 and a further period in Rome from 1606 until the last week of October 1608, he remained in the Duke’s service throughout his stay in Italy.2 The display of large quantities of precious stones that characterized Pourbus’s court portraits was less a flattering fiction of wealth than a requirement. Moreover an understanding (cognito) of gems was regarded in the early modern period as a necessity for great princes and prelates who were expected to be able to identify stones and distinguish authentic from fake. 3 Marie de’ Médicis, for whom Rubens would work later in his career, was typically knowledgeable about gem-stones: as the daughter of the Grand Duke Francesco I (1541-1587), a lapidarist and practitioner in alchemical research, she had been taught gemmology.4 Rubens’s career following his sojourn in Mantua was so stellar that it is easy to forget that he was a part of this world in which precious stones were ornament, currency, magical, cosmogonic.