Über Wildhaus Nach Einsiedeln
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
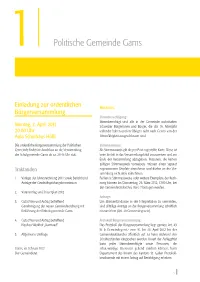
1 Politische Gemeinde Gams
1 Politische Gemeinde Gams Einladung zur ordentlichen Hinweise: Bürgerversammlung Stimmberechtigung: Stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde wohnhaften Montag, 2. April 2012 Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die das 18. Altersjahr 20.00 Uhr vollendet haben und im Übrigen nicht nach Gesetz von der Aula Schulhaus Höfli Stimmfähigkeit ausgeschlossen sind. Die ordentliche Bürgerversammlung der Politischen Stimmausweise: Gemeinde findet im Anschluss an die Versammlung Als Stimmausweis gilt die per Post zugestellte Karte. Diese ist der Schulgemeinde Gams ab ca. 20.45 Uhr statt. beim Eintritt in das Versammlungslokal vorzuweisen und am Ende der Versammlung abzugeben. Personen, die keinen gültigen Stimmausweis vorweisen, müssen einen separat Traktanden zugewiesenen Sitzplatz einnehmen und dürfen an der Ver - sammlung nicht aktiv teilnehmen. 1. Vorlage der Jahresrechnung 2011 sowie Bericht und Fehlende Stimmausweise oder weitere Exemplare der Rech - Anträge der Geschäftsprüfungskommission nung können bis Donnerstag, 29. März 2012, 17.00 Uhr, bei der Gemeinderatskanzlei, Büro 7 bezogen werden. 2. Voranschlag und Steuerplan 2012 Anträge: 3. Gutachten und Antrag betreffend Um Missverständnisse in der Interpretation zu vermeiden, Genehmigung der neuen Gemeindeordnung mit sind allfällige Anträge an der Bürgerversammlung schriftlich Einführung der Einheitsgemeinde Gams einzureichen (Art. 39 Gemeindegesetz). 4. Gutachten und Antrag betreffend Protokoll Bürgerversammlung: Neubau Werkhof „Karmaad“ Das Protokoll der Bürgerversammlung liegt gemäss Art. 49 lit. b Gemeindegesetz vom 16. bis 30. April 2012 bei der 5. Allgemeine Umfrage Gemeinderatskanzlei öffentlich auf. Es kann während den Schalterstunden eingesehen werden. Innert der Auflagefrist kann jeder Stimmberechtigte sowie Personen, die Gams, im Februar 2012 schutzwürdige Interessen geltend machen können, beim Der Gemeinderat Departement des Innern des Kantons St. Gallen Protokoll - beschwerde mit einem Antrag auf Berichtigung erheben. -

Terza Schiessen 2019 SV Quarten-Oberterzen
Terza Schiessen 2019 SV Quarten-Oberterzen Amden, Schützen Gmür Ivo Obdorfstr. 9 8873 Amden Vereinsabrechnung Vereinswettkampf Vereinskategorie 1 Vereinsschützen / Pflichtteilnehmer 28 / 14 Pflichtteilnehmer Gmür Benedikt V 57-03 95 Gmür Rolf S 57-03 95 Büsser Elmar V 57-03 95 Gmür Peter E 57-03 94 Bachmann Peter E 57-03 94 Gmür Roman E 90 94 Gmür Reto E 57-03 93 Thoma Franz SV 57-03 93 Gmür Ivo E 90 93 Gmür Urs S 57-03 93 Büsser Ivan S 90 92 Büsser Mario V 57-03 92 Büsser Max V 57-03 92 Gmür Alois V 57-03 92 1307 Nicht-Pflichtteilnehmer Gmür Benjamin S 90 91 Büsser Hanspeter E 57-03 91 Gmür Stefan E 57-03 90 Thoma Karl SV 57-03 90 Thoma Werner V 90 90 Gmür Max SV 57-03 88 Rüdisüli Markus E 90 87 Rüdisüli Koni V 57-03 87 Thoma Edgar S 90 86 Thoma Gallus SV 90 86 Gmür Albin SV 57-03 86 Thoma Toni V 90 85 VereinsWK 3.8 copyright by Indoor Swiss Shooting AG, 9200 Gossau www.IndoorSwiss.ch Terza Schiessen 2019 SV Quarten-Oberterzen Gmür Ralph E 57-03 84 Spörri Hans V 57-03 67 1208 Pflichtresultat +Zuschlag Nichtpflichtresultate / Pflichtteilnehmer = Resultat 1307 24.160 14 95.083 VereinsWK 3.8 copyright by Indoor Swiss Shooting AG, 9200 Gossau www.IndoorSwiss.ch Terza Schiessen 2019 SV Quarten-Oberterzen Einzelresultate Sportgerät Resultat Auszeichnung Auszahlung 225502, Bachmann Peter, Amden, 1977, E Vereinsstich 57-03 94 Honig 138204, Büsser Elmar, Schänis, 1959, V Vereinsstich 57-03 95 Honig Mouchen-Joker 57-03 96 Ja 138193, Büsser Hanspeter, Amden, 1975, E Vereinsstich 57-03 91 Kranzkarte Mouchen-Joker 57-03 95 138202, Büsser Ivan, Amden, -
Ung Und Nterhaltung
Nationale Hauptsponsoren ECHTE ERFRISCHUNG UND SPIELERISCHE UNTERHALTUNG MIT RIVELLA Besuche uns mit der ganzen Fami- lie in den drei Rivella-Zonen! Stell dein Geschick beim Ballspiel unter Nationaler Sponsor Beweis, gewinne eine Saisonliefe- rung Rivella und nimm an unserer Hauptverlosung für eines von drei Regionaler Hauptsponsor exklusiven Ri-Velo‘s teil! Posiere für ein tolles Foto, zeige uns dein Regionale Können beim Rivella Rennspiel, Partner sorge mit unserem Maskottchen „Rivellino“ für gute Stimmung und hole dir beim Streckensampling ein erfrischendes Rivella ab. Nationale Trägerschaft #slowUp Sonntag, 3. Mai 2020 10 bis 17 Uhr | 44 km 15. slowUp Werdenberg-Liechtenstein, 3. Mai 2020 15. slowUp Werdenberg-Liechtenstein, – 15 Hauptpreise 15’000 Lose – 1’500 Sofortpreise Grusswort IHR BOXENSTOPP Der slowUp ist cool Ich als Spitzensportlerin trainiere den ganzen Sommer lang zum AM SLOWUP Beispiel auf dem Velo, beim Joggen oder im Krafttraum. Es ist nicht immer toll, meine Kilometer abzuarbeiten und zu schwitzen. Andererseits geniesse ich es, an einem strahlenden Sommer tag Gratis-Reparaturservice von SportXX. mit meinem Fahrrad eine Trainingsrunde zu absolvieren. Nutzen Sie am slowUp unseren kosten- Aus eigener Erfahrung kenne ich auch die Risiken im Strassen- losen Reparaturservice. Verrechnet verkehr mit Hektik und wenig Platz für alle Verkehrsteilnehmen- den. Darum freue ich mich jedes Jahr auf den slowUp. Da gibt es wird nur das verwendete Material. nicht nur autofreie Strassen, es hat auch zahlreiche Essensstände, Gute Fahrt und viel Spass! an welchen man sich verpflegen und neue Energie tanken kann. Oder profitieren Zudem trifft man Bekannte und schliesst neue Freundschaften. Sie in unseren Darum finde ich es cool, an diesem Tag das Velo aus der Garage Filialen vom grossen zu holen und einige Kilometer abzustrampeln. -

Qualifikation JS Cup 2019 RSV See-Gaster Schmerikon
Qualifikation JS Cup 2019 RSV See-Gaster Schmerikon R Namen Vornamen Verein Resultat 1 Büsser Sarina Weesen, SV 867 2 Schmucki Silja Weesen, SV 867 3 Schönenberger Barbara Ricken SG 859 4 Gmür Rahel Weesen, SV 854 5 Hämmerli Rico Weesen, SV 845 6 Meier Christian Rufi-Maseltrangen MSV 838 7 Nievergelt Janis Schmerikon SV 836 8 Müller Flurin Eschenbach-Neuhaus SG 828 9 Kostenzer Sandro Gommiswald SV 826 10 Kaufmann Claudio Rufi-Maseltrangen MSV 821 11 Schmucki Lara Weesen, SV 814 12 Rieser Jeremias Weesen, SV 812 13 Eichmann Linda Ricken SG 799 14 Meier Eliane Rufi-Maseltrangen MSV 798 15 Kaufmann Jonas Gommiswald SV 790 16 Bösch Philipp Gommiswald SV 789 17 Müller Levin Weesen, SV 789 18 Miyatani Stefanie Weesen, SV 775 19 Forrer Gabriela Ricken SG 774 20 Bürge Mattia Uznach SV 765 21 Schmucki Norea Weesen, SV 763 22 Bösch Iris Uznach SV 762 23 Miyatani Ondine Weesen, SV 759 24 Büsser Chrys Eschenbach-Neuhaus SG 757 25 Zedan Seneddin Rapperswil STDS 755 26 Kaufmann Andreas Rufi-Maseltrangen MSV 754 27 Ruoss Tobias Gommiswald SV 753 28 Weissen Flurin Eschenbach-Neuhaus SG 752 29 Britt Ramon Ricken SG 752 30 Läubli Robin Ricken SG 751 31 Britt Jasmin Ricken SG 733 32 Rüdisüli Markus Amden Schützen 730 33 Schönenberger Katharina Ricken SG 728 34 Hegner Ivo Rufi-Maseltrangen MSV 728 35 Menzli Janine Schmerikon SV 727 36 Schubiger Björn Gommiswald SV 725 37 Oehninger Nadjne Eschenbach-Neuhaus SG 724 38 Oberle Patricia Schmerikon SV 707 39 Kuhn Nijal Amden Schützen 704 40 Rupflin Leonie Rufi-Maseltrangen MSV 704 41 Blöchlinger Kilian Eschenbach-Neuhaus -

Gams-Wettibach.Ch
www.gams-wettibach.ch Hutter & Partner Immobilientreuhand AG | Geschäftshaus FARO | Hauptstrasse 65 | CH-9401 Rorschach | Tel. +41 71 845 49 49 | www.hutterundpartner.ch INHALT 3 GAMS 4 ORTSPLAN 5 SITUATION 6 AUSSENVISUALISIERUNG 7 ERDGESCHOSS 8 1. OBERGESCHOSS 9 2. OBERGESCHOSS 10 ATTIKAGESCHOSS 11 UNTERGESCHOSS 12 KURZBAUBESCHRIEB 13 VORTEILE AUF EINEN BLICK 14 MIETPREISE 15 KONTAKTDATEN 2 Überbauung WETTIBACH GAMS GAMS Gams – ländlich, lebendig und lebenswert Zahlen / Fakten Die kleine aber feine Gemeinde liegt am Fusse des Alpsteins und überzeugt Lage: mit überschaubaren Strukturen und einer sehr stark ausgeprägten Rheintal, Werdenberg Dorfgemeinschaft. Das abwechslungsreiche Dorfleben wird zu einem 478 m ü.M. grossen Teil von den diversen Vereinen und den örtlichen Institutionen getragen. Wovon andere nur träumen können, das hat Gams. Eine Verkehrsverbindungen: vorzügliche Wohnlage mit langer Sonnenscheindauer mit direktem Autobahn A13, Bus/Postauto Anschluss an ein weitläufiges und vielfältiges Erholungsgebiet. Kanton: Das Dorfzentrum liegt in unmittelbarer Nähe zu der Überbauung und bietet St. Gallen alles, was für den täglichen Bedarf benötigt wird. In den anliegenden Gemeinden Buchs und Haag bieten zudem diverse Einkaufszentren und Wahlkreis: Shoppingmeilen alles was man sonst noch so braucht. Auch Werdenberg Verkehrstechnisch ist die Überbauung bestens erschlossen. 5 Gehminuten entfernt liegt der Busbahnhof und in 5 Fahrminuten befinden Sie sich bereits Nachbargemeinden: auf der Autobahn A13. Sennwald, Buchs Grabs, Wildhaus Die schöne und gut erschlossene Lage, die modernen Infrastrukturen, das Fläche: Bildungsangebot vom Kindergarten bis zur Oberstufe, ein attraktives 22.26 km2 Naherholungsgebiet und das vielfältige Angebot in der Gemeinde machen Gams zu einem beliebten Wohnort, was sich auch an der stetig wachsenden Einwohner: Wohnbevölkerung zeigt. -

Erstkommunion, Festtag Für Amden, in Weiss
- Hallenbad Eröffnungs fest 22. Juni Die Zeitung der Gemeinde Amden Herausgeber: Gemeinde Amden Nr. 6 / Juni 2019 www.gemeinde-amden.ch Nr. 250 Erstkommunion, Festtag für Amden, in Weiss Der Weisse Sonntag ist ein Fest für die zwei Buben und drei Mädchen aus Am- den. Die Sonnenstrahlen fehlen an diesem winterlichen Maitag, dafür blickt Pfarrer Victor Buner, wie er bei der Eröffnung sagt, in viele frühlingshafte Gesichter. Von Cornelia Rutz Die Musikgesellschaft Amden hält sich für einmal auf der Empore bereit. Das Wetter ist zu nass und zu kalt für die feierliche Prozes- sion zur Kirche. Schneeflocken dominieren an diesem Tag. Freunde, Verwandte und Be- kannte warten in der Kirche an der Wärme auf die fünf Erstkommunikanten. Mit der brennenden Taufkerze in der Hand – festlich gekleidet in eleganten weissen Röcken und passendem Haarschmuck die Mädchen, mit bestickten Ammler Küttis die zwei Knaben – schreiten die Erstkommunikanten erwar- tungsvoll Richtung Altar. Das Bild des Hir- ten, welches vor der Renovation der Kirche über dem Hochaltar war, ist extra für diesen Tag aufgestellt worden. «Der gute Hirte» ist Die Erstkommunikanten mit Doris Santavenere und Pfarrer Victor Buner. (vl) Franco Böni, das Motto an diesem Weissen Sonntag. «Ar- Fabian Fischli, Carla Rüdisüli, Carina Jöhl und Riana Jöhl beit ist nicht die erste Bestimmung Gottes. Bild: Cornelia Rutz Wir sehen Kerzen, Blumen, festliche Ge- wänder. Musik und Gesang begleiten uns an diesem Tag. Auch Jesus hat gefeiert mit sei- klässler auf den grossen Festtag vorbereitet. nen Jüngern. Deshalb dürfen wir hier in der In Quarten im Zentrum Neu-Schönstatt ha- Kirche die Eucharistie feiern und sind Jesus ben sich die Kinder mit ihren Eltern zudem In dieser Ausgabe: so jedes Mal ganz nahe und spüren seine an zwei Tagen auf den Weissen Sonntag spe- Kolumne 8 Gegenwart», erläutert Pfarrer Victor Buner. -

Meeting Planner 2019
Meeting planner 2019 Ideas for meetings & congresses in Eastern Switzerland Meeting planner 2019 Need more inspiration? Just visit our plattform: www.st.gallen-convention.ch Fresh ideas, surprising offers, daily updates. For congresses. For meetings. For events. For social activities. For your event. St.Gallen-Bodensee Tourismus Convention Bureau Bankgasse 9 CH-9001 St.Gallen T +41 71 227 37 32 F +41 71 227 37 67 [email protected] www.st.gallen-convention.ch st.gallen-convention.ch Gratis spielen, 10’000 CHF und grosser Jackpot zu gewinnen. Unterhaltung Gambling Night mit DJ/Live Music. www.swisscasinos.ch www.st.gallen-convention.ch | 1 Conferences in Eastern Switzerland – let us explore it together. A retreat in monastic seclusion, a large convention in the city of St.Gallen or a seminar in maritime surroundings: we know Eastern Switzerland like the back of our hand and will find the right conference venue and social programme for you. Passion, personal dedication, a knack for recognising new and innovative ideas and a love of the destination: that is what makes our team so special. We would be happy to put our experience and local expertise at your disposal to help organise your event. Whether convention, seminar, event or social programme – we set you up with the right local partners. This is the key to suc- cess. We focus on your individual needs. They are our highest priority. After all, you want your event to be an unforgettable experience for your guests – in beautiful Eastern Switzerland. We offer you compe- tance, expertise and a single local contact, all from a single source. -

Blick in Vergangenheit Und Zukunft Mit the Servelats
Die Zeitung der Gemeinde Amden Herausgeber: Gemeinde Amden Nr. 3 / März 2020 www.gemeinde-amden.ch Nr. 259 Blick in Vergangenheit und Zukunft mit The Servelats The Servelats, die Schnitzelbank-Grup- pe, kündigte mit «Schnitzelbängg10» die Jubiläums-Ausgabe an. Was die hoch- musikalische siebenköpfige Männergrup- pe im Jahr 2019 erfahren und zu Versen verarbeitet hat, haben die Ammler am Schmudo erfahren. Von Rita Rüdisüli Sie haben die Ammler Fasnacht wiederbe- lebt. Zusammen mit anderen Fasnachts- gruppen - z.B. den Ammler Wibern, den Vorderberg Piraten und den bunten Lolli- pops - sorgen sie Jahr für Jahr für Unter- haltung im Dorf, im Altersheim und privat. In gedruckter Form gibt es die vielfältigen Schnitzelbank-Verse seit dem Jahr 2013. Damals haben sich fünf junge, unterneh- mungslustige, musikalische Männer mit dem damaligen Maskottchen der Ammler Zitig, dem berühmten Amm-Li verbr(l) üder(l)t. Thematisiert wurden darin des The Servelats unterstützen künftig an Pilztagen die Feuerwehr von Amden. hinten (vl) Michi Försters Käfer-Christbäume, das neue Er- Frepp, Mario Figallo, Ignaz Gmür, Peter Rüdisüli, vorne (vl) Marc Thoma, Tobias Gmür, lebnisbad, Skiclub-Fotos und die flianische Hanspeter Büsser Bild: zvg Fedi-Verkehrsberuhigung. Offensichtlich kamen nicht alle Servelats-Verse gut an, dem Rotlicht-Skandal im Tempelbezirk, Nun zierten neben den witzigen Sprüchen denn im Folgejahr trat das Team in Sträf- rutschenden Autos im Oktoberschnee und auch nicht ganz ernstzunehmende Inserate lingskleidung als Schnitzelknacker auf. Mit einem in Schieflage geratenen Hochsitz die Fasnachts-Zitig. Ob wirklich jemand brachten sie die Leute trotzdem zum La- seine Sense gegen den ferngesteuerten Mo- chen. Neues aus Schlumpfhausen gab es tormäher eintauschte, ist unbekannt. -
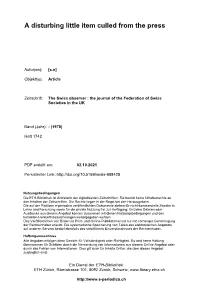
A Disturbing Little Item Culled from the Press
A disturbing little item culled from the press Autor(en): [s.n] Objekttyp: Article Zeitschrift: The Swiss observer : the journal of the Federation of Swiss Societies in the UK Band (Jahr): - (1978) Heft 1742 PDF erstellt am: 02.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-688428 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch A DISTURBING LITTLE ITEM CULLED FROM THE PRESS WEATHERS We are grafe/w/ fo Die Tat and by sending a teacher, at Government its London correxpo«c/enf Dr. H G. from Vienna. A/exander /or /he kind permission to expense, According to the article, an enquiry From 20th April Swissair's DC-10s pwWisii tin's rat/îer t/jow^/if provoking- the school the Swiss will be able to land at Zürich under iitt/e artic/e. -

Earthquakes in Switzerland and Surrounding Regions During 2009
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by RERO DOC Digital Library Swiss J Geosci (2010) 103:535–549 DOI 10.1007/s00015-010-0039-8 Earthquakes in Switzerland and surrounding regions during 2009 Nicholas Deichmann • John Clinton • Stephan Husen • Benjamin Edwards • Florian Haslinger • Donat Fa¨h • Domenico Giardini • Philipp Ka¨stli • Urs Kradolfer • Iris Marschall • Stefan Wiemer Received: 6 October 2010 / Accepted: 18 October 2010 / Published online: 30 November 2010 Ó Swiss Geological Society 2010 Abstract This report of the Swiss Seismological Service (ML 3.5) ereignet. Mit nur 24 Beben der Magnitude summarizes the seismic activity in Switzerland and sur- ML C 2.5, lag die seismische Aktivita¨t im Jahr 2009 im rounding regions during 2009. During this period, 450 Durchschnitt der vorhergehenden 34 Jahre. earthquakes and 68 quarry blasts were detected and located in the region under consideration. The three strongest events occurred about 15 km NW of Basel in southern Germany (ML 4.2), near Wildhaus in the Toggenburg (ML Re´sume´ Le pre´sent rapport du Service Sismologique 4.0) and near Bivio in Graubu¨nden (ML 3.5). Although felt Suisse re´sume l’activite´ sismique en Suisse et dans les by the population, they were not reported to have caused re´gions limitrophes au cours de l’anne´e 2009. Durant cette any damage. With a total of 24 events with ML C 2.5, the pe´riode, 450 tremblements de terre et 68 tirs de carrie`re ont seismic activity in the year 2009 was close to the average e´te´ de´tecte´s et localise´s dans la re´gion conside´re´e. -
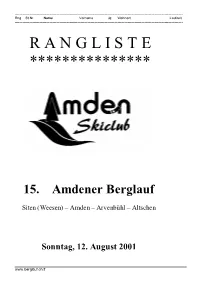
R a N G L I S T E ***************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rng St.Nr. Name Vorname Jg Wohnort Laufzeit ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R A N G L I S T E *************** 15. Amdener Berglauf Siten (Weesen) – Amden – Arvenbühl – Altschen Sonntag, 12. August 2001 www.berglauf.ch.tf ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rng St.Nr. Name Vorname Jg Wohnort Laufzeit ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sponsoren & Gönner Architekturbüro Hans Jöhl, Hagstr. 3, 8873 Amden Arondo AG, Hauptstr. 54, 8868 Oberurnen Bäckerei/Konditorei Amman, Oberrütelistr. 7, 8753 Mollis Bartel-Druckerei, Bahnhofstr. 15, 8750 Glarus Blumengeschäft Strub, Spittelstr. 24, 8872 Weesen Cafe Post, Dorfstr., 8873 Amden CSS-Versicherung, Dorfstr.1, 8873 Amden Drogerie Kundert, Dorfstr., 8873 Amden Eberle Sport AG, Bahnhofstr. 22, 8753 Mollis Eberle Sporthus, Hinterbergstr. 2, 8873 Amden Electrotex AG, Landstr. 54, 8868 Oberurnen Elektro B, Dorfstr. 23, 8873 Amden Fridolin-Sport, Bankstr. 46, 8750 Glarus Gebr. Thoma, Hofstettenstr. 10, 8873 Amden Gmür Benjamin, Kundenmaurer, Arvenbüehlstr. 24, 8873 Amden Gmür Urs, Keram. Plattenbeläge, Natursteinarbeiten, -
Sportwoche Flyer 2021
MEDIENPARTNER 21 0 2 www.sportwoche.ch www.sportwoche.li www.sportwoche.ch CAMPUS UND SPEZIALKURSE Sieger von morgen bewegen sich heute Sportvielfalt im Paket – die individuelle Freizeitgestaltung in der Ferienregion web soluǗons SOMMER 2021 – 09.08. bis 13.08.2021 505 Polysportives Lager Special Olympics LIE – Jg. 2003–2009, 08.30–16.00. Kosten CHF 50.–, Schaan 502 Campus Mountainbike Region – ab Jahrgang 2010. Mit dem Bike unterwegs in einer einmaligen Region, auf 509 SLRG-Brevetweb App – Kombikurs soluǗons ab 14. Geburtstag, faszinierenden Wegen, Touren. Herausforderungen kennen- Brevet Plus Pool und BLS/AED Grundkurs; Kursdauer 6 lernen und meistern. Kosten inkl. Mittagessen CHF 250.–. Halbtage; Kosten: CHF 300.–, inkl. Gebühren, Mels 503 Kunstturnen App – Mels – turnerisches Können auf 584 Golf App – 09.00 Bad Ragaz, Kosten CHF 140.–, ab hohem Niveau, Trainingscamp für ambitionierte Turner. Jg. 2009, Einführung in den Golfsport, Technik und Regeln, 09. bis 13.08.2021. Kosten CHF 120.– Spiel; Chipping, Pitching und Putten, Routine Drive, Abschlag von der Driving Range, Golf-ABC, Leitung Golf Pro, Bad Ragaz 504 Geräteturnen App – Verein Kadertraining reser- viert – 13.00–17.00 Uhr. Kosten CHF 80.– HERBST 2021 – 18.10. bis 22.10.2021 COMMITMENTS 602 Mountainbike – Jg. 2011–2013, 09.00 – 11.45, Kos- 1. Ich respektiere meine Leiter und halte mich an ihre ten: CHF 105.–, Sarganserland Anweisungen. 2. Ich bin hilfsbereit und gehe respektvoll mit allen Teilnehmern um. Jugendsportcamps des Kantons St. Gallen findest du unter www.sport.sg.ch, weitere vielfältige Kulturangebote fin- 3. Ich verhalte mich fair und bin bereit, mich in der dest du auch unter www.suedkulturpass.ch.