Dresdner Heldenbuch‘
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
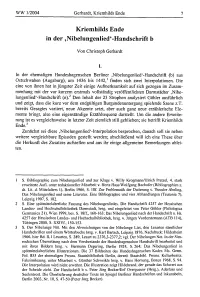
Handschrift B
WW 1/2004 Gerhardt, Kriemhilds Ende 7 Kriemhilds Ende in der ,NibeIungenlied'-Handschrift b Von Christoph Gerhardt I. In der ehemaligen Hundeshagenschen Berliner ,Nibelungenlied'-Handschrift (b) aus Ostschwaben (Augsburg), um 1436 bis 1442,' finden sich zwei Interpolationen. Die eine von ihnen hat in jüngster Zeit einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen im Zusam menhang mit der vor kurzem erstmals vollständig veröffentlichten Darmstädter ,Nibe- lungenlied'-Handschrift (n).2 Den Inhalt der 23 Strophen analysiert Göhler ausführlich und zeigt, dass die kurz vor dem endgültigen Burgundenuntergang spielende Szene z.T. bereits Gesagtes variiert, neue Akzente setzt, aber auch ganz neue erzählerische Ele mente bringt, also eine eigenständige Erzählsequenz darstellt. Um die andere Erweite rung ist es vergleichsweise in letzter Zeit ziemlich still geblieben; sie betrifft Kriemhilds Ende.3 Zunächst sei diese ,Nibelungenlied'-Interpolation besprochen, danach soll sie neben weitere vergleichbare Episoden gestellt werden; abschließend will ich eine These über die Herkunft des Zusatzes aufstellen und aus ihr einige allgemeine Bemerkungen ablei ten. 1 S. Bibliographie zum Nibelungenlied und zur Klage v. Willy Krogmann/Ulrich Pretzel, 4. stark erweiterte Aufl. unter redaktioneller Mitarbeit v. Herta Haas/Wolfgang Bachofer (Bibliographien z. dt. Lit. d. Mittelalters 1), Berlin 1966, S. 18f. Zur Problematik der Datierung s. Theodor Abeling, Das Nibelungenlied und seine Literatur. Eine Bibliographie und vier Abhandlungen (Teutonia 7), Leipzig 1907, S. 182. 2 S. Eine spätmittelalterliche Fassung des Nibelungenliedes. Die Handschrift 4257 der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt, hrsg. und eingeleitet von Peter Göhler (Philologica Germanica 21), Wien 1999, bes. S. 18Ff., 160-163; Das Nibelungenlied nach der Handschrift n. Hs. 4257 der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek, hrsg. -

The Following Is a Comprehensive Listing of All Texts Featured in the Volumes of the Motif Index of German Narrative Literature
Index of Abbreviations The following is a comprehensive listing of all texts featured in the volumes of the Motif Index of German Narrative Literature. The abbreviated classifications consist of the author’s name – if known –, and the title of the work. Bibliographical details can be found in the introductory pages of volume I. The two- or three-letter code following the work’s name indicates the genre of the work. MdB = Matière de Bretagne (Vol. I and II) MR = Miscellaneous Romances (Vol. III) CdG = Chansons de Geste (Vol. III) OR = Oriental Romances (Vol. III) HE = Heroic Epic (Vol. IV) MN = Maere and Novellas (Vol. IV) RoA = Romances of Antiquity (Vol. V) Abor Abor und das Meerweib MN HalDB Die halbe Decke B MN Adelh Die böse Adelheid MN HalDBC Die halbe Decke C MN Ain Ainune MR Harm Harm der Hund MN AlbJT Albrecht, Jüngerer Titurel MdB HdKK Heinz derKellner, Konni MN AlbTund Alber, Tundalus MN HdTRH Heinrich der Teichner, Die Rosshaut MN Ali Alischanz CdG HeidinA Die Heidin A MN Alm Das Almosen MN HeidinB Die Heidin B MN AppZu Jacob Appet, Der Ritter unter dem Zuber MN HeidinC Die Heidin C MN ArPhy Aristoteles und Phyllis MN HerEA Herzog Ernst A OR AT Alpharts Tod HE HerEB Herzog Ernst B OR AtPro Athis und Prophilias RoA HerED Herzog Ernst D OR Aug Das Auge MN HeroLe Hero und Leander MN AvHMA Albrecht von Halberstadt, Metamorphosen Fragm. A RoA HevFr Der Herr mit den vier Frauen MN AvHMB Albrecht von Halberstadt, Metamorphosen Fragm. B RoA HFHel Hermann Fressant, Der Hellerwertwitz MN AvHMC Albrecht von Halberstadt, Metamorphosen Fragm. -

Goldemar in Der Dietrich-Sage
DIPL. THEOL. DIRK SONDERMANN König Goldemar in der Dietrichsage (unveröffentlicht, verfasst ca.1999) Der bekannte Märchen- und Sagensammler Ludwig Bechstein (1801-1860) nahm sich der Sagen um den Zwergenkönig Goldemar an. Nachdem „wißbegierige Hausgenossen“ dem Zwergenkönig bzw. „Elben“i (Bechstein) Goldemar Asche und Erbsen streuten, auf denen er ausglitt und fiel, verließ er Burg Hardenstein in (Witten-) Herbede an der Ruhr.ii Weiter heißt es wörtlich: „Da kam der Elbe Goldemar nimmer wieder auf des Hardenbergs Schlösser. Er wandte sich anderswohin und entführte eine Königstochter, die hieß Hertlin. Die Mutter dieser Königstochter starb vor Leid über der Tochter Verlust, letztere aber ward durch den sieghaften Helden Dietrich von Berniii, den alte Lieder feiern, befreit und von geehelicht. Manche sagen, daß dieses Bern, wovon der Held Dietrich den Namen geführt, nicht das Bern in der Schweiz, auch nicht das welsche Bern, Verona, gewesen, sondern das rechte Dietrichs- Bern sei Bonniv gewesen, der älteste Theil dieser Stadt habe auch Verona oder Bern geheißen, und da in dieses rheinische Land und Gefilde so viele Thaten Dietrichs von Bern fallen, von denen in alten Heldenbüchern viel zu lesen, so dürfe wohl etwas Wahres an der Sache und Sage sein. Der Gezwerg Goldemar aber habe, nachdem ihm Dietrich die Beute abgedrungen, die Riesen zu Hülfe gerufen und Berge und Wälder ringsum schrecklich verwüstet. Die Stadt Elberfeld soll ihren Namen von nichts anderm tragen als von den Elbenv, auf deren Felde sie begründet ward.“vi In dieser Sage spricht Bechstein ein weitgehend unbekanntes Thema an: Goldemar und Dietrich von Bern, der Heros der germanischen Heldensage! Goldemar als Romanfigur im Reinfried von Braunschweig Goldemar als Figur der mittelhochdeutschen Heldenepik begegnete den Geistes- wissenschaftlern des 19. -

Dietrich Von Bern and “Historical” Narrative in the German Middle Ages
1 Dietrich von Bern and “Historical” Narrative in the German Middle Ages: An Investigation of Strategies for Establishing Credibility in Four Poems of the Middle High German Dietrichepik by Jonathan Martin Senior Honors Thesis Submitted for German and MEMS, March 26th, 2010 Advised by Professor Helmut Puff © Jonathan Seelye Martin 2010 2 Acknowledgements My special thanks are owed to Dr. Helmut Puff, who has made his advice, time, and considerable knowledge available to me throughout the process of writing this thesis. He has steered me away from many misconceptions and improved my writing for clarity and style. It is very much thanks to him that this thesis appears in the form that it currently does. I also must thank him for repeatedly reminding me that one is never fully satisfied with an end product: there is always something left to improve or expand upon, and this is especially true of an overly ambitious project like mine. In a large part due to his wonderful help, I hope to continue working on and improving my knowledge of this topic, which at first I despised but have come to love, in the future. My thanks also go out to Drs. Peggy McCracken, Kerstin Barndt, George Hoffmann, and Patricia Simons, who have at various times read and commented on drafts of my work and helped guide me through the process of writing and researching this thesis. My other professors and instructors, both here and at Freiburg, have also been inspirations for me, and I must especially thank Maria “Frau” Caswell for teaching me German, Dr. -

New Methodologies in Prosody by Christopher Leo Hench A
Resonances in Middle High German: New Methodologies in Prosody by Christopher Leo Hench A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in German and in Medieval Studies in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Niklaus Largier, Chair Professor David Bamman Professor Frank Bezner Professor Anton Kaes Fall 2017 Resonances in Middle High German: New Methodologies in Prosody Copyright 2017 by Christopher Leo Hench 1 Abstract Resonances in Middle High German: New Methodologies in Prosody by Christopher Leo Hench Doctor of Philosophy in German and in Medieval Studies University of California, Berkeley Professor Niklaus Largier, Chair For years, scholars of medieval German have grappled with how to analyze formal charac- teristics of the lyric and epic poetry while taking into consideration performance, musicality, mouvance, linguistic variation, and aggressive editing practices. The scholarship has jus- tifiably resorted to restricted explorations of specific texts or poets, or heavily criticized region-specific descriptions with several caveats. The many challenges this multifaceted po- etry presents has also obscured one of its most central features—–the medieval voice. With the little evidence we have often being ambiguous or contradictory, how are we to understand the role of the medieval voice in the German corpus as a whole? This project seeks to shed light on this forgotten aspect by taking advantage of computational methods to demonstrate relative formal and thematic relationships based on sound and voice. In doing so, it presents several new prosodic analytical methods. The first chapter of this project underlines the importance of sound and voice to medieval performance and composition. -

The Oral Tradition and Middle High German Literature
Oral Tradition, 1/2 (1986): 398-445 The Oral Tradition and Middle High German Literature Franz H. Bäuml Serious concern with the oral tradition as it existed before and side by side with Middle High German written literature is linked in Middle High German studies to the introduction of the theory of oral- formulaic composition (henceforth referred to as the Theory).1 True, the existence of an oral tradition has never seriously been doubted, but, beyond rather general notions of recurrent structural elements and hypotheses of a development of oral narrative texts in verse from song to epic,2 hypotheses which saw the oral text for the most part through the spectacles of literacy as a basically stable unit subject to alteration and adulteration, the mechanics of an oral tradition played no role in research concerned with Middle High German literature. And to this day we know practically nothing about the oral performances of the vernacular lyric of the late twelfth and early thirteenth centuries.3 Research on the oral tradition of epic poetry and its relationship to the written transmission, however, received more than a negligible impetus from the Theory, despite its general rejection, particularly on the part of German germanists.4 In this survey of the impact of the Theory on Middle High German studies, I shall therefore neither pass over the sins of the representatives of the Theory in silence, nor suppress my own view that the application of the Theory, amended and stripped of its early enthusiasms, has set in motion a current of research on the interrelationships between literacy and orality which promises to illuminate more than one dark corner of literary and social history.5 The initial approaches to Middle High German texts with the concepts of the Theory were rather scattered. -

Das Eckenlied. Sämtliche Fassungen, Hrsg. Von Francis B. BRÉVART, Teil 1: Einleitung. Die Altbezeugten Versionen E1, E2 Und St
Das Eckenlied. Sämtliche Fassungen, hrsg. von Francis B. BRÉVART, Teil 1: Einleitung. Die altbezeugten Versionen E1, E2 und Strophe 8-13 von E4. An- hang: Die Ecca-Episode aus der Thidrekssaga, Teil 2: Dresdener Heldenbuch und Ansbacher Fragment E7 und E3, Teil 3: Die Druckversion und verwandte Textzeugen e1, E4, E5, E6, (Altdeutsche Textbibliothek 111), Tübingen 1999. Die aventiurehafte Dietrichepik: Laurin und Walberan, Der jüngere Sigenot, Das Eckenlied, Der Wunderer, Mittelhochdeutscher Text und neuhochdeutsche Ü- bersetzung von Christa TUCZAY, (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 599), Göppingen 1999. Die Sagen und Geschichten, die sich um Dietrich von Bern ranken, gehören zu den bekanntesten und beliebtesten des Mittelalters. Ausgangspunkt der Sagenbildung ist die historische Gestalt des Ostgotenkönigs Theoderich (um 451-526), der gegen Ende des 5. Jahrhunderts Italien erobert hat. Die über Jahrhunderte mündlich überlieferte Dietrichsage erfuhr im 13. Jahrhundert einen gewaltigen Schub an Verschriftlichun- gen. Die so entstandenen Dietrichepen in (mittelhoch)deutscher Sprache waren in Handschriften und Drucken bis ins 17. Jahrhundert weit verbreitet. Die Forschung teilt sie in zwei Gruppen ein: Als historische Dietrichepik werden das Doppelepos von Dietrichs Flucht und Rabenschlacht sowie Alpharts Tod und Dietrich und Wenezlan bezeichnet; die aventiurehafte Dietrichepik umfaßt das Eckenlied, Goldemar, Sigenot, Virginal, Laurin, Rosengarten und Wunderer. In den letzten Jahren hat das Interesse an der lange Zeit vernachlässigten Dietrich- epik zwar zugenommen,1 doch erschwert wird der Zugang zu diesen einstmals so be- liebten und weit verbreiteten Epen in der Forschung wie im akademischen Unterricht durch die schlechte Editionslage: Der Großteil dieser mittelhochdeutschen Texte ist bis 1 Vgl. dazu etwa: HEINZLE, Joachim, Einführung in die mittelhochdeutsche Dietrichepik, Berlin und New York 1999 (De-Gruyter-Studienbuch) (dazu meine Rezension in: Colloquia Germanica, Interna- tionale Zeitschrift für Germanistik 33 [2000], H. -

INHALT Vorwort 7 Aufsätze Régis BOYER, Naissances Astrales
INHALT Vorwort 7 Aufsätze Régis BOYER, Naissances Astrales. Mythes cosmogoniques de la Scandinavie ancienne 9 Michael GOODICH, Miracles and Disbelief in the Late Middle Ages 23 Bernhard D. HAAGE, Vom Nutzen interdisziplinärer Forschung bei der Interpretation mittelalterlicher Literatur. Am Beispiel von Wolframs von Eschenbach `Parzival` 39 Donald J. KAGAY, Structures Of Baronial Dissent And Revolt Under James I (1213-76) 61 Claude LECOUTEUX, Romanisch-germanische Kulturberührungen am Beispiel des Mahls der Feen 87 Jacques LE GOFF, Le mal royal au moyen âge: du roi malade au roi guerisseur 101 Gundolf KEIL, Korreferat 111 Elizabeth D. LLOYD-KIMBREL, Architectonic Allusions: Gothic Perspectives and Perimeters as an Approach to Chaucer 115 J. David McGEE, Reflections Of The Thougth Of John Scotus Erigena In Some Carolingian And Ottonian Illuminations 125 Thomas H. OHLGREN, The Pagan Iconography of Christian Ideas: Tree-lore in Anglo-Viking England 145 Ortrun RIHA, Wiltrud FISCHER, Editionsprobleme bei naturwissenschaftlichen Texten des Mittelalters. Am Beispiel der Neuausgabe von Ortolfs von Baierland 'Arzneibuch' 175 Benedetto VETERE, I sogni nel medioevo 185 Jochen ZWICK, Zur Form und Funktion übernatürlicher Kommunikatonsweisen in der Frankengeschichte des Gregor von Tours 193 Edition PETER OF CORNWALL, The Visions of Ailsi and his sons, edd. Robert EASTING, Richard SHARP 207 Rezensionen Gesamtes Mittelalter Centre National de la Recherche Scientifique, _Répertoire International des Médiévistes (P. DINZELBACHER) 265 János M. BAK, Mittelalterliche Geschichtsquellen _in chronologischer Übersicht (P. DINZELBACHER) 266 Eberhard BÜSSEM, Michael NEHER (Hgg.), Arbeitsbuch _Geschichte. Mittelalter (J. DÖRRIG) 267 Rudolf SIMEK, Hermann PALSSON, Lexikon der altnordischen_Literatur (A. QUAK) 268 David H. FARMER, The Oxford Dictionary of Saints (P. -

Gattungsinterferenzen in Der Späten Heldendichtung
Imagines Medii Aevi. Interdisziplinäre Beiträge zur Mittelalterforschung 21 Gattungsinterferenzen in der späten Heldendichtung Zugleich Habil. Uni Bremen 2005 Bearbeitet von Sonja Kerth 1. Auflage 2008. Buch. 472 S. Hardcover ISBN 978 3 89500 580 0 Format (B x L): 17 x 24 cm Gewicht: 922 g Weitere Fachgebiete > Literatur, Sprache > Deutsche Literatur Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. I. EInlEItung Heldenepik berichtet über gewaltige Helden, die in bedrohlichen Konfliktsituationen ihre Kampfkraft unter Beweis stellen und lieber untergehen, als sich stärkerer Macht zu beugen; der höfische Roman erzählt die Aventiuren höfischer Ritter, verbindet das Kampfgeschehen mit einer liebesgeschichte und endet im glück. Dies ist die wohl einfachste Formel, auf die sich die beiden wichtigsten gattungen der erzählenden Dichtung des deutschen Mittelalters bringen lassen. Sie ist genauso wenig falsch wie ganz richtig, und unter den mittelhochdeutschen Dichtungen trifft sie nur auf wenige prototypische Vertreter zu. Dies zeigt ein Blick auf einen text, in dem ein mutiger Kämpfer auf Aventiurefahrt durch einen tiefen Wald reitet und auf eine Jungfrau in todesangst aufmerksam wird, deren lautes Weinen und Schreien durch den Wald gellen. Das Mädchen beklagt laut- stark sein Schicksal und ruft verzweifelt um Hilfe. Ihr droht der tod durch die Hand eines skrupellosen Fürsten, der jedes Jahr einen Blutzoll fordert, um so eine Königin zur Heirat zu zwingen. -

Library of Congress Classification
PT GERMAN LITERATURE PT German literature Literary history and criticism Cf. PN821+ Germanic literature Periodicals 1.A1-.A3 International 1.A4-Z American and English 2 French 3 German 5 Italian 7 Scandinavian 8 Spanish and Portuguese 9 Other (11-19) Yearbooks see PT1+ Societies 21.A1-.A3 International 21.A4-Z American and English 22 French 23 German 25 Italian 27 Scandinavian 28 Spanish and Portuguese 29 Other 31 Congresses Collections Cf. PF3112.9+ Chrestomathies 35 Monographs, studies, etc. By various authors 36 Festschriften. By honoree, A-Z 41 Encyclopedias. Dictionaries 43 Pictorial atlases 45 Theory and principles of the study of German literature 47 History of literary history 49 Philosophy. Psychology. Aesthetics Including national characteristics in literature 50 Finance Including government support of literature Study and teaching 51 General 53 General special By period 55 Middle ages to 1600 57 17th and 18th centuries 59 19th century 61 20th century 62 21st century 63.A-Z By region or country, A-Z 65.A-Z By school, A-Z Biography of teachers, critics, and historians 67.A2 Collective 67.A3-Z Individual, A-Z Subarrange each by Table P-PZ50 Criticism For criticism, unless specifically German see PN80+ (69) Periodicals see PN80 71 Treatises. Theory. Canon 73 History 1 PT GERMAN LITERATURE PT Literary history and criticism Criticism -- Continued 74 Special topics (not A-Z) e.g. Textual criticism 75 Collections of essays in criticism By period 76 Medieval to 1600 77 17th century 78 18th century 79 19th century 80 20th century 81 21st century History of German literature General Treatises in German 83 Early works to 1800 84 Works, 1800-1850 Including later editions of works of this period 85 Works, 1850- 89 Works by Catholic authors or treating of Catholic literature 91 Treatises in English 93 Treatises in other languages Compends German 95 Through 1900 96 1901- English 98 Through 1900 99 1901- 101 Other languages 103 Outlines, syllabi, tables, atlases, charts, questions and answers, etc. -

Räume in Der Aventiurehaften Dietrichepik
Räume in der aventiurehaften Dietrichepik Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München vorgelegt von Dominik Streit aus Starnberg 2021 Referentin: Prof. Dr. Beate Kellner Korreferentin: PD Dr. Julia Zimmermann Tag der mündlichen Prüfung: 15. Mai 2018 Gewidmet meinem Vater Wolfgang Hey (1953 - 2013) Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde im Jahr 2018 von der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München als Dissertation angenommen. Für die Veröffentlichung wurde sie überarbeitet. Mein erster und herzlicher Dank gilt Beate Kellner. Sie hat mich allererst auf die aventiurehafte Dietrichepik aufmerksam gemacht und mir damit den Weg zu diesem sehr speziellen Teil mittelhochdeutscher Epik gewiesen. Als Mitarbeiter an ihrem Lehrstuhl genoss ich die Freiheit, zu einem Thema meiner Wahl forschen zu können. Es ist nicht selbstverständlich, als Doktorand an Tagungen teilnehmen zu dürfen, seine Ideen mit einem Fachpublikum zu diskutieren und für die Publikation der Beiträge auch die Arbeit an der Dissertation zwischenzeitlich ruhen lassen zu dürfen. Für all dies gebührt ihr mein Dank. Ebenso herzlich danken möchte ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Oberseminars von Beate Kellner, mit denen ich meine Ideen immer wieder diskutieren durfte. Namentlich genannt seien Susanne Reichlin, Julia Zimmermann, Holger Runow, Alexander Rudolph, Kathrin Gollwitzer, Eva Bauer und Fabian Prechtl. Corinna Dörrich danke ich dafür, die Begeisterung für mittelalterliche Literatur in mir geweckt zu haben. Julia Zimmermann gebührt mein ausdrücklicher Dank für die Übernahme des Korreferats und die wertvollen Hinweise für die Überarbeitung. Wichtige Impulse verdankt diese Arbeit dem DFG-Netzwerk „Medieval Narratology“, dessen Mitglied ich während der Laufzeit von 2014 bis 2017 sein durfte. -
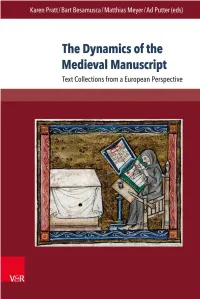
The Dynamics of the Medieval Manuscript
Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0 © 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen ISBN Print: 9783847107545 – ISBN E-Lib: 9783737007542 Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0 © 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen ISBN Print: 9783847107545 – ISBN E-Lib: 9783737007542 Karen Pratt /Bart Besamusca /Matthias Meyer / Ad Putter (eds) The Dynamics of the Medieval Manuscript Text Collections from aEuropean Perspective Edited with the Assistance of Hannah Morcos With 22 figures V&Runipress Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0 © 2017, V&R unipress GmbH, Göttingen ISBN Print: 9783847107545 – ISBN E-Lib: 9783737007542 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available online: http://dnb.d-nb.de. ISBN 978-3-7370-0754-2 You can find alternative editions of this book and additional material on our website: www.v-r.de © 2017, V&R unipress GmbH, Robert-Bosch-Breite 6, 37079 Göttingen, Germany / www.v-r.de This publication is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial- No Derivatives 4.0 International license, at DOI 10.14220/9783737007542. For a copy of this license go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Any use in cases other than those permitted by this license requires the prior written permission from the publisher. Cover image: A hermit at work on a manuscript; Estoire del Saint Graal, France, c. 1315±1325, London, British Library, Royal MS 14 E III, fol.