Bruder Gaddafi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
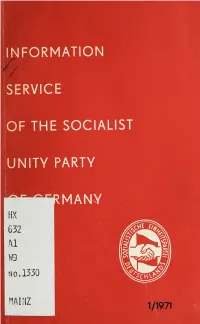
Second Session of the Central Committee of the Socialist Unity Party of Germany
Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from University of Alberta Libraries https://archive.org/details/secondsessionofcOOsoci Second Session of the Central Committee of the Socialist Unity Party of Germany Berlin, 16 and 17 September 1971 Printed in the German Democratic Republic by Grafischer Grossbetrieb Volkerfreundschaft Dresden 1259 - 2 Contents Communique of the Second Session of the Central Committee of the Socialist Unity Party of Germany 7 From the Report of the Political Bureau to the Second Session of the Central Committee of the Socialist Unity Party of Germany (SED) Reporter: Comrade Hermann Axen, Member of the Political Bureau and Secretary of the Central Committee 8 I. Conclusions Drawn from the Decisions of the Eighth Party Congress in the Field of Domestic Policy and Their Implementation 8 - Implementing the Decisions in the Economic Sphere 12 - Implementing the Decisions in Agriculture 15 II. The Implementation of the Decisions of the Eighth Congress in the Field of Foreign Policy and International Relations 17 - The GDR in the Socialist Community of States 17 - Struggle for European Security 21 - Relations with the Nationally-liberated States and the National Revolutionary Liberation Movement 24 - Development of Relations with the Communist and Workers’ Parties and with the Revolutionary Democratic Parties 26 Preparation and Holding of the Elections to the People’s Chamber and the County Assemblies Speech by Erich Honecker, First Secretary of the Central Committee of the SED 28 Our Balance Sheet Is -

Machtwechsel in Ost-Berlin. Der Sturz Walter Ulbrichts 1971
JOCHEN STELKENS MACHTWECHSEL IN OST-BERLIN Der Sturz Walter Ulbrichts 1971 „Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, das Zentralkomitee auf seiner heutigen Tagung zu bitten, mich von der Funktion des Ersten Sekretärs des Zentralko mitees der SED zu entbinden. Die Jahre fordern ihr Recht und gestatten es mir nicht län ger, eine solche anstrengende Tätigkeit wie die des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees auszuüben. Ich erachte daher die Zeit für gekommen, diese Funktion in jüngere Hände zu geben, und schlage vor, Genossen Erich Honecker zum Ersten Sekretär des Zentral komitees zu wählen."1 Eher nüchtern und scheinbar auch gefaßt verabschiedete sich Walter Ulbricht am 3. Mai 1971 auf der 16. ZK-Tagung der SED von der großen Weltpo litik, und man hätte auf den ersten Blick vermuten können, daß es sich - hauptsächlich wegen seines fortgeschrittenen Alters - um einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger Erich Honecker handelte. Hermann Axen, schon damals und noch bis 1989 Mitglied des Politbüros sowie Sekretär des ZK für internationale Verbindungen, nährte nach dem Fall der Mauer solche Mutmaßungen2: „Die Ablösung war kein Coup, kein Komplott. Es war nicht gemanagt. Hätten wir das nicht getan, wäre Walter Ulbricht frü her gestorben; wir haben sein Leben verlängert. Leicht ist ihm die Korrektur, die der VIII. Parteitag vornahm, und die Tatsache, daß er nicht mehr Erster Sekretär der Partei war, natürlich nicht gefallen. Schon auf dem 16. Plenum hatte er die Entscheidung ehrlich akzeptiert und Erich Honecker als seinen Nachfolger umarmt und beglückwünscht. Wir müssen Hochachtung vor Walter empfinden, der die Partei über alles stellte."3 Allerdings war schon ziemlich bald für DDR-Forscher im Westen klar, daß der Machtwechsel von Ulbricht zu seinem politischen Ziehsohn Honecker nicht so rei bungslos verlaufen war, wie ihn die SED nach außen darstellen wollte. -

REFORM, RESISTANCE and REVOLUTION in the OTHER GERMANY By
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Birmingham Research Archive, E-theses Repository RETHINKING THE GDR OPPOSITION: REFORM, RESISTANCE AND REVOLUTION IN THE OTHER GERMANY by ALEXANDER D. BROWN A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of Modern Languages School of Languages, Cultures, Art History and Music University of Birmingham January 2019 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract The following thesis looks at the subject of communist-oriented opposition in the GDR. More specifically, it considers how this phenomenon has been reconstructed in the state-mandated memory landscape of the Federal Republic of Germany since unification in 1990. It does so by presenting three case studies of particular representative value. The first looks at the former member of the Politbüro Paul Merker and how his entanglement in questions surrounding antifascism and antisemitism in the 1950s has become a significant trope in narratives of national (de-)legitimisation since 1990. The second delves into the phenomenon of the dissident through the aperture of prominent singer-songwriter, Wolf Biermann, who was famously exiled in 1976. -

Ernst Thälmann – Führer Seiner Klasse (1955) Propaganda Für Arbeiterklasse, Partei Und Heroismus
Ernst thälmann – FührEr sEinEr KlassE (1955) Propaganda für Arbeiterklasse, Partei und Heroismus 1 FilmographischE angabEn 3 2 Filminhalt 3 3 HistorischE KontExtualisiErung 4 4 DiDaKtischE übErlEgungEn 7 5 ArbEitsanrEgungEn 11 6 MatErial 13 7 LitEratur 29 2 Unterrichtsmaterial Ernst Thälmann – Führer seiner Klasse www.ddr-im-film.de 1 FilmographischE angabEn Regie Kurt Maetzig Drehbuch Willi Bredel, Michael Tschesno-Hell, Kurt Maetzig Kamera Karl Plintzner, Horst E. Brandt schnitt Lena Neumann Musik Wilhelm Neef bauten Otto Erdmann, Willy Schiller, Alfred Hirschmeier Kostüme Gerhard Kaddatz produktion DEFA-Studio für Spielfilme (Potsdam-Babelsberg) uraufführung 07.10.1955, Ost-Berlin/Volksbühne Länge 140 Minuten FSK ab 12 Auszeichnungen Karlovy-Vary-Filmfestival 1956: Preis für den besten Schauspieler an Günther Simon Darstellerinnen | Darsteller Günther Simon (Ernst Thälmann), Hans-Peter Minetti (Fiete Jan- sen), Karla Runkehl (Änne Hansen), Paul R. Henker (Robert Dirhagen), Hans Wehrl (Wilhelm Pieck), Karl Brenk (Walter Ulbricht), Michel Piccoli (Maurice Rouger) Gerd Wehr (Wilhelm Flo- rin), Walter Martin (Hermann Matern), Georges Stanescu (Georgi Dimitroff), Carla Hoffmann (Rosa Thälmann), Erich Franz (Arthur Vierbreiter), Raimund Schelcher (Krischan Daik), Fritz Diez (Hitler), Hans Stuhrmann (Goebbels) 2 Filminhalt Der Film behandelt das Leben des Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutsch- lands, Ernst Thälmann, in den Jahren von 1930 bis zu seinem Tode 1944. In lose aneinander gereihten Szenen werden vor allem die politische Arbeit des Parteiführers gezeigt. Thälmann wohnt zu Beginn der 1930er-Jahre in einem Zimmer einer typischen Berliner Mietskasernen- wohnung, das ihm von seinem Parteifreund Fiete Jansen und dessen schwangerer Frau Änne untervermietet wird. Fiete hat jahrelang im Gefängnis gesessen. Änne ist als Mitglied des kommunistischen Jugendverbandes für die KPD politisch aktiv. -

The German Democratic Republic's Attitude
PRZEGLĄD ZACHODNI 2011, No 1 ANNA WOLff-POWęskA Poznań THE GERMAN DEMOCRATIC Republic’s AttITUDE TOWARDS THE NAZI PAST Periods of change connected with a transition from dictatorship to democracy are characterized by intensive search for a new binder of national unity and identity. Communities which have been affected by totalitarianism in order to build a new order have to define their attitude towards the old one. As it has been demonstrated by the two German states in their process of abandoning the Third Reich’s policy and system of values, factors such as the defence of one’s own history, and seeking an answer to the question of what should be retained in the memory and what should be eradicated, have shaped the political identity of German society of the political turn era in a significant way. The reunification of Germany in 1990 confirmed the truth that the process of democratization is accompanied by a social crisis which is also a crisis of the criteria determining what is remembered and what is forgotten, the integral elements of every history. The way of perceiving National socialism and positioning it in German history has played a fundamental role in the development of political cultures, first of two different German states, and then of a reunified Germany*. National consciousness and community spirit is shaped by reference to history, which can be glorified, sac- ralised, or pushed to the margins of public life. Establishing two separate German states with different ideological foundations brought far reaching consequences for the cultural memory of the divided community. -
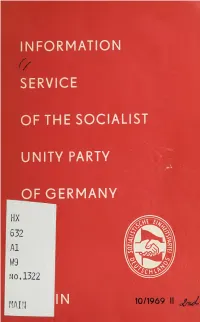
Twelfth Session of the Central Committee of the Socialist Unity Party of Germany
INFORMATION SERVICE OF THE SOCIALIST UNITY PARTY OF GERMANY NO 1322 Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from University of Alberta Libraries https://archive.org/details/twelfthsessionofOOsozi Twelfth Session of the Central Committee of the Socialist Unity Party of Germany in Berlin on 12 and 13 December 1969 Printed in the German Democratic Republic by Grafischer Grossbetrieb Volkerfreundschaft Dresden 9270 - 2 Contents page From the Report of the Political Bureau to the 12th Session of the Central Committee of the Socialist Unity Party of Ger¬ many given by Comrade Werner Jarowinsky, Candidate Member of the Political Bureau and Secretary of the Central Committee 5 I. Implementing the Economic System of Socialism During the 1969 Plan 7 On the Results of the 1969 Plan Fulfilment and the Social¬ ist Emulation 7 On a Few Questions of the Organization of Science and Complex Socialist Automation 8 On the Publication of the Book The Political Economy of Socialism and Its Application in the GDR 11 II. Further Development of the Integrated Socialist Educa¬ tional System 12 The Main Direction of Public Education up to 1980 12 On Carrying Out the Third Reform of Ffigher Education 14 On the Academy Reform 16 On the Systematic Training and Further Training of the Working People 17 III. Further Strengthening the International Positions of the GDR and its Authority in the World 18 GDR Progress in Foreign Policy 19 New Initiatives for Guaranteeing European Security 21 Activities to Strengthen and Further Consolidate the So¬ cialist Community of States 23 On the Ideological and Theoretical Work of the SED and Other Fraternal Parties in Evaluating and Implementing the Documents of the International Meeting 25 Exchange of Delegations and Experiences 26 IV. -

Die Konfessionelle Krankenpflegeausbildung War Eine
Katholische Krankenpflegeausbildung in der SBZ/DDR und im Transformationsprozess Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt vorgelegt von Cornelia Ropers Gutachter: 1. Prof. Dr. theol. Andrea Schulte (Universität Erfurt) 2. Prof. Dr. theol. Josef Pilvousek (Universität Erfurt) 3. Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Hans Pistner (Universität Jena) Datum der Dispuation: 06. Juli 2009, Universität Erfurt, Erziehungswissenschaftliche Fakultät Datum der Promotion: 06. Juli 2009 urn:nbn:de:gbv:547-200900824 Zusammenfassung Die konfessionelle Krankenpflegeausbildung war die einzige christliche Berufsausbildung mit staatlicher Anerkennung in der DDR, somit drängt sich die Frage auf, wieso diese Ausbildung möglich war, obwohl der Staat das Erziehungs- und Bildungsmonopol beanspruchte. Ein Grund lag ganz sicher darin, dass die staatlichen Stellen sich immer des besonderen Potential der konfessionellen Häuser bei der Versorgung der Bevölkerung bewusst waren. In der SBZ wurden alle katholischen Krankenpflegeschulen wieder zugelassen. Die ersten Jahre der DDR waren durch Spannungen und Unsicherheiten gekennzeichnet. Die Recherchen und Interviews, die zu jedem der Ausbildungskrankenhäuser geführt wurden, lassen eine Verallgemeinerung zu. Wichtigster Ausbilder und Partner der Schülerinnen waren in dieser Zeit die Ordensschwestern. Ab 1973 führte der DCV/Zst. Berlin Verhandlungen mit dem Ministerium für Gesundheitswesen, um ein Fortbestehen der -

Ernst Thälmann – Führer Seiner Klasse (1955) Propaganda Für Arbeiterklasse, Partei Und Heroismus
Ernst thälmann – FührEr sEinEr KlassE (1955) Propaganda für Arbeiterklasse, Partei und Heroismus 1 FilmographischE angabEn . 3 2 Filminhalt . 3 3 HistorischE KontExtualisiErung . 5 4 DiDaKtischE übErlEgungEn . 8 5 ArbEitsanrEgungEn . 11. 6 MatErial . 13 Material 1: Was ist Propaganda? . 13 Material 2: Ernst Thälmann – historische Figur und Mythos . 14 Material 3: Historische Traditionen der SED . 17 Material 4: Umgang der SED mit der nationalsozialistischen Vergangenheit . 20 Material 5: Produktionsbedingungen des Films . 21 Material 6: Propaganda oder Wirklichkeit? . 24 Material 7: Filmische Mittel des Propaganda-Films und ihre Wirkung . 25 Material 8: Zeitgenössische Kritiken des Films . 28 7 LitEratur . 29 2 Unterrichtsmaterial Ernst Thälmann – Führer seiner Klasse www.ddr-im-film.de 1 FilmographischE angabEn Regie Kurt Maetzig Drehbuch Willi Bredel, Michael Tschesno-Hell, Kurt Maetzig Kamera Karl Plint- zner, Horst E. Brandt schnitt Lena Neumann Musik Wilhelm Neef bauten Otto Erdmann, Willy Schiller, Alfred Hirschmeier Kostüme Gerhard Kaddatz produktion DEFA-Studio für Spielfilme (Potsdam-Babelsberg) uraufführung 07.10.1955, Ost-Berlin/Volksbühne Länge 140 Minuten FsK ab 12 Auszeichnungen Karlovy-Vary-Filmfestival 1956: Preis für den be- sten Schauspieler an Günther Simon Darstellerinnen | Darsteller Günther Simon (Ernst Thälmann), Hans-Peter Minetti (Fiete Jansen), Karla Runkehl (Änne Jansen), Paul R. Henker (Robert Dirhagen), Hans Wehrl (Wilhelm Pieck), Karl Brenk (Walter Ulbricht), Michel Piccoli (Maurice Rouger) Gerd Wehr (Wilhelm Florin), Walter Mar- tin (Hermann Matern), Georges Stanescu (Georgi Dimitroff), Carla Hoffmann (Rosa Thälmann), Erich Franz (Arthur Vierbreiter), Raimund Schelcher (Krischan Daik), Fritz Diez (Hitler), Hans Stuhr- mann (Goebbels) u.a. 2 Filminhalt Der Film behandelt das Leben des Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands, Ernst Thälmann, in den Jahren von 1930 bis zu seinem Tode 1944. -

Andreas Malycha Die SED in Der Ära Honecker Quellen Und Darstellungen Zur Zeitgeschichte
Andreas Malycha Die SED in der Ära Honecker Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte Herausgegeben vom Institut für Zeitgeschichte Band 102 Andreas Malycha Die SED in der Ära Honecker Machtstrukturen, Entscheidungsmechanismen und Konfliktfelder in der Staatspartei 1971 bis 1989 ISBN 978-3-486-74709-6 E-ISBN 978-3-11-034785-2 ISSN 0481-3545 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio- grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. © 2014 Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH Rosenheimer Straße 143, 81671 München, Deutschland www.degruyter.com Ein Unternehmen von De Gruyter Einbandgestaltung: hauser lacour Druck und Bindung: Hubert & Co, Göttingen Gedruckt in Deutschland Dieses Papier ist alterungsbeständig nach DIN/ISO 9706. Inhalt Danksagung ..................................................... VII Einführung ...................................................... 1 I. Von Ulbricht zu Honecker..................................... 11 1. Die Machtzentren der SED: Politbüro und Sekretariat des Zentralkomitees .......................................... 11 2. Die Waldsiedlung bei Wandlitz .............................. 20 3. Das Politbüro der späten Ulbricht-Ära ....................... 31 4. Der Abbruch der Wirtschaftsreformen und das Ende der Ära Ulbricht -

Journal Der DEFA-Stiftung | 3 2020 N Editorial: Leuchtkraft, Die Dritte!
Journal der DEFA-Stiftung | 3 2020 n Editorial: Leuchtkraft, die Dritte! Trotz Gegenwart in die Zukunft: Fragen an den neuen Vorstand Stefanie, seit Juli bist Du Vorstand der DEFA-Chefdramaturgen Rudolf Jürschik«. Auch die um- DEFA-Stiftung und an dieser Stelle würde ich fangreiche DVD-Box mit Filmen von Wolfgang Kohlhaase fragen, welche neuen Perspektiven und Schwer- wird pünktlich zu seinem 90. Geburtstag im Vertrieb von punkte Du für die zukünftige Stiftungsarbeit ICESTORM erscheinen. Zahlreiche Filme konnten 2020 setzt. Da wir aber ein Jahr erlebt haben, in dem dank der Unterstützung des Bundesarchivs digitalisiert Hans Müllers DEFA-Klassiker 1-2-3 Corona werden, etwa Spielfilme der Wende-Jugend. Gefreut (1948) unverhoffte Aufmerksamkeit bekam, habe ich mich über die Bearbeitung des Dokumentar- stelle ich die Frage eher als eine nach den filmsGrenzland – eine Reise von Andreas Voigt (1992), besonderen Herausforderungen. und über die Dresdner Trickfilme der 1980er-Jahre, denen 1-2-3 Corona ist kein uninteressanter Film, wenn ich an die Marion Rasche als künstlerische Leiterin des Studios den erste Einstellung und den langsamen Schwenk auf den Zet- Weg bahnte. Ein besonderes Erlebnis war zudem die tel denke, der an eine Mauer gekleistert ist: »Die Schulen Retrospektive zu Filmen von Konrad Wolf in Bologna. bleiben bis auf weiteres geschlossen« – und schon sind wir im Jahr 2020! Ein Jahr, in dem sich die DEFA-Stiftung vielen Auf welche bisher zu wenig beachteten unvorhersehbaren Herausforderungen zu stellen hatte. Vie- Bereiche wird sich Deine Aufmerksamkeit le unserer geplanten Veranstaltungen mussten verschoben in Zukunft richten? und abgesagt werden. Und auch wir leiden unter dem Ein- Ich sehe die DEFA-Stiftung noch stärker als bisher in der nahmeverlust durch die Schließung der Kinos, durch den Rolle der Beraterin und Wegbegleiterin von Projekten Einbruch des DVD- und generell des Finanzmarktes. -

Bibliotheksbestand LAMV Stand 16.01.2020.Xlsx
Verfasser Titel Untertitel Ort Jahr Signatur Kernkraft in der DDR: Zwischen nationaler Industriepolitik und sozialistischer Zusammenarbeit Kernenergieentwicklung in der DDR. Atomkraftwerke und Widerstand gegen Atomkraft in Abele, Johannes 1963-1990 der DDR. Dresden 2000 Ge-199/26 Politischer Umbruch und Neubeginn in Wismar von Politischer Umbruch in der DDR und in Wismar 1989.Vorgeschichte 1985-1989. Profilierung Abrokat, Sven 1989 bis 1990: der politischen Parteien.+ Dokumente Hamburg 1997 Ge-403 Ackermann, Anton An die lernende und suchende deutsche Jugend: Berlin; Leipzig 1946 DDR-212 Die Jenaer Schulen im Fokus der Staatssicherheit: Eine Abhandlung zur Mitarbeit von Lehrern und Schülern beim Ministerium für Staatssicherheit der DDR-Schulwesen. Führungs-IM -System in Jena. Mitarbeit von Lehrern und Schülern beim Ackermann, Jens P. DDR Ministerium für Staatssicherheit. Weimar 2005 Ge-1021 Christliche Frauen in der DDR: Alltagsdokumente Ackermann, Sonja einer Diktatur in Interviews Studie zur Situation christlicher Frauen in der DDR. 97 Interviews. Leipzig 2005 Ge-1024 A.S. Makarenko- Erzieher im Dienste der Bad Adolphes, Lotte Revolution: Versuch einer Interpretation Eine Makarenko-Studie. Godesberg 1962 Ge-1009 Agsten, Rudolf; Bogisch, LDPD auf dem Weg in die DDR: Zur Geschichte der Manfred LDPD in den Jahren 1946-1949 Berlin 1974 DDR-0001 Feiertage der DDR - Feiern in der DDR. Zwischen Ahbe, Thomas Umerziehung und Eigensinn Feiertage in der DDR. Ritale und Botschaften. Jugendweihe. Erfurt 2017 Ge-1744 Ostalgie: Zu ostdeutschen Erfahrungen und Ahbe, Thomas Reaktionen nach dem Umbruch Umgang mit DDR-Vergangenheit. Entstehung der Ostalgie nach 1990 und ihre Ursachen. Erfurt 2016 Ge-1668 Ostalgie: Zu ostdeutschen Erfahrungen und Ahbe, Thomas Reaktionen nach dem Umbruch Umgang mit DDR-Vergangenheit. -

How the Germans Brought Their Communism to Yemen
Miriam M. Müller A Spectre is Haunting Arabia Political Science | Volume 26 This book is dedicated to my parents and grandparents. I wouldn’t be who I am without you. Miriam M. Müller (Joint PhD) received her doctorate jointly from the Free Uni- versity of Berlin, Germany, and the University of Victoria, Canada, in Political Science and International Relations. Specialized in the politics of the Middle East, she focuses on religious and political ideologies, international security, international development and foreign policy. Her current research is occupied with the role of religion, violence and identity in the manifestations of the »Isla- mic State«. Miriam M. Müller A Spectre is Haunting Arabia How the Germans Brought Their Communism to Yemen My thanks go to my supervisors Prof. Dr. Klaus Schroeder, Prof. Dr. Oliver Schmidtke, Prof. Dr. Uwe Puschner, and Prof. Dr. Peter Massing, as well as to my colleagues and friends at the Forschungsverbund SED-Staat, the Center for Global Studies at the University of Victoria, and the Political Science Depart- ment there. This dissertation project has been generously supported by the German Natio- nal Academic Foundation and the Center for Global Studies, Victoria, Canada. A Dissertation Submitted in (Partial) Fulfillment of the Requirements for the- Joint Doctoral Degree (Cotutelle) in the Faculty of Political and Social Sciences ofthe Free University of Berlin, Germany and the Department of Political Scien- ceof the University of Victoria, Canada in October 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommer- cial-NoDerivs 4.0 (BY-NC-ND) which means that the text may be used for non- commercial purposes, provided credit is given to the author.