Baltischer Enzian
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Notes on Identification Works and Difficult and Under-Recorded Taxa
Notes on identification works and difficult and under-recorded taxa P.A. Stroh, D.A. Pearman, F.J. Rumsey & K.J. Walker Contents Introduction 2 Identification works 3 Recording species, subspecies and hybrids for Atlas 2020 6 Notes on individual taxa 7 List of taxa 7 Widespread but under-recorded hybrids 31 Summary of recent name changes 33 Definition of Aggregates 39 1 Introduction The first edition of this guide (Preston, 1997) was based around the then newly published second edition of Stace (1997). Since then, a third edition (Stace, 2010) has been issued containing numerous taxonomic and nomenclatural changes as well as additions and exclusions to taxa listed in the second edition. Consequently, although the objective of this revised guide hast altered and much of the original text has been retained with only minor amendments, many new taxa have been included and there have been substantial alterations to the references listed. We are grateful to A.O. Chater and C.D. Preston for their comments on an earlier draft of these notes, and to the Biological Records Centre at the Centre for Ecology and Hydrology for organising and funding the printing of this booklet. PAS, DAP, FJR, KJW June 2015 Suggested citation: Stroh, P.A., Pearman, D.P., Rumsey, F.J & Walker, K.J. 2015. Notes on identification works and some difficult and under-recorded taxa. Botanical Society of Britain and Ireland, Bristol. Front cover: Euphrasia pseudokerneri © F.J. Rumsey. 2 Identification works The standard flora for the Atlas 2020 project is edition 3 of C.A. Stace's New Flora of the British Isles (Cambridge University Press, 2010), from now on simply referred to in this guide as Stae; all recorders are urged to obtain a copy of this, although we suspect that many will already have a well-thumbed volume. -

State of New York City's Plants 2018
STATE OF NEW YORK CITY’S PLANTS 2018 Daniel Atha & Brian Boom © 2018 The New York Botanical Garden All rights reserved ISBN 978-0-89327-955-4 Center for Conservation Strategy The New York Botanical Garden 2900 Southern Boulevard Bronx, NY 10458 All photos NYBG staff Citation: Atha, D. and B. Boom. 2018. State of New York City’s Plants 2018. Center for Conservation Strategy. The New York Botanical Garden, Bronx, NY. 132 pp. STATE OF NEW YORK CITY’S PLANTS 2018 4 EXECUTIVE SUMMARY 6 INTRODUCTION 10 DOCUMENTING THE CITY’S PLANTS 10 The Flora of New York City 11 Rare Species 14 Focus on Specific Area 16 Botanical Spectacle: Summer Snow 18 CITIZEN SCIENCE 20 THREATS TO THE CITY’S PLANTS 24 NEW YORK STATE PROHIBITED AND REGULATED INVASIVE SPECIES FOUND IN NEW YORK CITY 26 LOOKING AHEAD 27 CONTRIBUTORS AND ACKNOWLEGMENTS 30 LITERATURE CITED 31 APPENDIX Checklist of the Spontaneous Vascular Plants of New York City 32 Ferns and Fern Allies 35 Gymnosperms 36 Nymphaeales and Magnoliids 37 Monocots 67 Dicots 3 EXECUTIVE SUMMARY This report, State of New York City’s Plants 2018, is the first rankings of rare, threatened, endangered, and extinct species of what is envisioned by the Center for Conservation Strategy known from New York City, and based on this compilation of The New York Botanical Garden as annual updates thirteen percent of the City’s flora is imperiled or extinct in New summarizing the status of the spontaneous plant species of the York City. five boroughs of New York City. This year’s report deals with the City’s vascular plants (ferns and fern allies, gymnosperms, We have begun the process of assessing conservation status and flowering plants), but in the future it is planned to phase in at the local level for all species. -

Plant List for VC54, North Lincolnshire
Plant List for Vice-county 54, North Lincolnshire 3 Vc61 SE TA 2 Vc63 1 SE TA SK NORTH LINCOLNSHIRE TF 9 8 Vc54 Vc56 7 6 5 Vc53 4 3 SK TF 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 Paul Kirby, 31/01/2017 Plant list for Vice-county 54, North Lincolnshire CONTENTS Introduction Page 1 - 50 Main Table 51 - 64 Summary Tables Red Listed taxa recorded between 2000 & 2017 51 Table 2 Threatened: Critically Endangered & Endangered 52 Table 3 Threatened: Vulnerable 53 Table 4 Near Threatened Nationally Rare & Scarce taxa recorded between 2000 & 2017 54 Table 5 Rare 55 - 56 Table 6 Scarce Vc54 Rare & Scarce taxa recorded between 2000 & 2017 57 - 59 Table 7 Rare 60 - 61 Table 8 Scarce Natives & Archaeophytes extinct & thought to be extinct in Vc54 62 - 64 Table 9 Extinct Plant list for Vice-county 54, North Lincolnshire The main table details all the Vascular Plant & Stonewort taxa with records on the MapMate botanical database for Vc54 at the end of January 2017. The table comprises: Column 1 Taxon and Authority 2 Common Name 3 Total number of records for the taxon on the database at 31/01/2017 4 Year of first record 5 Year of latest record 6 Number of hectads with records before 1/01/2000 7 Number of hectads with records between 1/01/2000 & 31/01/2017 8 Number of tetrads with records between 1/01/2000 & 31/01/2017 9 Comment & Conservation status of the taxon in Vc54 10 Conservation status of the taxon in the UK A hectad is a 10km. -

Flora of Vascular Plants of the Seili Island and Its Surroundings (SW Finland)
Biodiv. Res. Conserv. 53: 33-65, 2019 BRC www.brc.amu.edu.pl DOI 10.2478/biorc-2019-0003 Submitted 20.03.2018, Accepted 10.01.2019 Flora of vascular plants of the Seili island and its surroundings (SW Finland) Andrzej Brzeg1, Wojciech Szwed2 & Maria Wojterska1* 1Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland 2Department of Forest Botany, Faculty of Forestry, Poznań University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznań, Poland * corresponding author (e-mail: [email protected]; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7774-1419) Abstract. The paper shows the results of floristic investigations of 12 islands and several skerries of the inner part of SW Finnish archipelago, situated within a square of 11.56 km2. The research comprised all vascular plants – growing spontaneously and cultivated, and the results were compared to the present flora of a square 10 × 10 km from the Atlas of Vascular Plants of Finland, in which the studied area is nested. The total flora counted 611 species, among them, 535 growing spontaneously or escapees from cultivation, and 76 exclusively in cultivation. The results showed that the flora of Seili and adjacent islands was almost as rich in species as that recorded in the square 10 × 10 km. This study contributed 74 new species to this square. The hitherto published analyses from this area did not focus on origin (geographic-historical groups), socioecological groups, life forms and on the degree of threat of recorded species. Spontaneous flora of the studied area constituted about 44% of the whole flora of Regio aboënsis. -

Bağbahçe Bilim Dergisi
b 10.35163/bagbahce.559583 6(1) 2019: 45-53 b E-ISSN: 2148-4015 Bağbahçe Bilim Dergisi b http://edergi.ngbb.org.tr Araştırma Makalesi Türkiye Florası İçin Yeni Bir Müşkürüm Kaydı: Muscari pallens (M.Bieb.) Fisch. (Kuşkonmazgiller/ Asparagaceae) İsmail EKER*1 , Hasan YILDIRIM2 , Metin ARMAĞAN3 1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 14030, Gölköy, Bolu, Türkiye 2Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Böl., 35040, Bornova, İzmir, Türkiye 3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl. AYDIN * Sorumlu yazar / Correspondence: [email protected] Geliş/Received: 31.12.2018 • Kabul/Accepted: 25.03.2019 • Yayın/Published Online: 30.04.2019 Öz: Muscari pallens (M.Bieb.) Fisch. Van’dan toplanan örneklere dayalı olarak Türkiye’den ilk kez kaydedildi. Yeni kayıt taksonun yakın akraba olduğu Botryanthus altcinsi içerisinde yer alan Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker ve Pseudomuscari altcinsi içerisinde yer alan diğer türlerle olan taksonomik ilişkileri karşılaştırıldı. Yeni kaydın genişletilmiş bir betimi ve habitat özellikleri verildi. Ayrıca, yeni kayıt bitkinin Kafkasya’da yayılış gösteren aynı türe ait farklı popülasyonlarla olan morfolojik benzerlikleri ve farklılıkları tartışıldı. Anahtar kelimeler: Asparagaceae, Muscari, müşkürüm, Scilloideae, Türkiye, yeni kayıt, Van A new grape hyacinth record for the flora of Turkey: Muscari pallens(M.Bieb.) Fisch. (Asparagaceae) Abstract: Muscari pallens (M.Bieb.) Fisch. is recorded for the first time in Turkey based on the specimens collected from Van province. The taxonomic relationship of the new record taxon is compared with close relative Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker in the subgenus Botryanthus and the other taxa in the subgenus Pseudomuscari. An expanded description and habitat characteristics of the new record are provided. -

Muscari Botryoides (L.) Mill.: a New Record for the Family Asparagaceae from Turkey
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi Turk J Agric Res 2018, 5(2): 116-119 dergipark.gov.tr/tutad © TÜTAD ISSN: 2148-2306 e-ISSN: 2528-858X Research Article doi: 10.19159/tutad.368374 Muscari botryoides (L.) Mill.: A New Record for the Family Asparagaceae from Turkey Süleyman Mesut PINAR1*, Mehmet FİDAN2, Hüseyin EROĞLU3 1Van Yüzüncü Yıl University, Van Health School, Nutrition and Dietetics Program, Van, TURKEY 2Siirt University, Faculty of Arts and Sciences, Deparment of Biology, Siirt, TURKEY 3Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Science, Deparment of Biology, Van, TURKEY Received: 18.12.2017 Accepted: 03.05.2018 ORCID ID (By author order) ORCID ID (by author order) İD orcid.org/0000-0002-1774-7704 İD orcid.org/0000-0002-5041-2164 İD orcid.org/0000-0001-9171-5607 orcid.org/0000-0002-1774-7704; orcid.org/0000-0002-5041-2164; orcid.org/0000-0001-9171-5607 *Corresponding Author: [email protected] *Corresponding Author: [email protected] Abstract: In this study, Muscari botryoides (L.) Mill. (Asparagaceae) is recorded for the first time from the East Anatolia region (B9 Van) of Turkey. The description of Muscari botryoides is given and habitus photos of related species are presented. Geographical distribution is mapped, and IUCN (International Union for Conservation of Nature) threat categories at the regional scale of the populations are discussed. Keywords: Muscari, new record, taxonomy, Turkey 1. Introduction collected from genus Muscari in East Anatolia region in Turkey. The Muscari specimens were Muscari Mill. is a genus found in Asparagaceae collected during the flowering period from natural family, and it is distributed over the Europe from populations in Gürpınar district from Van, Turkey. -
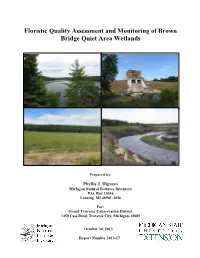
Floristic Quality Assessment and Monitoring of Brown Bridge Quiet Area Wetlands
Floristic Quality Assessment and Monitoring of Brown Bridge Quiet Area Wetlands Prepared by: Phyllis J. Higman Michigan Natural Features Inventory P.O. Box 13036 Lansing, MI 48901-3036 For: Grand Traverse Conservation District 1450 Cass Road, Traverse City, Michigan, 49685 October 30, 2013 Report Number 2013-17 Acknowledgements This work was made possible by a Great Hyde assisted with early surveys and delivery of Lake Restoration Initiative grant through the a workshop for local stewards. Brian Klatt and Environmental Protection Agency, awarded to Glenn Palmgren provided valuable guidance on the Grand Traverse Conservation District in sampling strategies and Reb Ratliff provided Traverse City, Michigan. Many thanks to Robin enthusiastic energy to kick off the field sampling Christensen for writing the grant and for inviting and assemble necessary field gear. Thanks to us to do this work. Suzan Campbell and Daria you all. Cover photos by Phyllis J. Higman, 2012- 2013. Clockwise from left to right: Brown Bridge Pond, Brown Bridge Dam, The Boardman River Coursing through the Brown Bridge Quiet Area after Dam Removal, and Newly Exposed Bottomlands at Brown Bridge Quiet Area after Dam Removal. Copyright 2013 Michigan State University Board of Trustees. Michigan State University Extension programs and materials are open to all without regard to race, color, national origin, gender, religion, age, disability, political beliefs, sexual orientation, marital status, or family status. Table of Contents Table of Contents .................................................................................................................................... -

Plant Science
BULLETIN FALL 2008 VOLUME 54 NUMBER 3 2@2 Collecting for Education: Herbaria at Small Liberal Arts Colleges..................................................86 Botany in Bulgaria...........................................................................................................................91 News from the Annual Meeting Botany 2008 Plenary Address. Solutions from Nature: How Mushrooms can Help Save the World. Paul Stamets.........................................................................93 Regional Botany Special Lecture: Science Education for the 21st Century:Using the Tools of Science to Teach Science. Carl Wieman......................................95 President’s Address, Karl Niklas.....................................................................................96 Awards.............................................................................................................................98 News from the Society And The Survey Says: Taking the Pulse of BSA Members............................................99 BSA Education News and Notes...................................................................................102 Editors Choice: Gynoecial Structure Tutorial Web Site................................................104 Announcements in memoriam Arthur Galston, PhD. (1920-2008)...............................................................105 R.C. Jackson (1928-2009).............................................................................108 Charles Adam Schexnayder (1926-2008).......................................................109 -

Wisconsin Flora Tour Introduction to Course Numbers of Families, Genera
Vascular Flora of Wisconsin 20 January 2009 Wisconsin Flora Tour Introduction to course Numbers of families, genera and species within major groupings in Wisconsin Group Families Genera Species Species Total Native Introduced Cryptogams 13 31 112 0 112 Gymnosperms 3 8 15 2 17 Angiosperms Dicotyledons 115 575 1161 573 1734 Monocots 27 171 601 106 707 TOTAL 158 785 1889 681 2570 Largest families (50 or more taxa) and genera (15 or more taxa) in the Wisconsin flora Family No. of Taxa Genus No. of Taxa Asteraceae 373 Carex (sedge) 168 Poaceae 254 Aster (aster) 80 Cyperaceae 251 Rubus (raspberry) 55 Rosaceae 187 Crateagus (hawthorn) 47 Fabaceae 88 Viola (violet) 33 Brassicaceae 87 Panicum (panic grass) 32 Scrophulariaceae 75 Potamogeton (pondweed) 32 Lamiaceae 72 Salix (willow) 31 Caryophyllaceae 63 Polygonum (smartweed) 30 Orchidaceae 57 Solidago (goldenrod) 30 Ranunculaceaee 53 Juncus (rush) 29 Helianthus (sunflower) 20 Ranunculus (buttercup) 20 Chenopodium (chenopod) 19 Eleocharis (spikerush) 19 Lonicera (honeysuckle) 18 Veronica (veronica) 18 Rosa (rose) 16 Galium (bedstraw) 15 Source: Wisconsin State Herbarium (http://www.botany.wisc.edu/herbarium/) Four major floristic elements in the Wisconsin flora Boreal Alleghenian Ozarkian Prairie Two floristic provinces Northern hardwood Prairie forests Tension Zone Brief look at four plant communities Beech maple or southern mesic Oak forest or southern xeric Prairie Bog or fen Vascular Flora of Wisconsin 22 January 2009 Nomenclature and Vascular Cryptogams I Nomenclature vs. Classification Rank -

Species List
1 of 40 Glasgow Botanic Gardens 21/01/2021 Species List Group Taxon Common Name Earliest Latest Records acarine Brevipalpus oncidii 2019 2019 1 acarine Eriophyes leiosoma 1994 1994 1 acarine Eriophyes tiliae 2011 2011 1 acarine Eriophyes tiliae subsp. tiliae 1994 1994 1 acarine Hydrachnidae 2015 2015 1 amphibian Lissotriton helveticus Palmate Newt 2018 2018 1 amphibian Rana temporaria Common Frog 1963 2018 7 annelid Aporrectodea caliginosa s.l. Grey Worm 2017 2017 1 annelid Eisenia fetida Brandling 1987 1988 2 annelid Hirudinea Leech 2018 2018 1 annelid Lumbricus terrestris Common Earthworm 2017 2017 1 annelid Oligochaeta 2015 2015 1 annelid Stylaria lacustris 1995 1995 1 annelid Tubifex 1994 1994 1 bird Acanthis cabaret Lesser Redpoll 1998 2020 1 bird Accipiter nisus Sparrowhawk 1894 2020 7 bird Actitis hypoleucos Common Sandpiper 1894 1901 1 bird Aegithalos caudatus Long-tailed Tit 1966 2020 16 bird Alauda arvensis Skylark 1894 1901 1 bird Alcedo atthis Kingfisher 1883 2020 31 bird Anas platyrhynchos Mallard 1894 2020 30 bird Anthus pratensis Meadow Pipit 1894 1901 1 bird Apus apus Swift 1894 1998 4 bird Ardea cinerea Grey Heron 1966 2020 11 bird Aythya ferina Pochard 1982 1982 1 bird Aythya fuligula Tufted Duck 1966 2020 2 bird Bombycilla garrulus Waxwing 1966 2020 15 bird Carduelis carduelis Goldfinch 1894 2020 14 bird Certhia familiaris Treecreeper 1894 2017 4 bird Chloris chloris Greenfinch 1894 2020 12 bird Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull 1894 2020 5 bird Cinclus cinclus Dipper 1966 2020 9 bird Coloeus monedula Jackdaw 1894 2020 3 bird Columba livia Feral Pigeon 1966 2020 31 bird Columba oenas Stock Dove 2019 2020 6 2 of 40 Glasgow Botanic Gardens 21/01/2021 Species List Group Taxon Common Name Earliest Latest Records bird Columba palumbus Woodpigeon 1894 2020 29 bird Corvus corone agg. -

A Comprehensive Dataset on Cultivated and Spontaneously Growing Vascular Plants in Urban Gardens
Data in brief 25 (2019) 103982 Contents lists available at ScienceDirect Data in brief journal homepage: www.elsevier.com/locate/dib Data Article A comprehensive dataset on cultivated and spontaneously growing vascular plants in urban gardens * David Frey a, b, , Marco Moretti a a Swiss Federal Research Institute WSL, Biodiversity and Conservation Biology, Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf, Switzerland b Institute of Terrestrial Ecosystems, Department of Environmental Systems Science, ETH Zurich, Universitatstrasse€ 16, 8092 Zürich, Switzerland article info abstract Article history: This article summarizes the data of a survey of vascular plants in 85 Received 2 February 2019 urban gardens of the city of Zurich, Switzerland. Data was acquired Received in revised form 16 April 2019 by two sampling methods: (i) a floristic inventory of entire garden Accepted 1 May 2019 lots based on repeated garden visits, including all vegetation pe- Available online 23 May 2019 riods; and (ii) vegetation releves on two plots of standardized size (10 m2) per garden during the summer. We identified a total of 1081 Keywords: taxa and report the origin status, i.e., whether a taxon is considered Allotment BetterGardens native or alien to Switzerland. Furthermore, the origin of a plant or Home gardens garden population was estimated for each taxon and garden: each Lawn taxon in each garden was classified as being either cultivated or Neophytes spontaneously growing. For each garden, the number of all native, Urban biodiversity cultivated, and spontaneously growing plant species is given, along Vegetation releves with additional information, including garden area, garden type and the landscape-scale proportion of impermeable surface within a 500-m radius. -

Hyacinthaceae
RHSRHS PlantPlant TrialsTrials andand AwardsAwards Hyacinthaceae – little blue bulbs Melanie Dashwood Botanical Recorder, RHS Garden Wisley Brian Mathew Bulb specialist formerly botanist at Royal Botanic Gardens, Kew Bulletin Number 11 September 2005 www.rhs.org.uk RHS Trial of Hyacinthaceae – little blue bulbs Compared to the more ‘traditional’ spring- flowering bulbs, such as daffodils, crocuses The following is a guide to the most commonly cultivated genera of smaller, and snowdrops, the smaller, frost-hardy, hardy Hyacinthaceae: blue-flowered members of the Hyacinthaceae family are perhaps much 1 2 3 less familiar as garden plants. With the exception of a few of the grape hyacinths (Muscari) and squills (Scilla) most of the species in this group are uncommon in gardens, and yet when grown under the right conditions some can be of considerable garden value and interest. Amongst the many specialists on the WW WW WW Rock Garden Plant Trials Sub-committee, 4 5 6 the RHS is fortunate to have the bulb experts Brian Mathew and Chris Brickell, who enthusiastically supported the idea to conduct a trial of the smaller, hardy Hyacinthaceae. In addition to the desire to raise the profile of this interesting group of ‘little blue bulbs’, they considered that a comparative trial might shed light on some of the problems associated with the BM BM identification and naming of certain 7 8 9 species and forms of hardy Hyacinthaceae. The family Hyacinthaceae In the 1980s a botanical review of the large family Liliaceae resulted in the proposal that it should be split up into many smaller families, one of which was BM WW MS Hyacinthaceae.