Natura 2000-Managementpläne in Oberfranken
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
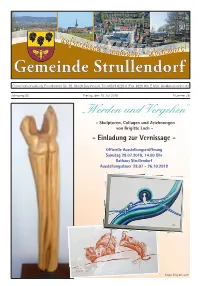
„Werden Und Vergehen“ - Skulpturen, Collagen Und Zeichnungen
Gemeindeverwaltung, Forchheimer Str. 32, 96129 Strullendorf, Tel. 09543-8226-0 (Fax: 8226-90), E-Mail: [email protected] Jahrgang 55 Freitag, den 13. Juli 2018 Nummer 28 „Werden und Vergehen“ - Skulpturen, Collagen und Zeichnungen von Brigitte Loch - - Einladung zur Vernissage - Offizielle Ausstellungseröffnung Samstag 28.07.2018, 14.00 Uhr Rathaus Strullendorf Ausstellungsdauer 28.07 - 26.10.2018 Fotos: Brigitte Loch Strullendorf - 2 - Nr. 28/18 Einladung zum 2. Kerwa-Cup 2018 Das etwas andere Bürgerschießen mit Aussicht auf viel Bier und Schokolade Von 8 – 99 Jahre kann jeder mitmachen, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich Es winken sehr attraktive Preise 1. Preis Kaffeevollautomat im Wert von 599,00 EURO 2. Preis Staubsauger Roboter im Wert von 209,00 EURO 3. Preis 2x Massagegutschein im Gesamtwert von 90,00 EURO Es wird auf einer sehr modernen, vollelektronischen Luftdruckanlage in Zeegendorf geschossen Die Ausschreibung und Anmeldung findet ihr auf unserer Internetseite und in Facebook. Auf geht’s, traut euch. Eure Schützenjugend Zeegendorf Strullendorf - 3 - Nr. 28/18 Immobilien und Baugrundstücke in der Gemeinde Strullendorf Stand: 07/2018 Aktuelle Gesuche: Grundstücke Baugrundstück mit 400-800 m² für freistehendes EFH oder Baugrundstück mit 400-700 m² oder Immobilie bis 800 m² EFH, Immobilie EFH, 100 – 200 m² Wfl. in Strullendorf, Amlingstadt, Geisfeld, freistehend in Strullendorf oder Ortsteil, gerne renovierungs- oder Leesten, Mistendorf, Roßdorf oder Wernsdorf. Angebot an: info@am- modernisierungsbedürftig, kein Denkmalschutz gunselmann.de oder 01782089332 Angebot an: 0175 / 4067310 Baugrundstück ab 650 m² in Geisfeld , anderen Gemeindeteilen von Strullendorfer Familie sucht Haus oder Grundstück in Strullendorf. Strullendorf oder Umgebung gesucht, Tel. 0151 / 23 27 82 45 Bitte alles anbieten, vielen Dank. -

Rebuilding the Soul: Churches and Religion in Bavaria, 1945-1960
REBUILDING THE SOUL: CHURCHES AND RELIGION IN BAVARIA, 1945-1960 _________________________________________________ A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia _________________________________________________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy _________________________________________________ by JOEL DAVIS Dr. Jonathan Sperber, Dissertation Supervisor MAY 2007 © Copyright by Joel Davis 2007 All Rights Reserved The undersigned, appointed by the dean of the Graduate School, have examined the dissertation entitled REBUILDING THE SOUL: CHURCHES AND RELIGION IN BAVARIA, 1945-1960 presented by Joel Davis, a candidate for the degree of Doctor of Philosophy, and hereby certify that, in their opinion, it is worthy of acceptance. __________________________________ Prof. Jonathan Sperber __________________________________ Prof. John Frymire __________________________________ Prof. Richard Bienvenu __________________________________ Prof. John Wigger __________________________________ Prof. Roger Cook ACKNOWLEDGEMENTS I owe thanks to a number of individuals and institutions whose help, guidance, support, and friendship made the research and writing of this dissertation possible. Two grants from the German Academic Exchange Service allowed me to spend considerable time in Germany. The first enabled me to attend a summer seminar at the Universität Regensburg. This experience greatly improved my German language skills and kindled my deep love of Bavaria. The second allowed me to spend a year in various archives throughout Bavaria collecting the raw material that serves as the basis for this dissertation. For this support, I am eternally grateful. The generosity of the German Academic Exchange Service is matched only by that of the German Historical Institute. The GHI funded two short-term trips to Germany that proved critically important. -
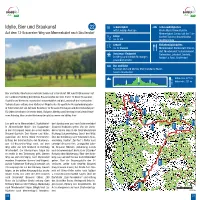
Idylle, Bier Und Braukunst 22
Idylle, Bier und Braukunst 22 !! Schwierigkeit Sehenswürdigkeiten mittel, mäßige Anstiege Kirche Mariä Himmelfahrt in Auf dem 13-Brauereien-Weg von Memmelsdorf nach Strullendorf Memmelsdorf, Landschaft der Frän- Länge kischen Toskana, Brauereikultur, ca. 33 km Skulpturenweg Gehzeit Einkehrmöglichkeiten ca. 10 Stunden Memmelsdorf, Merkendorf, Drosen- dorf, Meedensdorf, Schammelsdorf, Ausgangs-/Endpunkt Tiefenellern, Lohndorf, Geisfeld, Der Weg kann in beide Richtungen Roßdorf a. Forst, Strullendorf gewandert werden Bus und Bahn Buslinien 963 und 969 bis Memmelsdorfer Markt, S-Bahn Strullendorf Höhe max. 572 m 1 3 Höhe min. 251 m 2 350 m Bier und Natur, Oberfranken verbindet beides auf schönste Art. Mit rund 70 Brauereien hat der Landkreis Bamberg die höchste Brauereidichte der Welt. Gleich 13 dieser Brauereien, Gasthöfe und Bierkeller, malerische Fachwerkdörfer und die Landschaft der Fränkischen Toskana liegen entlang einer idyllischen Wegstrecke. Als sportliche Herausforderung oder in Teilstrecken mit viel Zeit zum Einkehren, für Brauerei-Führungen und Bier-Verkostungen: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Übrigens: Montag und Dienstag ist bei vielen Braue- reien Ruhetag. Aber an den Wochenenden gibt es immer ein kühles Bier! 2 1 Los geht es in Memmelsdorf, Bushaltestel- dorf durchqueren und nach Schammelsdorf le „Memmelsdorf Markt“. Der Hauptstraße (Brauerei Knoblach) gehen. Von der Litzen- in den Ort folgend liegen die ersten beiden dorfer Straße links in die Stammbergstraße Brauerei-Gasthöfe Drei Kronen und Höhn, Richtung Schammelsberg. Durch den Wald, gegenüber die Kirche Mariä Himmelfahrt. über den Schönberg nach Tiefenellern (Brau- 3 Entlang der Bahnhofstraße den Markierun- erei Hönig, Gasthof „Zur Post“). Weiter nach gen (13-Brauereien-Weg) nach, auf dem Lohndorf (Brauerei Reh, Landgasthof Lohn- Weg unter der A70 hindurch in Richtung tal, Brauerei Hölzlein). -

Natura 2000-Managementpläne in Oberfranken
Managementplan für das FFH-Gebiet 6032-301 "Mausohrkolonien in Lohndorf, Ehrl und Amlingstadt" Fachgrundlagen Herausgeber: Regierung von Oberfranken Sachgebiet 51 Ludwigstr. 20 95444 Bayreuth Tel.: 0921/604-0 Fax: 0921/604-1289 [email protected] www.regierung.oberfranken.bayern.de Projektkoordination und Andreas Niedling, Regierung von Oberfranken fachliche Betreuung: Matthias Hammer, Koordinationsstelle für Fle- dermausschutz in Nordbayern Bernhard Struck, Landratsamt Bamberg Klaus Then, Landratsamt Bamberg Stand: September 2013 An der Erstellung der Managementpläne beteiligt sich die EU mit dem Europäi- schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) mit 50% der kofinanzierbaren Mittel. Managementplan – Fachgrundlagen FFH-Gebiet 6032-301 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................. I Abbildungsverzeichnis .................................................................................................. II Tabellenverzeichnis ......................................................................................................III 1 Gebietsbeschreibung.................................................................................................. 1 1.1 Kurzbeschreibung und naturräumliche Grundlagen ............................................. 1 1.2 Historische und aktuelle Flächennutzungen, Besitzverhältnisse ........................... 1 1.3 Schutzstatus (Schutzgebiete, -

Legend: BV=A German Village Near the Black Sea
AHSGR American Historical Society of Germans From Russia Germanic Origins Project Legend: BV=a German village near the Black Sea . FN= German family name. FSL= First Settlers’ List. GL= a locality in the Germanies. GS= one of the German states. ML= Marriage List. RN= the name of a researcher who has verified one or more German origins. UC= unconfirmed. VV= a German Volga village. A word in bold indicates there is another entry regarding that word or phrase. Click on the bold word or phrase to go to that other entry. Red text calls attention to information for which verification is completed or well underway. Push the back button on your browser to return to the Germanic Origins Project home page. Le-Lhz last updated March 2015 Lea?{Anton}: said by Recruiter Beauregard’s list to have been fromUC Stein (Lk61). Not found in any FSL and I could not find them or any likely descendant associated with any Volga colony. Lebach?, [Kur-]Trier: an unidenified place said by the Hoelzel FSL to be homeUC to a Schaefer family. This likely would have been 26 miles SE of Trier city. LebbenGL: see Lebbin. LebbinGL, [Kur-]Brandenburg: is some 27 miles SE of Berlin city center, and said by the Dinkel FSL to be homeUC to a Reinhard family. Said by the Jost FSL to be homeUC to Jerke and Meisner families. Luebben?GL, Brandenburg: said by the Jost FSL to be homeUC to an Eismann family; I am guessing this was Lebbin, since the only Luebben I can find was in Kursachsen. -

== File: Baden-Wuerttemberg.Osm== Leinzell
== File: baden-wuerttemberg.osm== Leinzell (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.8481691&lon=9.8744058&zoom=13&layers=B00FTF Lampoldshausen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.2644733&lon=9.401743&zoom=13&layers=B00FTF Schmiechen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.3619755&lon=9.718584&zoom=13&layers=B00FTF Aasen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.9815384&lon=8.5536472&zoom=13&layers=B00FTF Steinweiler (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.7324411&lon=10.2646639&zoom=13&layers=B00FTF Dogern (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.6167&lon=8.16667&zoom=13&layers=B00FTF Dautmergen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.2325091&lon=8.750052&zoom=13&layers=B00FTF Dunningen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.2119538&lon=8.5058067&zoom=13&layers=B00FTF Niederrimbach (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.4746972&lon=9.9962608&zoom=13&layers=B00FTF Ratzenried (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.7205111&lon=9.9005783&zoom=13&layers=B00FTF Nimburg (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.1049349&lon=7.7748184&zoom=13&layers=B00FTF Kleingartach (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.0993393&lon=8.9731444&zoom=13&layers=B00FTF Erzingen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.6605789&lon=8.4250728&zoom=13&layers=B00FTF Bettenfeld (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.3407293&lon=10.1276214&zoom=13&layers=B00FTF Oggelshausen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.0712874&lon=9.6491112&zoom=13&layers=B00FTF Riedbach -

Liniennetz Landkreis Bamberg Stand: 01.01.2015 945 Pfaffendorf
Liniennetz Landkreis Bamberg Stand: 01.01.2015 945 Pfaffendorf Ebern R26 R15 R15 Regionalbahn mit Haltestelle innerhalb des VGN 956 Oberhaid Poppendorf S-Bahn mit Haltestelle innerhalb Losbergs- S1 S1 Busendorf R2 Lichtenfels des VGN Bühl gereuth Bamberg Hofstetten Schney R26 R25 Lichtenfels Köslau Schienenstrecke außerhalb des VGN Rentweinsdorf Mürsbach Redwitz 942 956 Speiersberg R35 Lichtenfels 1214 Lichtenfels Rentweinsdorf 952 Buslinie mit Haltestelle innerhalb 945 Mainroth Pettstadt Kirch- Zaugendorf 968 Weismain Viereth des VGN 945 lauter Goggel- Mauschen- Kottenbrunn dorf Sendelbach Medlitz gereuth 956 957 Dörflis 941 Salms- Manndorf OVF 8163 Buslinie mit Richtungsangabe dorf Bojendorf Arnstein 1214 leiterbach 968 Würzburg außerhalb des VGN Neubrunn Freudeneck Unter- Endhaltestellen Scheßlitz Gerach Laimbach Ober- Mährenhüll Hasenmühle 962 Wattendorf Stadtverkehr ohne Liniendarstellung Kottendorf 962 946 Reuthlos Reckendorf Höfen Roschlaub Roßdach Breitbrunn Rattelsdorf Kirchschletten Weichenwasserlos Pfaffendorf 956 Zapfendorf Endhaltestellen Bamberg Edel- Lußberg Priegen- Pausdorf brunn dorf Reckenneusig Oberoberndorf Stübig Ebing Ort Lauf Schederndorf R2 R15 R25 R26 R35 S1 942 Windisch- Stadelhofen Rudendorf Daschendorf Roth Schweisdorf Gräfenhäusling 963 947 Krappenhof letten Dorgen- Ebing Ehrl Burglesau Wölken- dorf dorf Wotzendorf Leppelsdorf 962 Roßdorf a. Berg Sassendorf 968 Baunach Burgellern 963 Hohengüßbach Eichenhüll R26 Würgau Deusdorf 969 Steinfeld Scheßlitz Godeldorf 953 Starkenschwind 810 Würzburg Zückshut 972 Lauter -

^Sidérant Que La Directive 75/270/CEE, Du 28 Avril
19.7.82 Journal officiel des Communautés européennes N° L 210 / 23 COMMISSION DECISION DE LA COMMISSION du 23 juin 1982 portant remplacement de l'annexe à la directive 75 / 270 / CEE du Conseil , relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75 / 268 / CEE du Conseil ( Allemagne ) ( Le texte en langue allemande est le seul faisant fois ) ( 82 / 462 / CEE ) ^ COMMISSION DES COMMUNAUTES considérant que la nouvelle liste , qui couvre la même EUROPÉNNES , superficie que la liste en vigueur jusqu'ici , ne modifie nullement les limites des zones figurant dans l'ancienne le traité instituant la Communauté économique euro péene , liste ; considérant que les mesures prévues dans la présente u la directive 75 / 268 / CEE du Conseil , du 28 avril décision sont conformes à l'avis du comité permanent des / 5 , sur l'agriculture de montagne et de certaines zones structures agricoles , favorisées (' ), modifiée de dernier leur par la direc te 80 / 666 / CEE ( 2 ) et noamment son article 2 para A ARRÊTE LA PRESENTE DECISION : graphe 3 ? ^sidérant que la directive 75 / 270 / CEE , du 28 avril Article premier , ' 5 , relative à la liste communautaire des zones agrico La liste des zones défavorisées de la république fédérale les défavorisées au sens de la directive 75 / 268 / CEE d'Allemagne , figurant à l'annexe de la directive 75 / I ^emagne ) ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la décision de 270 / CEE , est remplacée par la liste figurant à l'annexe de a Commission 81 / 931 / CEE ( 4 ), contient dans son la présente décision . -

Wandertagestouren 15 Themenwege Zwischen 4 Und 32 Kilometer Rund- Und Zielwanderungen
Wandertagestouren 15 Themenwege zwischen 4 und 32 Kilometer Rund- und Zielwanderungen ERLEBEN www.fraenkische-schweiz.com Fränkische Schweiz Wandertouren – Inhaltsverzeichnis Willkommensgruß Liebe wanderbegeisterte Gäste, „Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch In diesem Heft fi nden Sie 15 Tages- Impressum wirklich gewesen.” tourenvorschläge mit unterschied- Herausgeber: Layout und Satz: lichen Themen, Längen und Das wusste schon Johann Wolf- Tourismuszentrale Venus.Werbeagentur GmbH Schwierig keitsgraden – da ist auf gang von Goethe. Und so lässt sich Fränkische Schweiz jeden Fall für Sie etwas dabei! Druck: die Fränkische Schweiz am besten Oberes Tor 1 1. Aufl age Juni 2016: 50.000 erwandern. Mehr als 4000 Kilometer Wir freuen uns, wenn Sie eine schöne 91320 Ebermannstadt Druckerei: Creo Druck Bamberg markierte Wanderwege durch anmu- Zeit bei uns haben und wünschen Tel 09191 861054 Bildnachweis: tige Täler, Dörfer und Berglandschaf- Ihnen tolle Wandererlebnisse! [email protected] Fotos: frankentourismus/FRS/Hub ten mit bis zu 400 Metern Höhenun- Ihre Tourismuszentrale und Tourenbilder der beteiligten terschied machen den besonderen Fränkische Schweiz www.fraenkische-schweiz.com Touristinfos, Adobe Stock: Petair Reiz dieses Wandergebiets aus. Das Wiesenttal Inhaltsverzeichnis Allgemein TOUR 9 / 13,4 km Plecher Höhenweg ________________________ 24 Willkommensgruß __________________________ 3 TOUR 10 / 5,9 km Übersichtskarte Therapeutischer Wanderweg mit allen Touren ___________________________4 - 5 Pitztal ___________________________________________ -

Pfister Alexander, M.A., Lehrer, Roßdorf A
Am 16. März sind Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen: BÜRGER WÄHLEN Freie Wählergemeinschaft BÜRGER Wahlvorschlag Nr. 05 BLOCK e.V. Kennwort BÜRGERBLOCK Strullendorf . Zeegenbachtal O Freie Wählergemeinschaft Bürgerblock e. V. (FWB) Pfister Alexander, M.A., Lehrer, Roßdorf a. Forst Werner Ludwig, Industriefachwirt, Abteilungsleiter, Zweiter Bürgermeister, Gemeinderat, Roßdorf a. Forst Bohlein Stephan, Kaufm. Angestellter, Strullendorf Unser Bürgermeisterkandidat: Lunz Gerhard, Postbetriebsinspektor, Gemeinderat, FF-Kdt., Leesten Haas Werner, Werkzeugmachermeister, Gemeinderat, Wernsdorf ALEXANDER Simmerlein Irene, Rechtsanwaltsfachangestellte, Wernsdorf Hofmann Tobias, Industriekaufmann, Geisfeld Schmitt Uwe, Laborant (Forschung), Strullendorf PFISTER Willibald Schick, Betonbauer, Zeegendorf Oppelt Wolfgang, Bezirkskaminkehrermeister, Mistendorf Eulich Kerstin, Rechtsanwaltsfachangestellte, Amlingstadt unabhängig Sauer Roland, Vertriebsbeauftragter, Strullendorf , Metallbauer, Zeegendorf Kestler Thomas weitsichtig Dorsch Christian, Fleischer, Leesten Bauernschmitt Maria, Hausangestellte, Zeegendorf kompetent Held Hartmut, selbständiger Apotheker, Strullendorf Essel Karlheinz, Bankkaufmann, Amlingstadt bürgernah Dr. med. Rück Werner, Arzt für Allgemeinmedizin/Sportmedizin, Strullendorf Erhardt Gabi, Kinderbetreuerin, Roßdorf a. Forst Sauer Kathrin, Industriekauffrau, Wernsdorf So wählen Sie richtig: Pfister, Alexander Freie Lehrer, M.A. Wählergemeinschaft Kleeanger 4, 96129 Strullendorf Roßdorf a. Forst Bürgerblock e.V. (FWB) BÜRGER -

BR-Drucksache 396/09
Bundesrat Drucksache 396/09 27.04.09 EU - A - U - Vk - Wi Vorlage der Bundesregierung Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für eine aktualisierte Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung für die alpine, atlantische und kontinentale Region1) Bundesministerium für Umwelt, Berlin, den 24. April 2009 Naturschutz und Reaktorsicherheit An den Präsidenten des Bundesrates Herrn Ministerpräsidenten Peter Müller Sehr geehrter Herr Präsident, gemäß § 5 Abs. 2 EUZBLG bitte ich Sie um die Stellungnahme des Bundesrates zu den deutschen Teilen der dritten fortgeschriebenen Listen von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung für die alpine, atlantische und kontinentale biogeographische Region. Zur Erläuterung bemerke ich Folgendes: Mit Schreiben vom 10. März 2009 hat die Europäische Kommission dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit die Entwürfe der Deutschland betreffenden Teile der zum dritten Mal aktualisierten Listen von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung (so genannte FFH-Gebiete) für die alpine, atlantische und kontinentale Region zugesandt und darum gebeten, dazu das Einvernehmen gemäß Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH- Richtlinie) zu erteilen (Anlage 1). 1) Vgl. Richtlinie des Rates zum Schutz der natürlichen und naturnahen Lebensräume sowie der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten (FFH-Richtlinie) BR-Drucksachen: 445/88 = AE-Nr. 881678; 135/91 = AE 910526; 447/97 = AE-Nr. 971760; 581/03 = AE-Nr. 032702; 161/04 = AE-Nr. 040611; 320/04 = AE-Nr. 041388; 288/07 = AE-Nr. 070404 Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln Telefon: (02 21) 97 66 83 40, Telefax: (02 21) 97 66 83 44 ISSN 0720-2946 Drucksache 396/09 - 2 - Die Entwürfe (Anlagen 2-4) umfassen ausschließlich auf Vorschlag der Länder sowie in der AWZ auf Vorschlag des Bundesamtes für Naturschutz von der Bundesregierung nach Art. -

Amlingstadt Mobil!
Amlingstadt mobil! Ihre Fahrmöglichkeiten mit dem Bus nach Bamberg und Strullendorf und zurück und innerhalb der Gemeinde Von Amlingstadt nach Bamberg VGN-Linie 975 Von Amlingstadt nach Strullendorf - kostenfrei + für jedermann Schulbus Strullendorf Montag – Freitag (nicht 15.08.) Samstag Verkehrshinweis S S S Amlingstadt, Schule 13.00 Amlingstadt, Bushaltestelle 06.04 06.58 08.21 12.03 13.03 14.53 14.54 Leesten I I I I I I I Wernsdorf I I I I I I I Strullendorf, Lindenallee I 06.59 08.26 I I I 14.59 Strullendorf, Abzw. Bahnhof I 07.00 12.10 I 15.10 Strullendorf, Schule I I 12.12 13.10 Bamberg, Geisfelder Str. I 07.08 Bamberg, Robert-Bosch-Str. 06.15 07.10 Bamberg, G-Stauffenberg-Schulen 06.16 07.11 Bamberg, Willy-Lessing-Str. I 07.15 Bamberg, Bahnhof/Atrium 06.20 07.18 0 Nutzen Sie auch das E-Mobil der Gemeinde Strullendorf! Sie können bei der Gemeinde Strullendorf einen elektrogetriebenen BMW i3 stundenweise, für einen ganzen Tag, für ein Wochenende oder eine ganze Woche ausleihen. Der Standort des Fahrzeuges ist am Rathaus Strullendorf. Die Kosten für die Ausleihe: - jede angefangene Stunde 5 €, - ein Tag 25 €, - ein Wochenende 69 €, - eine Woche 169 €. Ausleihe und Infos über Herrn Zeitler, Tel: 09543/8226-21 in der Gemeindeverwaltung. Von Bamberg nach Amlingstadt VGN-Linie 975 Von Strullendorf nach Amlingstadt - kostenfrei + für jedermann Schulbus Strullendorf Montag – Freitag (nicht 15.08.) Samstag Verkehrshinweis S S S Bamberg Bahnhof/Post BA, Bahnhof/Atrium 11.33 16.41 18.00 BA, Graf-Stauffenberg-Schulen 11.35 16.44 18.03 BA, Robert-Bosch-Str.