4. Die Carnuntiner Canabae – Luftbilder Und Grabungsbefunde Im Vergleich
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aufteilung Gemeinden Niederösterreich
Gemeinde Förderbetrag Krems an der Donau 499.005 St. Pölten 1.192.215 Waidhofen an der Ybbs 232.626 Wiener Neustadt 898.459 Allhartsberg 38.965 Amstetten 480.555 Ardagger 64.011 Aschbach-Markt 69.268 Behamberg 60.494 Biberbach 41.613 Ennsdorf 54.996 Ernsthofen 39.780 Ertl 23.342 Euratsfeld 48.110 Ferschnitz 31.765 Haag 101.903 Haidershofen 66.584 Hollenstein an der Ybbs 31.061 Kematen an der Ybbs 47.906 Neuhofen an der Ybbs 53.959 Neustadtl an der Donau 39.761 Oed-Oehling 35.097 Opponitz 18.048 St. Georgen am Reith 10.958 St. Georgen am Ybbsfelde 51.812 St. Pantaleon-Erla 47.703 St. Peter in der Au 94.276 St. Valentin 171.373 Seitenstetten 61.882 Sonntagberg 71.063 Strengberg 37.540 Viehdorf 25.230 Wallsee-Sindelburg 40.446 Weistrach 40.557 Winklarn 29.488 Wolfsbach 36.226 Ybbsitz 64.862 Zeillern 33.838 Alland 47.740 Altenmarkt an der Triesting 41.057 Bad Vöslau 219.013 Baden 525.579 Berndorf 167.262 Ebreichsdorf 199.686 Enzesfeld-Lindabrunn 78.579 Furth an der Triesting 15.660 Günselsdorf 32.320 Heiligenkreuz 28.766 Hernstein 28.192 Hirtenberg 47.036 Klausen-Leopoldsdorf 30.525 Kottingbrunn 137.092 Leobersdorf 91.055 Mitterndorf an der Fischa 45.259 Oberwaltersdorf 79.449 Pfaffstätten 64.825 Pottendorf 125.152 Pottenstein 54.330 Reisenberg 30.525 Schönau an der Triesting 38.799 Seibersdorf 26.619 Sooß 19.511 Tattendorf 26.674 Teesdorf 32.727 Traiskirchen 392.653 Trumau 67.509 Weissenbach an der Triesting 32.005 Blumau-Neurißhof 33.690 Au am Leithaberge 17.474 Bad Deutsch-Altenburg 29.599 Berg 15.938 Bruck an der Leitha 145.163 Enzersdorf an der Fischa 57.236 Göttlesbrunn-Arbesthal 25.915 Götzendorf an der Leitha 39.040 Hainburg a.d. -

AGREEMENT Between the European Community and the Republic Of
L 28/4EN Official Journal of the European Communities 30.1.2002 AGREEMENT between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the Community, and THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter referred to as South Africa, hereinafter referred to as the Contracting Parties, WHEREAS the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, has been signed on 11 October 1999, hereinafter referred to as the TDC Agreement, and entered into force provisionally on 1 January 2000, DESIROUS of creating favourable conditions for the harmonious development of trade and the promotion of commercial cooperation in the wine sector on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity, RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in this sector which will permit further development at a later stage, RECOGNISING that due to the long standing historical ties between South Africa and a number of Member States, South Africa and the Community use certain terms, names, geographical references and trade marks to describe their wines, farms and viticultural practices, many of which are similar, RECALLING their obligations as parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation (here- inafter referred to as the WTO Agreement), and in particular the provisions of the Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement), HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Description and Coding System (Harmonised System), done at Brussels on 14 June 1983, which are produced in such a Objectives manner that they conform to the applicable legislation regu- lating the production of a particular type of wine in the 1. -

275 Bruck/Leitha
Bruck/Leitha - Potzneusiedl - Hainburg/Donau 275 gültig bis 2.11.2021 Betreiber: Österreichische Postbus AG, Kundeninformation: Tel.: 05 1717 Alle Angaben ohne Gewähr. Montag - Freitag Kursnummer 101 103 107 145 105 109 111 113 115 117 119 121 123 125 129 127 143 131 133 135 Verkehrshinweis ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ yo ▲ ▲ R700 Wien Hauptbahnhof ab 5.39 8.15 10.45 11.45 12.15 12.15 12.45 12.45 13.45 14.18 R700 Bruck an der Leitha an 6.06 8.42 11.12 12.12 12.42 12.42 13.12 13.12 14.12 14.47 Bruck/Leitha Bahnhof (C) 5.09 6.14 8.52 11.20 12.15 12.47 12.52 13.20 13.22 14.20 14.52 Bruck/Leitha Dr.-Th.-Körner-Platz 5.11 6.16 8.54 11.22 12.17 12.49 12.54 13.22 13.24 14.22 14.54 Bruck/Leitha Gymnasium/HAK 13.16 15.35 Bruck/Leitha Neue Mittelschule 13.18 15.37 Bruck/Leitha Hauptplatz 5.13 6.18 8.56 11.24 12.19 12.51 12.56 13.20 13.24 13.26 14.24 14.56 15.39 Bruck/Leitha Eco-Plus-Park 5. Straße 5.17 6.22 9.00 11.28 12.23 12.55 13.30 14.28 15.00 15.43 Bruck/Leitha Eco-Plus-Park 2.Straße 5.18 6.23 9.01 11.29 12.24 12.56 13.31 14.29 15.01 15.44 Pachfurth Kapelle 5.22 6.27 7.00 9.05 11.33 12.28 13.00 13.05 13.29 13.33 13.35 14.33 15.05 15.48 Pachfurth Bahnstraße 7.02 Pachfurth Kirche 5.23 6.28 7.04 9.06 11.34 12.29 13.01 13.06 13.30 13.34 13.36 14.34 15.06 15.49 Gerhaus Kriegerdenkmal 5.25 6.30 7.06 9.08 11.36 12.31 13.03 13.08 13.32 13.36 13.38 14.36 15.08 15.51 Rohrau Schloss 5.27 6.32 7.08 9.10 11.38 12.33 13.05 13.10 13.34 13.38 13.40 14.38 15.10 15.53 Rohrau Untere Hauptstraße 5.28 6.33 7.09 9.11 11.39 12.34 13.06 13.11 13.35 13.39 13.41 14.39 15.11 15.54 -

FH) Norbert Koller
LEADER-Projekt: EnergieReiches Römerland Carnuntum Phase 1 / 2016-2017 ENERGIEREGIONSTAG 2017 29.09.2017, Römerstadt Carnuntum Ideenplattform, Blick in die Zukunft Mag. (FH) Norbert Koller www.energiepark.at1 AGENDA „Ich würde mein Geld auf die Sonne und die Solartechnik setzen. Was für eine Energiequelle! Ich hoffe, wir müssen nicht erst die Erschöpfung von Erdöl und Kohle abwarten, bevor wir das angehen.“ Thomas Alva Edison, 1931 • Klimaziele EU/Österreich • LEADER-Projekt „EnergieReiches Römerland Carnuntum“ (Phase 1) - ein Rückblick • „Wir sind Energiezukunft!“ – Was wir gemeinsam realisieren wollen 2 KLIMAZIELE 2020->2030->2050 EU / Österreich • Verringerung der TreibHausGasemissionen (THG) um mindestens (EU/AT) 20% (2020) -> 40% (2030) -> 80% (2050) gegenüber 1990 21% (2020) -> ? (2030) -> ? (2050) • Energie aus erneuerbaren Quellen (EU/AT) 20% (2020) -> 27% (2030) -> ? (2050) 34% (2020) -> ? (2030) -> ? (2050) • Steigerung der Energieeffizienz um (EU/AT) 20% (2020) -> 27% (2030) -> ? (2050) 20% (2020) -> ? (2030) -> ? (2050) 3 ENERGIEREICHES RÖMERLAND C. Erneuerbare vs. Fossil: ca. 35%/65% ca. € 47 Mio. – Kapitalabfluss / Jahr oder € 0,05 / kWh therm. 4 ENERGIEREICHES RÖMERLAND C. Theoretisches, regionales Solarpotential: ca. 263 MWp (AT 2016: 1.077 MWp) 5 ENERGIEREICHES RÖMERLAND C. 3x 1-Tages Camp für Schulklassen 1x 3-Tages Camp in den Sommerferien: 81 Kinder/Jugendliche…und viel Spass!! 6 ENERGIEREICHES RÖMERLAND C. Jän. 2017: Präsentation der innovativen Wärme/Kälte-Anlage bei VW Kamper Bruck/Leitha + Betriebsführung 7 WIR SIND ENERGIEZUKUNFT - > 2030 Alternative Mobilität (E-Mobilität, Ladestationen, Mikro ÖV, E-car sharing,…) Hainburg a. d. Donau Höflein Petronell-Carnuntum Zwölfaxing Au am Leithaberge Berg Bruck a. d. Leitha Göttlesbrunn-Arbesthal e-car sharing Gramatneusiedl Bruck a. d. Leitha Prellenkirchen Fischamend Enzersdorf a. -

Press Kit the Rubin Carnuntum Wine Estate
PRESS KIT THE RUBIN CARNUNTUM WINE ESTATE Information: Wine&Partners, 0043 1 369 79 900 Index 1. The Origins of „Carnuntum“ 1 2. Ancient Carnuntum 2 3. Wine Growing in Ancient Carnuntum 3 4. Carnuntum in the 20th Century 5 5. Viniculture in 21st Century Carnuntum 7 6. The Association of Rubin Carnuntum Vintners 8 7. Carnuntum Terroir 11 8. CARNUNTUM EXPERIENCE 13 9. Wineries, Brands and Distribution 14 10. General Information 16 1. The Origins of „Carnuntum“ The wine growing area of Carnuntum is situated east of Vienna, just south of the Danube River. Here are three hill locations devoted to viticulture: the Leithagebirge, the Arbesthaler Hügelland and the Hundsheimer Berge. The stony chalk and loess soils together with the climatic influences of the nearby Pannonian plain and the Neusiedlersee, or Lake Neusiedl, provide ideal conditions for wine growing. The name of Carnuntum actually refers to the Roman colony that was located in what is now Petronell- Bad Deutsch-Altenburg. In this area, numerous excavations in recent times have turned up ancient amphitheater and temple ruins that defer to the time when the first grapevines were planted here. The symbol of Carnuntum - Austria’s most famous Roman landmark - is the Heidentor. Although its name refers to a city “door” or “gate”, it actually was built as a monument to Emperor Constantius II (354-361 A.D.). 1 2. Ancient Carnuntum Founded as a fortified winter camp in 6 A.D., Carnuntum developed over the next few centuries into one of the most important cities of the Roman empire. Built at the intersection of the Amber and Limes roads, this budding city became a Danube metropolis at the end of the 2nd century A.D. -

1168-05 PP B9 Eisenbahnkreuzung ASZ M200 2018-07-20
LEGENDE EINFAHRT / Kataster AUSFAHRT Bestand Projekt Linien Projekt Fahrbahnen Asphaltbauweise Projekt Bankett Projekt Bodenmarkierung Bauverbotsbereich ÖBB erforderliche Grundabtretung Flugdach Gst 1709 EZ 43 Stadtgemeinde Hainburg an der Donau, 1/1 Hauptpl. 23 2410 Hainburg an der Donau Container Gst 643 EZ 441 Container KG Wolfsthal KG Hainburg/Donau Gst 646 Gst 645/1 EZ 125 EZ 559 Gst 645/3 Pinkl Johann (1962), 1/1 Mayer & Co GmbH (FN 128639a), 1/1 EZ 559 Gst 645/4 Gst 644/1 Mayer & Co GmbH (FN 128639a), 1/1 Gst 644/2 Hauptpl. 4 Seibersdorferstraße 6 EZ 441 EZ 441 Container Seibersdorferstraße 6 EZ 441 Gst 1824 2410 Hainburg an der Donau 2451 Hof am Leithaberge Stadtgemeinde Hainburg an der Donau, 1/1 2451 Hof am Leithaberge EZ 300 Hauptpl. 23 Flugdach Schwarz Karl (1943), 1/2 2410 Hainburg an der Donau Container Container Schwarz Maria (1947), 1/2 Weg Leyrerg. 11 2410 Hainburg an der Donau Gst 1826 Gst 1829 Gst 647 EZ 299 EZ 500 Newald Friederike (1938), 1/1 Tomaschitz Johannes (1959), 1/1 EZ 125 Gst 1830 Römerg. 28 Untere Hauptstraße 62 Gst 649/1 Pinkl Johann (1962), 1/1 EZ 500 2410 Hainburg a.d. Donau 2421 Kittsee Tomaschitz Johannes (1959), 1/1 Gst 650 EZ 1521 Hauptpl. 4 Untere Hauptstraße 62 Resch Reinhard (1964), 1/1 2410 Hainburg an der Donau EZ 2167 Gst 1853 2421 Kittsee Schwarz Karl (1943), 1/2 Obere G. 26 EZ 50 Schwarz Maria (1947), 1/2 2412 Wolfsthal Gemeinde Wolfsthal, 1/1 Leyrerg. 11 Hauptstr. 42 Gst 1831 2410 Hainburg an der Donau 2412 Wolfsthal EZ 513 GRENZE BAUVERBOTSBEREICH ÖBB Jöstl Karl (1951), 1/1 Gst 1833 Gst 1834 Andau, Baumhöheg. -

Wildgewordene Jäger Ballern Im Ortsgebiet!
PERFEKT FENSTER GMBH Donaulände 35, 2410 Hainburg an der Donau,Tel.: +43 2165 63193 Nr. 5/2017 - Montag, 29. Mai 2017 - Auflage 50.703 - Bockfließerstraße 60 www.perfekt-fenster.at, [email protected], www.actual.at 2214 Auersthal - Tel. 02288/200 91-17 - Fax: DW 15 - [email protected] Nicht alles was nicht verboten ist, ist automatisch auch intelligent! Wildgewordene Jäger ballern im Ortsgebiet! Pleininger neuer Vize Neuer Vize-Generaldirektor der OMV ist AKTIONSPREISE! seit der jüngsten Aufsichtsratssitzung der ^ƉĂŶŶďĞƌŐĞƌ džƉůŽƌĂƟŽŶƐͲsŽƌƐƚĂŶĚ ĚĞƐ € Unternehmens, Johann Pleininger. S. 11 120,- für Ihren Schrott!* *Preis gültig ab 1.000 kg bis Ende Juni 2017 Nazi oder schlampig Gegen den Vorwurf, er sei ein Neonazi REDO SCHROTTHANDEL wehrt sich der zurückgetretene Kandidat Gewerbegasse 1, 2292 Engelhartstetten, Telefon 02214 / 20 163 für die Jus-Studentenvertretung, ÖVP- Gemeinderat Alexander Grün aus Lassee. E-Mail: offi[email protected], www.redo-schrott.at Alles zur NR-Wahl ůůĞƐǁĂƐnjƵŵĚĞƌnjĞŝƟŐĞŶĞŝƚƉƵŶŬƚĨƺƌ ĚŝĞEĂƟŽŶĂůƌĂƚƐǁĂŚůĂŵϭϱ͘KŬƚŽďĞƌĂƵƐ regionaler Sicht spannend sein könnte lesen Sie auf den Seiten 14 - 17 und 22. Flohmarkt in gans GF Flohmarkt in gaaaaans Gänserndorf lau- Industriestrasse 1 . 2292 Engelhartstetten ƚĞƚĚĂƐDŽƩŽĚĞƌŶćĐŚƐƚĞŶǁĞƌďĞͲƚĞĂŵͲ ŬƟŽŶĂŵϵ͘ƵŶĚϭϬ͘:ƵŶŝ͘tĞƌĚĂĂůůĞƌ Tel. 0664/94 22 802 . E-Mail: [email protected] ŵŝƚŵĂĐŚƚůĞƐĞŶ^ŝĞĂƵĨĚĞƌ^ĞŝƚĞϵ͘ www.redos-waschcenter.at DAS NEUE SPEKTAKEL Willkommen bei unserem Online-Buchhandel IM DURCHSICHTIGEN ZELT equem von zuhause stöbern und bestellen randaktuelle Romane, Krimis, Kochbücher etc. NEU! esseres urechtnden durch ouchunktion GRILLEN ODER THEATER? GÄNSERNDORF estseller is machen ust zum esen Weitere Informationen IN MARCHEGG GEHT BEIDES! Dr. W. Exnerplatz 6 Eingang Strassergasse litzschnelle ieerun unter 0664/12 11 536! 6. -
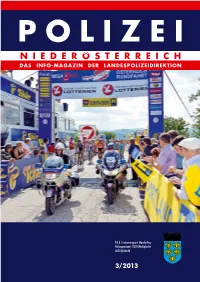
N I E D E R O S T E R R E I
POLIZEI NIEDEROSTERREICH DAS INFO-MAGAZIN DER LANDESPOLIZEIDIREKTION P.b.b. Erscheinungsort: Munderfing Verlagspostamt: 5230 Mattighofen 02Z030400 M 3/2013 INHALT Die in NIEDERÖSTERREICH 3 11 67 Sicherheitstag im Bez. Korneuburg Kapellmeister Franz Herzog ist 50! Safety-Tour 2013 Informationsblatt für die Angehörigen des Aktiv- und Ruhestan- EUROPOL LAW des sowieENFORCEMENT für die Freunde und Förderer der Exekutive Nieder- österreichs. AKTUELLES NETWORK TOOL MAGAZINE EDITORS’ Hochwasser 2013 . 2 Sicherheitstag im Bezirk Korneuburg . 3 EUROPOL LAWENFORCEMENT FBM besucht Dienststellen ihres Heimatbundeslandes . 4 Neue Inspektionskommandanten bei der LPD NÖ . 5 3/2013 · September 2013 Neue Funktionsperiode der Gleichbehandlungsbeauftragten . 6 Auszeichnungsfeier bei der Landespolizeidirektion NÖ . 7 NETWORKING TOOL MAGAZINE EDITORS’ Mag.a Karin Renner besucht die Landespolizeidirektion NÖ . 8 NÖ Sicherheitsverdienstpreis 2012 . 8 Herausgeber: Lebensrettung bei Golfturnier . 10 Landespolizeidirektion für Niederösterreich Sicherheitsgipfel in Bruck/Leitha . 10 3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 15 Kapellmeister Franz Herzog feiert seinen 50. Geburtstag . 11 Übergabe des neuen Jahrbuches „Die Polizei in Niederösterreich“ . 12 Redaktion: 5. NÖ Sicherheitsfachtagung – Diebstahl von Fahrrädern . 15 Dieter Höller, Tel. 059 133/301110; Waffengesetz – Verlässlichkeitsüberprüfung . 15 E-Mail: [email protected] TRAISKIRCHEN Johann Baumschlager, Tel. 059 133/ 301112; Eine Chance für Traiskirchen . 16 E-Mail: [email protected] FREUNDE & FÖRDERER Für den Inhalt verantwortlich: Ehrungsfeier der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Exekutive Niederösterreichs 18 Die Redaktion (sofern im Einzelfall nicht besonders gekenn- zeichnet) und die Gesellschaft der Freunde und Förderer der RUHESTAND & GEBURTSTAGE Exekutive Niederösterreichs (farblich gekennzeichneter Son- Ruhestand: Josef Streyrer und Franz Hollaus verabschieden sich in den Ruhestand . 21 derteil) AbtInsp iR Alois Haider – 90. Geburtstag . 22 BezInsp iR Alois Peneder – 85. -

(Bauhof) Jeden 2.Sa Von 8-12 U
ANHANG 1 Gemeinde Adresse Öffnungszeiten 2451 Au/Lbg Au am Leithaberge Seibersdorfer Str. (Bauhof) jeden 2.Sa von 8‐12 Uhr 2405 B.D.Altenburg Emil‐Hofmann‐Gasse Bad Deutsch Altenburg 13 (Bauhof) abwechselnd Sa von 8‐10 Uhr und Mi von 12.30‐14.30 Uhr 2413 Berg Berg Pelzgarten 3 (Bauhof) jeden 1.Sa im Monat von 8‐10 Uhr zusätzlich: von April bis November jeden Donnerstag von 15 bis 16 Uhr 1 A-2460 Bruck an der Leitha Stefaniegasse 2 Telefon: 02162-65556 Fax: 02162-65560 [email protected] www.gabl.gv.at 2460 Bruck/L. Industriegelände West Bruck an der Leitha (neben Kompostanlage) jeden Mo von 7‐12 und 13‐15.30 Uhr jeden Fr von 7‐12 Uhr jeden Sa von 8‐11.30 Uhr Enzersdorf an der Fischa 2431 Enzersdorf/F. ASZ Enzersdorf Reisenbachsiedlung 14‐tägig abwechselnd: Mi 8‐12 Uhr und Sa 8‐12 Uhr 2433 Enzersdorf an der Fischa Margarethen/M., Alte ASZ Margarethen Kläranlage 14‐tägig abwechselnd: Mi 8‐12 Uhr und Sa 8‐12 Uhr 2 A-2460 Bruck an der Leitha Stefaniegasse 2 Telefon: 02162-65556 Fax: 02162-65560 [email protected] www.gabl.gv.at 2464 Göttlesbrunn Göttlesbrunn‐Arbesthal Schulgasse 4 (Bauhof) jeden Samstag von 8‐11 Uhr jeden 2. Mittwoch von 8‐10 Uhr 2434 Götzendorf Götzendorf/L. Trautmannsdorfer Str. (Bauhof) jeden 2. Mi von 13‐17 Uhr jeden 2. Sa von 8‐12 Uhr (Nov‐ Mär) bzw. 7‐12 Uhr (Apr‐Okt) 2410 Hainburg/D. Hainburg/D. Deponie an der B9 Di u. Fr von 6.45‐16.00 Uhr Mi u. -

IG-L Fahrverbote in Wien Und Niederösterreich
IG-L Fahrverbote in Wien und Niederösterreich Für Fahrzeuge der Klasse N (LKW aller Gewichtsklassen!) werden ab 01.07.2014 in Wien und in Teilen Niederösterreichs abgasverhaltenabhängige Fahrverbote verhängt. Zudem müssen Fahrzeuge, die ab dem 01.01.2015 in den betroffenen Gebieten fahren, mit einer Abgasklassen-Kennzeichnungsplakette gekennzeichnet sein. Diese dient der Exekutive als Erkennungszeichen der Abgasklasse. Folgende Fahrzeuge sind vom Fahrverbot betroffen: Alle Fahrzeuge der Klasse N, unabhängig vom Fahrzeuggewicht - auch Kleintransporter, Geländewagen, Fiskal-LKW... wenn sie als LKW zugelassen sind. Gültigkeit: Abgasklasse EURO 1 und schlechter: ab 01.07.2014 Abgasklasse EURO 2 und schlechter: ab 01.01.2016 Kennzeichnungspflicht: ab 01.01.2015 Ausgabe von Abgasklassen-Kennzeichnungsplaketten Sie erhalten die Abgasklassen-Kennzeichnungsplaketten an den meisten ÖAMTC Stützpunkten. Eine Liste, an welchen ÖAMTC Stützpunkten die Abgasklassen- Kennezeichnungsplaketten ausgegeben werden, finden Sie auf der ÖAMTC Homepage. Ausnahmen: Generelle Ausnahmen (Auszug): • Einsatzfahrzeuge, Fahrzeuge im öffentlichen Dienst • Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft • Fahrzeuge, für deren Benützung im Sanierungsgebiet ein im Einzelfall zu prüfendes überwiegendes öffentliches Interesse besteht • Lkw bis 12t mit Euro-1-Motor (oder besser), die im Werkverkehr im Sanierungsgebiet durch Unternehmer verwendet werden, deren gesamte Lastkraftwagenflotte maximal 4 Lkw umfasst • Bestimmte Fahrzeuge zum Flugplatzbetrieb Ausnahmen in Wien und NÖ: • Historische -

Driving Restrictions, Goods Transport, 2019 Austria 1. GENERAL
Driving Restrictions, Goods Transport, 2019 Austria 1. GENERAL DRIVING RESTRICTIONS Vehicles concerned Trucks with trailers, if the maximum authorised total weight of the motor vehicle or the trailer exceeds 3.5t; trucks, articulated vehicles and self- propelled industrial machines with an authorised total weight of more than 7.5t. Area Nationwide, with the exception of journeys made exclusively as part of a combined transport operation within a radius of 65km of the following transloading stations: Brennersee; Graz-Ostbahnhof; Salzburg- Hauptbahnhof; Wels-Verschiebebahnhof; Villach-Fürnitz; Wien- Südbahnhof; Wien-Nordwestbahnhof; Wörg; Hall in Tirol CCT; Bludenz CCT; Wolfurt CCT. Prohibition Saturdays from 15h00 to 24h00; Sundays and public holidays from 00h00 to 22h00 Public holidays 2019 1 Jan New Year's Day 6 Jan Epiphany 22 Apr Easter Monday 1 May Labor Day 30 May Ascension Day 10 Jun Whit Monday 20 Jun Corpus Christi 15 Aug Assumption of the Virgin Mary 26 Oct National Day 1 Nov All Saints' Day 8 Dec Immaculate Conception 25 Dec Christmas Day 26 Dec St Stephen's Day Exceptions concerning trucks with trailers exceeding 3.5t · vehicles transporting milk; concerning vehicles with an authorised total weight of more than 7.5t · vehicles carrying meat or livestock for slaughter (but not the transport of heavy livestock on motorways); · perishable foodstuffs (but not deep frozen goods) which are as follows: fresh fruits and fresh vegetables, fresh milk and fresh dairy products, fresh meat and fresh meat products, fresh fish and fresh fish products, live fish, eggs, fresh mushrooms, fresh bakery products and fresh cakes and pastry, fresh herbs as potted plant or cut and ready-to-eat food preparations, as well as empty transports linked to the transports of the above mentioned goods or return journeys for carriage of transport facilities and wrapping of the above mentioned goods (a CMR (a consignment note) needs to be carried onboard and presented in case of inspection). -

@Oilfievrginmary 26 Oct National Day 1 Nov All Saints'day B Dec Lnrmaculate Conception 25 Dec Christmas Day 26 Dec St Stephen's Day
R^ Driving Restrictions, Goods Transport, 202A Austria 1. GENERAL DRIVING RESTRICTIONS Vehicles concerned Trucks with trailers, if the maximum authorised total weight of the motor vehicle or the trailer exceeds 3.51; trucks, articulated vehicles and self- propelled industrial machines with an authorised total weight of more than 7.51. Area Nationwide, with the exception of journeys made exclusively as part of a combined transport operation within a radius of 65km of the following transloading stations: Brennersee; Graz-Ostbahnhof; Salzburg- Hauptbahnhof; Wels-Verschiebebahnhof; Villach-Furnitz; Wien- Sudbahnhof; Wien-Nordwestbahnhof; Worg; Hall in Tirol CCT; Bludenz CCT; Wolfurt CCT. Prohibition Saturdays from 15h00 to 24h00; Sundays and public holidays from 00h00 to 22h00 Public halidays 2020 - 1 Jan New Year's Day 6 Jan Epiphany 13 Apr Easter Monday - 1 May Labour Day @ - -4-Jffi--- -*- '11 Jun eorpus Chri5ti -.@oilfievrginMary 26 Oct National Day 1 Nov All Saints'Day B Dec lnrmaculate Conception 25 Dec Christmas Day 26 Dec St Stephen's Day Exceptions concerning trucks with trailers exceeding 3,5t ' vehicles transporting milk; concerning vehicles with an authorised total weight of more than 7.5t . vehicles carrying meat or livestock for slaughter (but not the transport of heavy livestock on motorways); ' perishable foodstuffs (but not deep frozen goods) which are as follows: fresh fruits and fresh vegetables, fresh milk and fresh dairy products, fresh meat and fresh meat products, fresh fish and fresh fish products, live fish, eggs, fresh mushrooms, fresh bakery products and fresh cakes and pastry, fresh herbs as potted plant or cut and readyto-eat food preparations, as well as empty transports linked to the transports of the above mentioned goods or return iourneys for carriage of transport facilities and wrapping of the above mentioned goods (a CMR (a consignment note) needs to be carried onboard and presented in case of inspection).