Transnationale Wissenschafts- Und Verhandlungskultur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The GDR's Westpolitik and Everyday Anticommunism in West Germany
Philosophische Fakultät Dierk Hoffmann The GDR’s Westpolitik and everyday anticommunism in West Germany Suggested citation referring to the original publication: Asian Journal of German and European Studies 2 (2017) 11 DOI https://doi.org/10.1186/s40856-017-0022-5 ISSN (online) 2199-4579 Postprint archived at the Institutional Repository of the Potsdam University in: Postprints der Universität Potsdam Philosophische Reihe ; 167 ISSN 1866-8380 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-435184 DOI https://doi.org/10.25932/publishup-43518 Hoffmann Asian Journal of German and European Studies (2017) 2:11 Asian Journal of German DOI 10.1186/s40856-017-0022-5 and European Studies CASE STUDY Open Access The GDR’s Westpolitik and everyday anticommunism in West Germany Dierk Hoffmann1,2 Correspondence: hoffmann@ifz- muenchen.de Abstract 1 Potsdam University, Berlin, ’ Germany West German anticommunism and the SED s Westarbeit were to some extent 2Institut fur Zeitgeschichte interrelated. From the beginning, each German state had attemted to stabilise its Munchen Berlin Abteilung, Berlin, own social system while trying to discredit its political opponent. The claim to Germany sole representation and the refusal to acknowledge each other delineated governmental action on both sides. Anticommunism in West Germany re-developed under the conditions of the Cold War, which allowed it to become virtually the reason of state and to serve as a tool for the exclusion of KPD supporters. In its turn, the SED branded the West German State as ‘revanchist’ and instrumentalised its anticommunism to persecute and eliminate opponents within the GDR. Both phenomena had an integrative and exclusionary element. -

Jahresbericht Der FES 2010 : Zusammensetzen
JAHRESBERICHT 2010 ANNUAL REPORT 2010 Perspektiven 2011 Perspectives 2011 JAHRESBERICHT 2010 ANNUAL REPORT 2010 Perspektiven 2011 Perspectives 2011 INHALT CONTENT 4 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 69 ARBEITSBEREICHE FÜR SOZIALE DEMOKRATIE 5 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 2 70 POLITISCHE BILDUNG COMMITTED TO SOCIAL DEMOCRACY 72 POLITISCHE AKADEMIE 73 GESELLSCHAFTSPOLITISCHE INFORMATION 6 VORWORT ZUM JAHRESBERICHT 2010 74 DIALOG OSTDEUTSCHLAND 7 PREFACE ANNUAL REPORT 2010 76 STUDIENFÖRDERUNG 78 WIRTSCHAFTS- UND SOZIALPOLITIK 15 STRATEGISCHE ZIELE 79 ZENTRALE AUFGABEN 82 INTERNATIONALER DIALOG 1 16 ZUSAMMENARBEITEN 86 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT DIE WIRTSCHAFTS- UND SOZIALORDNUNG GERECHT GESTALTEN 90 BIBLIOTHEK 20 ZUSAMMENWACHSEN 92 ARCHIV DER SOZIALEN DEMOKRATIE DIE GLOBALISIERUNG SOZIAL GESTALTEN 94 UNSELBSTÄNDIGE STIFTUNGEN 26 ZUSAMMENFÜGEN POLITISCHE TEILHABE UND GESELLSCHAFT LICHEN ZUSAMMENHALT STÄRKEN 95 ANHANG 34 ZUSAMMENFINDEN DIE ERNEUERUNG DER SOZIALEN 3 96 ORGANISATIONSPLAN DER DEMOKRATIE FÖRDERN FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 98 JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2009 40 ZUSAMMENSETZEN DEN DIALOG ZWISCHEN GEWERK SCHAFTEN 104 ZUM SELBSTVERSTÄNDNIS UND POLITIK VERTIEFEN DER POLITISCHEN STIFTUNGEN 105 MITGLIEDER DES VORSTANDES 106 MITGLIEDER DES VEREINS 45 QUERSCHNITTS THEMEN 108 MITGLIEDER DES KURATORIUMS 46 BILDUNGSPOLITIK 109 MITGLIEDER DES AUSWAHLAUSSCHUSSES 48 JUGEND UND POLITIK 110 VERTRAUENSDOZENTINNEN UND VERTRAUENSDOZENTEN 49 FRAUEN – MÄNNER – GENDER 118 ANSCHRIFTEN 51 MEDIENARBEIT 120 IMPRESSUM 53 DIE FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG IM SPIEGEL -

Ford, Kissinger, Edward Gierek of Poland
File scanned from the National Security Adviser's Memoranda of Conversation Collection at the Gerald R. Ford Presidential Library MEMORANDUM THE WHITE HOUSE WASHINGTON ~:p1NODIS MEMORANDUM OF CONVERSATION PARTICIPANTS: President Gerald R. Ford Edward Gierek, First Secretary of the Central Com.mittee of the Polish United Workers' Party Stefan 01szowski, Minister of Foreign Affairs Dr. Henry A. Kissinger, Secretary of State and Assistant to the President Lt. General Brent Scowcroft, Deputy Assistant to the President for National Security Affairs Ambassador Richard T. Davies, US Amb. to Poland Polish Interpreter DATE AND TIME: Tuesday, October 8, 1974 11 :00 a. m. - 12:40 p. m. PLACE: The Oval Office The White House [Ge~eral Scowcroft missed part of the opening conversation. ] Gierek: In France, the ethnic group of Poles came during the French Revolution. People of Polish extraction have been introduced into many countries. Kissinger: Then in the 19th Century, the Polish nationalists concluded that the only way they could get independence was to join every war -- individually. Gierek: Secretary Kissinger knows our history very well. In our anthem, it says we have been guided by Bonapartist methods of how to win. We Socialists left it in. Kissinger: I have always been impressed by Warsaw's Old City. It took much pride to restore it that way. Gierek: That is true. ~/NODIS 9'!ii............ tmCLASSIFJBI) -~\.. B.O. 1295S, Sec. 3.S NSC lfQJDo, lln419S, State Dept. Guidelines 11 t!t=. , NARA, Date d,,'e -2 President: Let me at the outset welcome you in a personal way. I really look forward to your mission and what has been done to bring us together as peoples and what we can do in the future to expand our contacts. -

Zrozumieć Współczesność
zrozumieć współczesność rtytulowe kubiak 75 lat.indd 1 2009-08-27 13:43:57 zrozumieć współczesność Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi w 75. rocznicę urodzin tom ten ofiarowują przyjaciele i uczniowie pod redakcją Grzegorza Babińskiego i Marii Kapiszewskiej Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009 rtytulowe kubiak 75 lat.indd 3 2009-08-27 13:43:57 Warszawa, 27 sierpnia 2009 roku Szanowny Jubilacie! Rad jestem, mogąc znaleźć się w gronie osób pozdrawiających ser decznie profesora Hieronima Kubiaka z okazji 75. rocznicy urodzin. Poznałem Profesora w dramatycznie trudnym 1981 roku. Był to rok i wielkich nadziei, i wielkich zagrożeń, a tym samym próby cha rakterów, ideowości, poczucia odpowiedzialności. Zapamiętałem sło wa: „Komisja starała się usilnie osadzić treść tych dokumentów w nieprzemijających wartościach naszej narodowej kultury, lewico wej tradycji, podstaw naszej tożsamości narodowej, ciągłości histo rycznej Polaków ”, które na IX Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR powie dział przewodniczący Komisji Uchwał - prof. Hieronim Kubiak. W słowach tych zawarta jest synteza Jego patriotycznej, postępowej filozofii. Posiada autentyczną wrażliwość człowieka lewicy. Cechuje Go wysoka kultura, skromność, ujmujący sposób bycia. Przez jed nych szanowany i lubiany, przez innych atakowany i pomawiany. Szedł prostą drogą. Wiedział, że konieczna jest w Polsce, w jej kierowni czych gremiach gruntowna przemiana myślenia i działania, zgodna z duchem i potrzebami czasu. Spotykało się to z oporami, krytyką, oskarżeniami zarówno z kręgów zachowawczych, dogmatycznych - tzw. prawdziwych komunistów, jak też - co było zresztą sprzężeniem zwrotnym - ze strony ówczesnych sojuszników. Należał obok Mieczy sława Rakowskiego, Andrzeja Werblana i Jerzego Wiatra do zwal czanych ze szczególną zajadłością. Godne podziwu były jego spokój i odporność, jak też konsekwencja i odwaga w obronie wartości, któ rym mimo rozczarowań i goryczy, był zawsze wierny. -

The Establishment of the Georg Eckert Institute in the Summer of 1975
Bulletin | A Taste of Our Research 33 THE ESTABLISHMENT OF THE GEORG ECKERT INSTITUTE IN THE SUMMER OF 1975 How Textbook Research Was Given a New Future in Braunschweig Following the Death of Georg Eckert Eckhardt Fuchs and Steffen Sammler PHOTO Georg Eckert receives the Federal Cross of Merit from Lower Saxony’s Prime Minister Alfred Kubel in 1972 THE BEGINNINGS with the exceptions of Bavaria and Baden-Würt- Following the sudden death of Georg Eckert in temberg. The Board of Trustees, at the time under January 1974, the state of Lower Saxony resolved the leadership of Alfred Kubel, further secured to ensure that the work of the International Text- the support of the Foreign Office, the Federal book Institute that Eckert had founded would be Ministry of Education and Research, the German continued. On 26 June 1975, the delegates of the UNESCO Commission and of the Lower Saxony Lower Saxony State Parliament (Landtag) thus Teachers Training College. passed the resolution – by unanimous vote – to The founding of the GEI brought in its wake the establish the Georg Eckert Institute for Interna- constitution of a Board of Trustees and an Aca- tional Textbook Research (GEI) as an institution demic Advisory Board, and thus led to a continu- of public law. In doing so, they secured not only ous extension of the research library and of text- the continued work of the International Institute book research itself. Since 1981, the renovation of for Textbook Improvement founded by Eckert in the Villa von Bülow by the State of Lower Saxony the spring of 1951 (known as the International has given the Institute a prestigious home, ena- Textbook Institute as of 1953), but also provided bling its employees to continue the textbook work it with a new and stable foundation in both a initiated by Georg Eckert and to successfully legal and financial sense. -
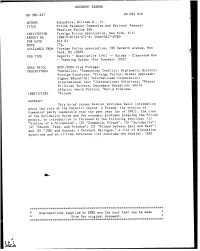
ED383637.Pdf
DOCUMENT RESUME ED 383 637 SO 025 016 AUTHOR Schaufele, William E., Jr. TITLE Polish Paradox: Communism and National Renewal. Headline Series 256. INSTITUTION Foreign Policy Association, New York, N.Y. REPORT NO ISBN-0-87124-071-8; ISSN-0017-8780 PUB DATE Oct 81 NOTE 77p. AVAILABLE FROMForeign Policy Association, 729 Seventh Avenue, New York, NY 10019. PUB TYPE Reports Descriptive (141) Guides Classroom Use Teaching Guides (For Teacher) (052) EDRS PRICE MF01/PC04 Plus Postage. DESCRIPTORS *Catholics; *Communism; Conflict; Diplomatic History; Foreign Countries; *Foreign Policy; Global Approach; Higher Education; International Cooperation; international Law; *International Relations; *Peace; Political Science; Secondary Education; World Affairs; World History; World Problems IDENTIFIERS *Poland ABSTRACT This brief issues booklet provides basic information about the role of the Catholic Church Poland, the erosion of Communist party leadership over the past year (as of1981), the rise of the Solidarity Union and the economic problemsplaguing the Polish people. An introduction is followed by thefollowing sections: (1) "History-of a Millennium";(2) "Communist Poland";(3) "Solidarity"; (4) "Church, Farm, and Freedom";(5) "Poland between East and West"; and (6)"1981 and Beyond: A Personal Epilogue." A list of discussion questions and an 11-item reference list conclude the booklet.(EH) *********************************************************************** Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. ***********************************A*********************************** 1 IC OA Y SO1 TI U S DEPARTMENT OF EDUCATION Ottrce of Educational Research and Improvement EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION CENTER (ERIC) ytTMs document has been reproduced as recehred from the person or peg&nzation 1 originating 1. 0 minor Changes have been made toimprove reproduction Duality Points of new or opinions stated rn thisdocu mant do not neCeSserity representoffictal. -

Looking Westwards
Founded in 1944, the Institute for Western Affairs is an interdis- Looking westwards ciplinary research centre carrying out research in history, political The role of the Institute for Western Affairs science, sociology, and economics. The Institute’s projects are typi- in the construction of the Lubusz Land concept cally related to German studies and international relations, focusing On local historical policy and collective on Polish-German and European issues and transatlantic relations. memory in Gorzów Wielkopolski The Institute’s history and achievements make it one of the most Cultural heritage against a background important Polish research institution well-known internationally. of transformation in 1970s and 1980s Western Since the 1990s, the watchwords of research have been Poland– Ger- Poland many – Europe and the main themes are: Polish interest in the early medieval past • political, social, economic and cultural changes in Germany; of Kołobrzeg • international role of the Federal Republic of Germany; The Greater Poland Uprising in the French and British daily press • past, present, and future of Polish-German relations; • EU international relations (including transatlantic cooperation); Rosa Luxemburg against war • security policy; Literary fiction and poverty. The example of Gustav Freytag’s novel Soll und Haben • borderlands: social, political and economic issues. The Institute’s research is both interdisciplinary and multidimension- Coming to terms with the West German 68ers in the writings of the 85ers al. Its multidimensionality can be seen in published papers and books The manuscript of the letter of the Polish on history, analyses of contemporary events, comparative studies, bishops to the German bishops and the use of theoretical models to verify research results. -

Germany and Japan As Regional Actors in the Post-Cold War Era: a Role Theoretical Comparison
Alexandra Sakaki Germany and Japan as Regional Actors in the Post-Cold War Era: A Role Theoretical Comparison Trier 2011 GERMANY AND JAPAN AS REGIONAL ACTORS IN THE POST-COLD WAR ERA: A ROLE THEORETICAL COMPARISON A dissertation submitted by Alexandra Sakaki to the Political Science Deparment of the University of Trier in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Submission of dissertation: August 6, 2010 First examiner: Prof. Dr. Hanns W. Maull (Universität Trier) Second examiner: Prof. Dr. Christopher W. Hughes (University of Warwick) Date of viva: April 11, 2011 ABSTRACT Germany and Japan as Regional Actors in the Post-Cold War Era: A Role Theoretical Comparison Recent non-comparative studies diverge in their assessments of the extent to which German and Japanese post-Cold War foreign policies are characterized by continuity or change. While the majority of analyses on Germany find overall continuity in policies and guiding principles, prominent works on Japan see the country undergoing drastic and fundamental change. Using an explicitly comparative framework for analysis based on a role theoretical approach, this study reevaluates the question of change and continuity in the two countries‘ regional foreign policies, focusing on the time period from 1990 to 2010. Through a qualitative content analysis of key foreign policy speeches, this dissertation traces and compares German and Japanese national role conceptions (NRCs) by identifying policymakers‘ perceived duties and responsibilities of their country in international politics. Furthermore, it investigates actual foreign policy behavior in two case studies about German and Japanese policies on missile defense and on textbook disputes. -

Zeittafel Zur Geschichte Stedorf/ Dörverden ([email protected] Vor Mehr Ausgrabung in Lehringen (12 Km Ostwärts Von Stedorf Als Nahe Neddenaverbergen): Am 1
Zeittafel zur Geschichte der Gemeinde Stedorf/ Dörverden Bearbeitungsstand Januar 2019 Zeittafel zur Geschichte Stedorf/ Dörverden ([email protected] vor mehr Ausgrabung in Lehringen (12 km ostwärts von Stedorf als nahe Neddenaverbergen): Am 1. April 1948 brachten Ar- 100.000 beiten in einer Mergelgrube nahe Lehringen den Nach- Jahren weis, dass Neandertaler des Spätacheuléens in dieser Ge- gend aktiv Großwild jagten. Man fand das Skelett eines ausgewachsenen 4 m hohen Waldelefanten zwischen des- sen Rippen eine hölzerne, sorgfältig bearbeitete Stoß- lanze aus Eibenholz steckte. Das Gewicht des stürzenden Abb. 01: Jagd auf den Waldele- Elefanten hatte die ihm von vorne in den Brustkorb fanten vor mehr als 100.000 Jahren gestoßene 2,40 m lange Lanze halbkreisförmig gebogen, in Lehringen plattgedrückt und in mehrere Teile zerbrochen. Die Ernst Probst, Deutschland in der Folgerung, dass Urzeitmenschen auch in den Auewäldern Steinzeit und des Aller-Weser Dreieck auf der Jagd gewesen waren ist Rektor A. Rosenbrock aus der Handbuch Landkreis Verden). sicherlich nicht hergeholt. (Nach 7jährigem Rechtsstreit mit Die Pollenanalyse, wie auch der Waldelefant selbst, Niedersächsischem Landesmuseum ist die Lanze ab 1955 im ordnen das Jagdereignis in das Eem-Interglazial (Warm- Domherrenhaus in Verden aus- zeit) von vor 126.000 bis 115.000 Jahren ein. gestellt.) 100.000 1972 Faustkeil in Stedebergen. Auch im Aller-Weser bis Dreieck gibt es Hinweise auf den Aufenthalt von Urzeit- 50.000 menschen. In der Kiesgrube in Stedebergen baggerte H. v. Chr. Intemann aus Stedorf 1972 einen Faustkeil aus. Der Faustkeil ist 19 cm lang, dabei nur 3 cm dick und besteht aus schwarzem Tonschiefer. -

Broschuere Schmidterleben.Pdf
SCHMIDT LEBEN ERLEBEN MI T ERLEBEN SCHMIDTERLEBEN – ein gemeinschaftliches Unterrichtsprojekt der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, der Helmut und Loki Schmidt-Stiftung und des Helmut-Schmidt-Gymnasiums Oktober 2017 – Mai 2018 EIN GEMEIN SCHAFTS PROJEKT DIE IDEE Namen prägen Identitäten und Namen verbinden. So lag es nahe, dass sich die Leitungen des Helmut-Schmidt-Gymnasiums, der Helmut und Loki Schmidt-Stiftung und der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung ein- mal zusammensetzten, um zu überlegen, welche gemeinsamen Projekte verwirklicht werden könnten. Beide Seiten waren sich einig, dass dabei die Schülerinnen und Schüler mit ihren Interessen und Ideen im Mittelpunkt zu stehen hatten. Sie sollten das Wohnhaus der Schmidts und das umfangreiche Archiv erleben und zu Recherchezwecken nutzen können sowie ihre Ergebnisse im Helmut-Schmidt-Gymnasium an zentraler Stelle sichtbar werden lassen. Die Idee war geboren: Eine Dauerausstellung zum Leben und Wirken Helmut und Loki Schmidts in der Pausenhalle der Schule, inhaltlich und konzeptionell gestaltet von Schülerinnen und Schülern. DER PLAN DIE AUSSTELLUNG Zügig wurden folgende Projektphasen gemeinsam geplant: Das Resultat kann sich sehen lassen: Die Ideen und Ergebnisse der Schüle- 1. Projektauftakt: Themen- und Gruppenfindung rinnen und Schüler sind in ein stimmiges Umsetzungskonzept, erstellt 2. Recherche und Besuche in Langenhorn durch Frau Sievertsen und in Abstimmung mit den Stiftungen und der Schule 3. Ausstellungskonzeption: Anspruch an Inhalt und Gestaltung eingeflossen. 4. Textproduktion und Fotoauswahl Die Ausstellung wird nicht nur das Helmut-Schmidt-Gymnasium auf Jahre 5. Umsetzung und Eröffnung der Dauerausstellung prägen, sondern auch wichtige Impulse im Rahmen der Erinnerungskultur Neben der Zielsetzung einer eigenständigen Erarbeitung und Gestalt ung in Wilhelmsburg und in Hamburg insgesamt aussenden. -

Records of the Committee of the Ministers of Foreign Affairs, 1976
PARALLEL HISTORY PROJECT ON NATO AND THE WARSAW PACT (PHP) Records of the Committee of the Ministers of Foreign Affairs Anna Locher (ed.) Andrei Andreevich Gromyko. Soviet Minister of Foreign Affairs from 1957-1985. PHP Publications Series Washington, D.C. / Zurich May 2002 This publication is part of a publications series by the Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact (PHP). The PHP provides new scholarly perspectives on contemporary international history by collecting, analyzing, and interpreting formerly secret governmental documents. Since its establishment in 1999, the project has collected thousands of pages of material on security-related issues of the Cold War, published a large number of online documentaries on central issues such as mutual threat perceptions and alliance management, and organized several major international conferences on war planning, intelligence, and intra-bloc tensions. Further information is provided at the PHP Website: www.isn.ethz.ch/php. Table of Contents 1) Introduction, by Anna Locher........................................................................................1 2) The CMFA in short – Annotated History of the Meetings of the..................................22 Warsaw Pact Committee of the Ministers of Foreign Affairs...........................................22 3) Records Sealed Forever? The Foreign Ministers' Last Decision, February 1991.......28 4) Foreign Ministers Participating in the CMFA Meetings 1976-1990.............................29 5) Document Overview....................................................................................................30 Please note: This issue of the PHP Publication Series offers highlights from a much larger online document collection. Please consult the PHP website for all the documents in their original language and other features: http://www.isn.ethz.ch/php/collections/coll_3_CMFA.htm The PHP has published a number of document collections on various aspects of the security- related history of the cold war: http://www.isn.ethz.ch/php. -

Conventions Administratives Et Affaires Co
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DIRECTION DES ARCHIVES Europe République fédérale d’Allemagne 1971-juin 1976 178QO Répertoire numérique détaillé par Sophie RAVARY, vacataire Sous la direction de Pierre CHANCEREL et de Pascal EVEN, conservateur général du patrimoine La Courneuve, janvier 2015 Europe / République fédérale d’Allemagne 1971-juin 1976 178QO Référence : FR MAE 178QO Intitulé : Europe / République fédérale d’Allemagne, 1971-juin 1976 Dates prépondérantes : 1971-1976. Dates réelles : 1971- juin 1976. Niveau de description : sous-série organique (tranche chronologique). Producteur : Direction d’Europe. Présentation ou importance matérielle : 313 volumes, 105 cartons, soit 10,5 ml. Modalités d’entrée : versement administratif (entrée n° 1928INVA, cartons 2944 à 3068). Présentation du contenu : Les représentants diplomatiques de la France suivent naturellement avec attention les événements politiques et sociaux qui agitent l’Allemagne de l’Ouest durant les années 1971 à 1976 : tentative d’assassinat contre le président Heinemann, dissolution du Bundestag en janvier 1972, condamnation de Daniel Cohn-Bendit, démission du chancelier Brandt en mai 1974 et actions terroristes de la bande à Baader (volumes 1892 à 1896). De nombreuses biographies, insérées dans les volumes 1904 et 1905, permettent d’approcher le milieu politique allemand de cette période. On notera également les informations sur l’attentat dont est victime l’ambassade d’Allemagne en Suède en avril 1975 (volume 1890), ou encore les activités et les congrès des partis politiques dans les volumes 1911 à 1921, dont l’exclusion de Schiller du SPD. Les nombreuses réformes territoriales affectant notamment les Länder font l’objet de développements dans les volumes 1922 à 1928.