Gletscherfunde Am Langgrubenjoch (Gde. Mals Und Gde
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
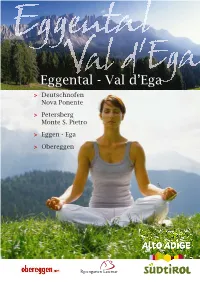
Eggental -Val D’Ega > Deutschnofen Nova Ponente > Petersberg Montes.Pietro > Eggen -Ega > Obereggen Willkommen Im Ferienparadies Zwischen Rosengarten Und Latemar
Eggental -Val d’Ega > Deutschnofen Nova Ponente > PetersBErg MonteS.Pietro > Eggen -EGA > Obereggen Willkommen im Ferienparadies zwischen Rosengarten und Latemar > Deutschnofen Das Eggentalist mitden sonnig gelegenen undsehrreizvollen Dörfern Deutschnofen Nova Ponente W (1350m), Eggen (1120m), Obereggen (1550m) und Petersberg (1380m) bietet Urlaubsspass in allen Variationen. Blitzsaubere Höfe, schmucke Gasthöfe und Pensionen, attraktive Hotelsoder gute Ferienwohnungen sowiedie hervorragende Küche und die Südtiroler Gastfreundlichkeit sind nur einige Gründe, um Ihren Urlaub in unserer Ferienregion zu verbringen. Viinvitamo a passare le giornate piú belle dell’anno in un ambiente gradevole! La Vald’Ega,un comprensorio composto dai > Eggen paesi Nova Ponente (1350m), Ega (1120m), V Obereggen (1550m), Monte San Pietro (1380m), Ega Novale (1270m) e Ponte Nova (1270m), èsituata nel bel mezzo delle affascinanti Dolomiti. Nelle immediate vicinanze si trova Bolzano che èil capoluogodella provincia,famosa per il suo splendido centro storico. La Vald’Ega èsimbolo di ospitalitá fresca e genuina. Gli alberghidella zona sonomoderni ed accoglienti, che vannoda tipici agriturismo, appartamenti, pensioniprivate a hotellussuosi con beautyfarm ewellnessper soddisfare la clientela più esigente. Innsbruck Brennerpass Brennero Reschenpass Seiser Alm Passo Resia ALTO ADIGE Alpe di siusi Völs > Petersberg Fiè Blumau Prato Isarco Tiers St.Zyprian Tieres Monte S. Pietro Kalterer See Steinegg S.Cipriano L.di Caldaro Kardaun Collepietra Völser Aicha Karerpass Welschnofen Cardano Aica di Fiè Passo Costalunga Nova Levante Gummer S.Valentino Karersee Vigo L.di Carezza di Fassa Obereggen Birchabruck Eggen Ponte Nova Ega Deutschnofen Nova Ponente Weissenstein Pietralba Verona Aldein Petersberg Aldino Monte S. Pietro Cavalese/Fiemme INFO: Büro/Ufficio > ObereGGEn Tourismusverein Eggental Deutschnofen/Nova Ponente: Associazione Turistica Vald’Ega Tel. -

Schnalser Bergwelt!
Januar - März 10 Nummer 7 Mitteilungsblatt der Gemeinde Schnals „DRT Convenzioni Piccoli Comuni“ Erscheint dreimonatlich Schnalser Bergwelt! Nockspitze mit Blick zur Finail- und Similaunspitze (15.August 2009) Foto: H.Grüner Pfarrer Franz Messner Mittlerweile ist es 20 Jahre her, dass unser ge- schätzter Pfarrer Franz Messner bei uns im Schnal- stal ist. Lesen Sie mehr auf Seite 10 04. Oktober 1969 Vor 40 Jahren fand die Trauung unseres Tourismu- spioniers Leo Gurschler im Kirchlein von Kurzras statt. Lesen Sie mehr auf Seite 14 Seite 2 Schnolserblattl Januar - März 2010 / Nr. 7 Schnols S’ Schnolsrtol wars – gonz genau des Seitntalale asn untarn Vinschgau a guate Stroß a Tanell, weil sicher solls sein, und afn Knott obm s’ Kirchl va St. Katrein. Dia oltn Hejf obm af dia sticklan Rau als obsi zuipoppat warn – a nettla 100 Johr schua. Und s’ Kloaschtr, dr Mittlpunkt von Tol a schians Kirchl und die Gruttn, za der dr Ingong isch a bissl schmol die Ringmaur, die Kuch und dr Kreizgong va die Patr isch guat saniart und renoviart gwortn earscht spatr. Die Wollfohrskirch va Unsafrau und a Herbra firn stuanoltn Ötzi in Herbischt die Schofschoad sell isch hetzi. Zindrigst drinn Hotel, Lift und dia groaße Gondl, des hot für Schnols brocht den enzgroaßn Wondl. Schigebiat fürn Summer undn Wintr Zan wondarn und bergsteign sein die 3000tr drhintr. Af die Olman blüadats, es grosn Schof und Küha und dia göttliche Ruha isch dr Luha für der Müha. Wenn Zamorgat ban Sunnaaufgong wolta Zeitn, dr Simalaunr und die Weißkugl grüaßn va Weitn do denk i oft und sogs a enk – gonz gwieß des isch Schnols – a kluans Preckl von Paradies. -

Fixed Rope Route NATURNSER SONNENBERG HOACHWOOL - Fixed Rope Route Naturnser Sonnenberg
Nagel_Klettersteig_Illustrator Kopie.pdf 1 26.05.14 11:20 Fixed Rope Route NATURNSER SONNENBERG HOACHWOOL - Fixed Rope Route Naturnser Sonnenberg Impressive cliffs, the unique landscape of the Sonnenberg mountain above Naturns, breathtak- ing views, the “Elferpl°ott”, the “Stegerfrau”, the Forbidden Route and the impressive Waale (the traditional Alpine irrigation system) – the HOACHWOOL fixed rope route offers all this and more. The fixed rope route crosses the former “Schnalswaal” irrigation channel near Naturns and gives an idea of the dangers and hardships that peasants faced in building and maintaining the channel. The varied terrain offers steep, difficult parts, short walking sections and exposed traverses. The ascent requires suitable equipment as well as the necessary climbing skill and experience, ab- solute sure-footedness and a head for heights. The route is secured as necessary by steel ropes, climbing aids and ladders. The “Sattele” rest area in the middle of the wall affords climbers a relax- ing break. This is an impressive, varied and challenging half-day tour. Höfl Finish TOP Rest area Cable car UNTERSTELL The “Stegerfrau“ Rest area Historic irrigation channel „Sattele“ „Hoachwool“ NATURNS The “11-er Platte“ KOMPATSCH “Forbidden Route“ Neuräutl Rope bridge Approach „Schinawaal“ Unterortl Climbing park Juval Farmer’s Shop History carved in stone... The fixed rope route runs along the historic Schnals Valley irrigation channel near Naturns; this was previously some 10 kilometres long and known locally as the “Hoachwool”. It ran at an altitu- de of 850 metres from Altratheis in the Schnals Valley to the farms on the Naturns Sonnenberg mountain. Constructed between 1830 and 1833, it was the most difficult project of its kind in the history of Waal-building in the Vinschgau Valley, traversing the dizzying rock faces at the mouth of the Schnalsbach stream. -

Südtiroler Heimat Juli/August 2019 Seite 3
80 Jahre OPTION Mitteilungen an die Mitglieder der Südtirolerverbände Nr. 7/8 Juli/August 2019 73. Jahrgang Inhalt Option - Spuren der Erinnerung ...... 4 Fragebogen zur Option .............. 8 Wir gratulieren zum Geburtstag .....34 Buchtipp ...............34 Veranstaltungen ....38 Rezepte der Südtiroler Bäuerinnen ........... 39 Südtirol in Farben / Foto: Josef Gorfer, Bruneck Spendenbeitrag 2019 mit Zahlschein ......40 Lappach im Tauferer Ahrntal Seite 2 Juli/August 2019 Südtiroler Heimat Parteienverkehr (Rentenberatung) und Bürodienst PATRONAT ACLI ÖSTERREICH UND GESAMTVERBAND DER SÜDTIROLER IN ÖSTERREICH Unsere Kanzlei in Innsbruck, Zeughausgasse 8, ist Montag, Dienstag und Mittwoch von 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Frau Christine Stieger-Deutschmann, Tel. + Fax 0512/589860 e-Mail: [email protected] ACHTUNG! Das Büro ist in der Zeit von 05. - 23.08.2019 wegen Urlaub geschlossen! Pension Quote 100 Die Pension Quote 100 ist eine neue Rentenart, die für Die Rente Quote 100 ist unvereinbar mit einem Arbeitsein- den Zeitraum 2019/2021 Gültigkeit hat. Jene Personen, kommen (aus lohnabhängiger und selbständiger Tätigkeit). die die Voraussetzungen innerhalb 31.12.2021 erreichen, Es gilt eine Ausnahme: gelegentliche selbständige Tätigkeit können den Antrag um Rente Quote 100 trotzdem ein- kann bis zu 5.000 € im Jahr ausgeübt werden. Die Unver- reichen. einbarkeit gilt bis zum Erreichen der Rentenvoraussetzung für die Altersrente. Voraussetzungen: Einstiegsfenster: Die Rente Quote 100 beginnt nicht mit dem darauffolgenden Monat der Rentenvoraussetzungen - Lebensalter von mindestens 62 Jahren sondern zeitlich verschoben – sie startet nach 3 Monaten (unabhängig Frau oder Mann) ab Vorhandensein der Voraussetzungen. - 38 Beitragsjahre, davon mindestens 35 effektive Arbeitsjahre. Pension Quote 100 gilt nicht für die Polizei, Berufsfeuerwehr und Finanz. -

Ladinia Neuen Geologischen Wanderweg Samt The- Derheiten Des Gebietes Beschrieben
10 Montag, 6. August 2018 - Am Col Raiser stellten die Verantwortlichen (im Bild) den pen werden die erdgeschichtlichen Beson- Ladinia neuen geologischen Wanderweg samt the- derheiten des Gebietes beschrieben. Wan- matisch passendem Führer vor. Der Weg derer und Leser sollen verstehen, was das führt von Aldein nach Sexten. Auf 10 Etap- Unesco-Welterbe-Gebiet auszeichnet. © MONTAG 27° 12° Teils sonnig mit 400 Leute feiern mit Lungiarü Gewitterneigung. 60% FESTAKT: Offizielle Ernennung zum Bergsteigerdorf – „Titel ist kein Marketing, sondern der Auftrag, das Erbe zu bewahren“ DIENSTAG 25° 12° LUNGIARÜ (rom). Mit einer Feier im Rahmen der „Roda Sonne, Wolken, spä- ter auch Gewitter. dles Viles“ ist Lungiarü am 70% gestrigen Sonntag offiziell dem internationalen Netz- MITTWOCH werk der Bergsteigerdörfer 25° 11° beigetreten. Um die 400 Per- Recht freundlich: sonen haben an den Feier- Sonne und Wolken. lichkeiten teilgenommen. 50% Lungiarü ist somit das erste ladinische Bergsteigerdorf der Dolomiten. Der Träger der Initia- tive in Südtirol ist der Alpenver- ein Südtirol (AVS), die Initiative stammt vom österreichischen Al- Nun ist es offiziell: Lungiarü ist das erste Bergsteigerdorf der Dolomiten. Im Bild die Vertreter der Partnerbetriebe mit Organisatoren und Vertretern penverein. AVS-Präsident Georg aus der Politik. Simeoni erklärte bei seiner An- sprache, dass „Bergsteigerdörfer tung sei, „keinen Massentouris- te Teamarbeit und dank der Zu- ben Costabiei und Simeoni die und durch seine Lage am Fuße sich durch eine unverfälschte al- muszuzulassenunddasDorfso sammenarbeit der gesamten Be- Deklaration und die Plaketten der Dolomiten hervor. Mehr als pine Landschaft, lebhafte Tradi- zu bewahren, wie es heute ist.“ völkerung zustande gekommen wurden an die Partnerbetriebe die Hälfte des Fraktionsgebietes tionen und den Verzicht auf Mas- Den größten Applaus erntete sei. -

1 Spögler Leon Schlanders/Kortsch 2 Götsch Simon Schnals 3 Gasser
Name Vorname Gilde 1.S 2.S 3.S 1 Spögler Leon Schlanders/Kortsch 102,4 102,8 102,2 307,4 2 Götsch Simon Schnals 98,0 101,1 99,3 298,4 3 Gasser Marian St.Lorenzen 100,4 94,7 97,3 292,4 4 Berger Eva Eyrs 99,9 91,6 100,5 292,0 5 Gurschler David Schnals 98,2 92,4 100,8 291,4 6 Kaserer Noah Kastelbell/Tschars 97,2 94,5 99,7 291,4 7 Klotz Luca Goldrain 94,8 93,2 97,6 285,6 8 Wieser Alex St.Lorenzen 98,1 97,2 90,0 285,3 9 Nischler Nadine Kastelbell/Tschars 98,4 95,6 90,0 284,0 10 Gschnell Fabian Auer 96,0 95,5 91,9 283,4 11 Bauer Matthias Goldrain 91,1 98,2 91,9 281,2 12 Timpfler Manuel Deutschnofen 95,9 89,5 92,6 278,0 13 Schuster Helena Schlanders/Kortsch 89,5 94,6 91,2 275,3 14 Cattani Sabrina St.Lorenzen 93,1 88,9 93,2 275,2 15 Gurschler Daniel Schnals 83,1 94,9 94,1 272,1 16 Niedermair Alex Schlanders/Kortsch 92,8 93,2 83,5 269,5 17 Kuppelwieser Leon Schnals 85,8 89,3 92,9 268,0 18 Plattner Stefan Auer 89,3 88,6 89,3 267,2 19 Paller Simon Tramin 86,2 92,6 82,8 261,6 20 Gorfer Damian Schnals 83,7 92,3 85,5 261,5 21 Kuppelwieser Marian Schnals 80,8 92,7 87,4 260,9 22 Pichler Lukas Deutschnofen 89,4 84,0 80,6 254,0 23 Tumler Moritz Schnals 73,9 85,3 92,0 251,2 24 Pircher Leo Kastelbell/Tschars 79,5 85,6 77,0 242,1 25 Plattner Ivan Auer 83,5 77,4 70,9 231,8 26 Degasperi David Auer 78,0 83,1 68,5 229,6 27 Köhl Raffael Deutschnofen 80,0 55,0 81,3 216,3 28 Spechtenhauser Bastian Schnals 66,3 70,6 72,4 209,3 29 Unterhauser Manuel Tramin 59,9 72,6 71,1 203,6 30 Psenner Moritz Eppan 0 0 0 0 31 Zipperle Gabriel St.Leonhard in Pass. -

Budget 2015 - 2017
Budget 2015 - 2017 Bautätigkeit - attività costruttiva Kodex - Nr_Whg - Baustelle - cantiere codice n_alloggi Art Bautätigkeit - tipo attività costruttiva Forecast 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 LAIVES/LEIFERS-"TOGGENBURG 1" EA3a 1500 14 Neubau/nuova costruzione 1.504.290 LAIVES/LEIFERS-"TOGGENBURG 1" EA4a-b 1513 22 Neubau/nuova costruzione 2.291.716 EPPAN/APPIANO St.Michael 1430 18 Neubau/nuova costruzione 58.973 BZ - RESIA 1 - LOTTO B.2.3. 1453 42 Neubau/nuova costruzione 5.051 BZ - RESIA 1 - LOTTO B.2.4 1454 49 Neubau/nuova costruzione 5.893 TERLAN/TERLANO - "C-Winkler" 1473 8 Neubau/nuova costruzione - 1.423 BOLZANO/BOZEN-CASANOVA EA1 1496 129 Neubau/nuova costruzione 996.576 BOLZANO/BOZEN-CASANOVA EA2 1497 106 Neubau/nuova costruzione 141.723 BOLZANO/BOZEN-CASANOVA EA6 1498 81 Neubau/nuova costruzione 78.855 BOLZANO/BOZEN-CASANOVA EA8 1499 85 Neubau/nuova costruzione 85.454 EGNA/NEUMARKT-C-VILL 1+3 1511 12 Neubau/nuova costruzione 12.295 EGNA/NEUMARKT-ACQ.ALL. DALLE NOGARE 3283 11 Ankauf/acquisto 3.923 MERAN/MERANO Ankauf fertiggestellte 50 Whg 3278 50 Ankauf/acquisto 6.240.879 SLUDERNO/SCHLUDERNS-"HOELBLING" 1507 6 Neubau/nuova costruzione 424.039 476.000 TESIMO/TISENS-"LONGNUI II" 1512 7 Neubau/nuova costruzione 97.929 1.100.000 207.000 APPIANO/EPPAN-CORNAIANO/GIRLAN-SEEWIESE 1445 16 Neubau/nuova costruzione 14.752 ST.CHRISTINA/S.CRISTINA 5 Wohnungen 1458 5 Neubau/nuova costruzione 1.523 STERZING/VIPITENO Kronbuehl 1468 7 Neubau/nuova costruzione 24.440 LA VALLE/WENGEN-"PLAIAC" 1495 6 Neubau/nuova costruzione 88.241 VALLE AURINA/AHRNTAL-"RIEPE 2" 1508 9 Neubau/nuova costruzione 42.137 BRUNICO/BRUNECK-B16 1509 16 Neubau/nuova costruzione 8.506 VELTURNO/FELDTHURNS-SNODRES 71-LOSA I. -

Viehversicherungsvereine
Angaben im Sinne von Art. 1, Absatz 125 des Gesetzes Nr. 124 vom 4. August 2017 Hinsichtlich der Verpflichtung auf der Internetseite, die von der öffentlichen Verwaltung oder dieser gleichgestellten Körperschaft erhaltenen Geldbeträge auszuweisen, die in Form von Subventionen, Unterstützungen, wirtschaftliche Vergünstigungen, Beiträge oder Sachleistungen, die keinen öffentlichen Charakter aufweisen und keine Gegenleistung, Entgelt oder Schadenersatz darstellen, bescheinigen die Vereine hiermit, im Jahr 2019 folgende öffentliche Beiträge erhalten zu haben (Kassaprinzip): Finanzjahr Name Vorname CUAA Addresse PLZ Gemeinde Provinz Beihilfe 2019 Gerichtsalmen Lazins Timmels 82013270218 GOMION 18 39015 St.Leonhard In Passeier Bozen 94.612,00 2019 Viehversicherungsverein Pfalzen 92007980219 GREINWALDNER STRASSE 15 (GREINWALDEN) 39030 Pfalzen Bozen 37.722,50 2019 Viehversicherungsverein Mölten 94021480218 ZUM KREITER 3 39010 Mölten Bozen 31.972,50 2019 Viehversicherungsverein Lichtenberg 91010030210 MARKTWEG 12 (LICHTENBERG) 39026 Prad Am Stilfserjoch Bozen 30.259,00 2019 Viehversicherungsverein St. Georgen/Bruneck 92007560219 GISSBACHSTRASSE 35 (ST.GEORGEN) 39031 Bruneck Bozen 29.387,50 2019 Viehversicherungsverein Tartsch 91010160215 TARTSCH 96 39024 Mals Bozen 28.419,50 2019 Viehversicherungsverein Terenten 92007900217 WALDERLANERSTRASSE 8 39030 Terenten Bozen 26.395,00 2019 Viehversicherungsverein Sand In Taufers 92007810218 WINKELWEG 60 (KEMATEN) 39032 Sand In Taufers Bozen 25.840,00 2019 Viehversicherungsverein Trens 90008060213 FLANS -

Merancard? the Merancard Is an Advantage Card, Which Is Handed out to Guests in Partici- Pating Partner Accomodations in Merano and Environs
» What is the MeranCard? The MeranCard is an advantage card, which is handed out to guests in partici- pating partner accomodations in Merano and environs. The card is included in the room price and grants access to a number of services without additional charge or at a discounted price (see included services). » How long is the MeranCard valid? The MeranCard is valid from 15th October 2018 to 30th June 2019. The card is valid for your entire stay, provided that it coincides with the validity period of the card. Should you stay for longer than one week, you are entitled to another card. The MeranCard must be validated each time when using public transportation or visiting a museum. In order to benefit from the discounts, the card must MeranCard MERANCARD - INCLUDED SERVICES presented in advance. 2018 /2019 » Who receives the MeranCard? Your advantage card » Bus and train All guests staying at a partner accomodation in Merano and environs get a in Merano and Environs – Use of all public means of transportation belonging card of their own. Children aged between 6 and 14 get a junior card. 15th october 2018 - 30th june 2019 to the South Tyrol Integrated Transport Network: Children under the age of 6, accompanied by an adult holding the MeranCard, all city and extra – urban buses do not require a card of their own. – Regional trains in South Tyrol (Brennero – Trento, Malles – The card is personalized and cannot be transferred. The MeranCard is not San Candido). The card is not valid on Italian InterRegional available for purchase and is handed out to guests with at least one overnight trains or on OEBB, DB, Eurostar or Intercity trains. -

Jahres- Bericht Impressum
2017 2018 VINZENTINUM JAHRES- BERICHT IMPRESSUM Herausgeber: Bischöfliches Institut Vinzentinum Brennerstraße 37 | I-39042 Brixen Tel. 0472 821 600 [email protected] www.vinzentinum.it Redaktion: Christoph Stragenegg, Paul Felix Rigo, Harald Knoflach Layout: Harald Knoflach Druck: Druckerei A. Weger Brixen VINZENTINUM JAHRESBERICHT 2017/18 INHALT 05 VORWORT Regens Markus Moling 06 JAHRESTHEMA Nach uns die Sintflut? 08 Ein Begriff, ein Trend und eine Vision 12 Vermeiden, verlagern und verbessern 18 Gegen die Nachhaltigkeit 20 Sozial-ökologische Umkehr jetzt! 26 VINZ IM BILD Was für ein Projekt 28 BLITZLICHTER Fächer-Über-Greifend 30 RELIGION Nun sag, wie hast du‘s mit der Religion? 44 STIFTUNG Markus Linder und Ganes live 46 VEREIN Wattturnier 48 VINZ IM BILD Treffen, Jubiläen, Ehrungen 50 CHRONIK Das Schuljahr 2017/18 im Rückblick 72 ABSCHIED Regens em. und Spiritual em. 74 VINZ IM BILD Abriss und Aufbau 76 STATISTIK Schüler/-innen im Vinzentinum 90 Personalia 96 ABSCHIED Konrad Willeit 98 GLÜCKWÜNSCHE Dank und Gratulation 99 GEDENKEN In Erinnerung an ... 100 STATISTIK Facharbeitsthemen LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, unser Diözesanbischof Ivo Muser hat sich in einem Hirtenbrief besonders an die Jugendlichen gewandt und sie ermutigt, hoffnungsvoll und mutig in die Zukunft zu schauen, sich den Fragen des Lebens zu stellen und, aus einer christlichen Sinn- perspektive heraus, Antworten auf diese grundlegenden Fragen zu finden. Diese ermutigenden Worte unseres Bischofs sind der Ausgangspunkt für den Jahres- bericht, der heuer dem Thema „Nachhaltigkeit“ im weitesten Sinn gewidmet ist. Nachhaltigkeit ist „ein Bewirtschaftungs- und Entwicklungsprinzip, nach dem nicht mehr natürliche Ressourcen verbraucht werden, als jeweils nachwachsen, sodass die Lebenschancen künftiger Generationen erhalten werden.“ Die Lebenschancen unserer künftigen Generationen können nur erhalten werden, wenn wir bereits in der Ausbildung unserer Jugend das Prinzip der Nachhaltigkeit verankern und vermitteln. -

Venosta Valley Holiday Guide Acitvity, Culture and Fun in the Venosta Valley
Venosta Valley Holiday Guide Acitvity, Culture and Fun in the Venosta Valley Summer and Winter E 6 Venosta Valley Top Ten 13 General Information 14 Venosta Valley Train 15 Mobilcard, museumobil Card, bikemobil Card 16 Cycling in the Venosta Valley 17 Hiking in the Venosta Valley 18 Irrigation Channel Paths 19 Stairways to Heaven – the Alpine Road of Romanesque Art All information is subject to change 21 Skiing in the Venosta Valley 22 Cross-Country Skiing in the Venosta Valley 25 Reschenpass Resia Pass 37 Obervinschgau Upper Venosta Valley tagraum.it 49 Ortler Stelvio National Park Ortles/Ortler Lanarepro 59 Prad am Stilfserjoch Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch Printing: Val Venosta Marketing – Società consortile s.r.l.. Via dei Portici 11, I-39020 Glorenza, phone +39 0473 62 04 80 [email protected], www.vinschgau.netPictures: Val Venosta Marketing (Frieder Blickle, Photo Grüner Thomas), tourism associations of the Venosta Valley culture region, tagraum.it All photo copyrights are the property of the aforementioned photographers or Val Venosta Marketing. design: and Concept © 65 Schlanders – Laas Silandro – Lasa/Schlanders – Laas 75 Latsch – Martelltal Laces – Val Martello/Latsch – Martelltal 85 Kastelbell – Tschars Castelbello – Ciardes/Kastelbell – Tschars The Venosta Valley Culture Region The Venosta Valley culture region runs along the Adige River, starting at its source in the Resia Pass and the spa town of Merano. The valley is characterized by a mild, sunny climate with a varied climate spawning a unique flora and fauna. The valley has pastures and highland plateaus around the Resia Lake and fruit orchards down in the valleys extending up to the 3,905-meter high Ortles summit, the highest mountain in the Eastern Alps. -

3 Study Area and Tisenjoch (Latitude 46°50’N, Longitude 10°50’E)
3 Study area and Tisenjoch (latitude 46°50’N, longitude 10°50’E). For a general view of the studied area and the investigated 1 km² squares see The study area centres on the site of the Fig. 1-3 (attachement). The core area with the Iceman and extends north and south of valleys and mountain ridges (Fig. 1) around the the watershed, i.e., the main divide of the Iceman site is colloquially known as “Ötziland” Alps (Fig. 1-3, see attachment). The region (Dickson 2011b). where the Iceman was found is still referred The core area comprises Vinschgau (Naturns to as Tyrol (Tirol). In 1919, the southern village, Castle Juval, Schlanders village), the part (South Tyrol, Südtirol) became part of Schnalstal (the villages of St. Katharinaberg, Italy and the northern part (North Tyrol, Karthaus, Vernagt and Unser Frau) up to Nordtirol) remained Austrian. In the past, Kurzras village with the side valleys Pfossental, the area with the main municipalities Schnals Klosteralm, Penaudtal, Mastauntal, Finailtal and Vent belonged to the county of Tschars and Tisental leading up to the discovery place (Vinschgau, South Tyrol), but after World of the Iceman. Also the Schlandrauntal/ War I, Vent was merged with the municip- Taschljöchl and the Pfelderertal until it leads ality of Sölden, whereas the whole southern into the Passeiertal were investigated. On the area became Italian. The area played an es- Austrian side, leading down from the Iceman sential role in the development of alpinism, site beside the Niederjochferner (glacier), the alpine tourism and the foundation of the study sites comprise Niedertal with Vent, continental Alpine Club which was initialised Zwieselstein and Nachtberg/Sölden as well by the famous clergyman Franz Senn (Vent) as the Rofental and Tiefenbachtal/Tiefenbach and his companions.