Bachelorarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reichsakademie Für Leibesübungen« Im Katalog Der Zentralbibliothek Der Sportwissenschaften Der Deutschen Sporthochschule Köln
Verzeichnis der 3506 Titel der Sammlung »Reichsakademie für Leibesübungen« im Katalog der Zentralbibliothek der Sportwissenschaften der Deutschen Sporthochschule Köln Köln 14.07.2013. Ein Dokument der Zentralbibliothek der Sportwissenschaften der Deutschen Sporthochschule Köln (ZBSport). Zusammengebaut von Florian Seiffert ([email protected]) mit Aleph 500, perl, mysql und LaTeX. Dieses Dokument steht unter der CC0-Lizenz. 2 1. Kreis-Turnfest Gau 6 Mitte Kreis Sorben; Piesteritz 18. und 19 Erntemond 1934[Wittenberg]: [Kunstdruckerei Stitz], 1934. 74 Seiten, 1 Tafeln, 4 gezählte Blatt; 8-o. ) Ein Buch - Magazin: D 2988 ) Bestellen oder Vormerken bei der ZBSport - ID: HT009431946 13. Lehrgang für Frauenturnen im Krupp’schen Turn- und Jugendhaus in Essen- West am 6. und 7. Januar 1917 Kreis VIII b der Deutschen Turnerschaft. [S.l.]: O. Verl., 1917. 16 Seiten; 8-o. ) Ein Buch - Magazin: D 3086 ) Bestellen oder Vormerken bei der ZBSport - ID: HT009193873 13. nasjonale gymnastikk og turnstevne [program] / Norges gymnastikk-og turnforbunds. Arrangert av: Oslo turnforening. [Oslo]: [Kirstes], 1938. 96 Seiten; 8-o. ) Ein Buch - Magazin: D 3916 ) ZBSport-Systematik: - 3 Geo 599 Norwegen, Nordeuropa, Königreich Norwegen (geographisch Teil von Skan- dinavien; politische Zugehörigkeit: Bouvetinsel, Svalbard, Spitzbergen, Bären- insel, Jan Mayen) - 6 Gym 123f Fachverbände im Gebiet Gymnastik in einzelnen Ländern, Island, Norwe- gen, Schweden, Dänemark, Finnland, geographisch: Nordeuropa, Skandinavi- en; politisch: Norwegen mit Bouvetinsel, Svalbard, Spitzbergen, Bäreninsel, Jan Mayen; Dänemark mit Färöer, Grönland - 6 Tur 123f Fachverbände im Gebiet Turnen, Gerätturnen, Kunstturnen in ein- zelnen Ländern, Island, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, geogra- phisch: Nordeuropa, Skandinavien; politisch: Norwegen mit Bouvetinsel, Sval- bard, Spitzbergen, Bäreninsel, Jan Mayen; Dänemark mit Färöer, Grönland ) Bestellen oder Vormerken bei der ZBSport - ID: HT010947973 19. -

Prelims May 2004.Qxd
German Historical Institute London Bulletin Bd. 26 2004 Nr. 1 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. FOOTBALL, THE NAZIS, AND VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG by Christoph Hendrik Müller DIRK BITZER and BERND WILTING, Stürmen für Deutschland: Die Geschichte des deutschen Fußballs von 1933 bis 1954 (Frankfurt/Main: Campus, 2003), 253 pp. ISBN 3 593 37191 X. EUR 21.50 FABIAN BRÄNDLE and CHRISTIAN KOLLER, Goooal!!! Kultur- und Sozialgeschichte des modernen Fußballs (Zurich: Orell Füssli, 2002), 286 pp. ISBN 3 280 02815 9. EUR 29.50 DAVID DOWNING, The Best of Enemies: England v Germany, a Cen- tury of Football Rivalry (London: Bloomsbury Publishing, 2001; first published 2000), v + 248 pp. ISBN 0 7475 5279 7. £7.99 (paperback) GERHARD FISCHER and ULRICH LINDNER, Stürmer für Hitler: Vom Zusammenspiel zwischen Fußball und Nationalsozialismus (Göttin- gen: Verlag Die Werkstatt, 3rd edn. 2003; first published 1999), 303 pp. ISBN 3 89533 241 0. EUR 17.40 ARTHUR HEINRICH, Der Deutsche Fußballbund: Eine politische Ge- schichte (Cologne: Papyrossa, 2000), 296 pp. ISBN 3 89438 194 9. EUR 15.24 (paperback) ULRICH HESSE-LICHTENBERGER, Tor! The Story of German Football (London: WSC Books, 2002), 360 pp. -

Voetbal in Europa ERIK BROUWER.Indd
voetbal in europa Van dezelfde auteur In den beginne was de bal De hemel is een basketbalveld De Ronde van Italië Spartacus Schaduwboksen De Walthours Diva Erik Brouwer Voetbal in Europa © 2021 Erik Brouwer Omslagontwerp: Loudmouth, Utrecht Binnenwerk: Crius Group, Hulshout isbn 978 90 488 5675 6 isbn 978 90 488 5676 3 (e-book) nur 489 www.overamstel.com Inside is een imprint van Overamstel uitgevers bv Deze uitgave kwam tot stand door de bemiddeling van Maarten Boers Literary Agency en met steun van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. www. fondsbjp.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfi lm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Inhoud Foot-ball Hoofdstuk 1 – De fantastische gebroeders Ross De Lord van Milan Harry’s hond Hoofdstuk 2 – Th e Welsh Wizard en de dood van Champion Sandy Football’s gentleman De offi cier Hoofdstuk 3 – Zijn naam was Giuseppe Meazza Een Hans die een Joan werd El Sami Hoofdstuk 4 – Het wonderteam van de Weners De laatste dagen van Th e Godfather De voeten van God Hoofdstuk 5 – De grootste comeback Het jaar 0 De Napoleon van het voetbal Hoofdstuk 6 – Pancho en de president Mijnheer Edwards Mevrouw Charlton Hoofdstuk 7 – Streltsov en de vrouwen De roker Het geheim van Igor Netto Hoofdstuk 8 – Th e Jimmy & Jinky Show De vrienden uit Oostende De vrienden van Ferencváros Hoofdstuk 9 – De Estafette Mevrouw Best Rudi-Bomber Hoofdstuk -

Arnd Zeigler Taktik Ist Keine Pfefferminzsorte! Bella Arnd Zeigler
Arnd Zeigler Taktik ist keine Pfefferminzsorte! Bella Arnd Zeigler Taktik ist keine Pfefferminzsorte! Neueste Sprüche und Weisheiten der Fußballstars Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. ISBN 978-3-86910-188-0 (Print) ISBN 978-3-86910-289-4 (PDF) Der Autor: Arnd Zeigler ist TV-Moderator mit eigener Sendung im WDR-Fernsehen: „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ läuft seit 2007 immer sonntags um 23.45 Uhr und wird live aus Zeiglers Bremer Wohnung übertragen. Die gleichnamige Radio comedy ist seit über einem Jahrzehnt in den Programmen von Radio Bremen, WDR Eins Live, HR 3, SWR 1, Bayern 3, SR 1 und MDR Sputnik. Ein Blog nannte ihn „the thinking man’s Gerhard Delling“. Zeigler gibt Fußball-CDs heraus, schreibt Kolumnen, ist Stadionsprecher bei Werder Bremen und Texter und Interpret der Werder-Stadionhymnen „Das W auf dem Trikot“ und „Lebens- lang grün-weiß“. Mit letztgenanntem Song schaffte er es im Sommer 2004 für neun Wochen in die deutschen Single-Charts (Beste Platzierung: 44). Deutlich bessere Musik legt er selbst wöchentlich in seiner von der Kritik hochgelobten Kult-Radioshow „Zeiglers wunderbare Welt des Pop“ (immer dienstags, 20 Uhr, Bremen Vier) auf. Bei humboldt sind 4 weitere Bücher der Reiher „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ von Arnd Zeigler erschienen: 1111 Kicker-Weisheiten (ISBN 978-3-86910-157-6) 1000 ganz legale Fußballtricks (ISBN 978-3-89994-077-0) Gewinnen ist nicht wichtig, solange man gewinnt (ISBN 978-3-89994-099-2) Keiner verliert ungern – Neue Sprüche und Zitate der Fußballstars (ISBN 978-3-86910-160-6) Originalausgabe © 2011 humboldt Eine Marke der Schlüterschen Verlagsgesellschaft mbH & Co. -

Uefa Champions League
UEFA CHAMPIONS LEAGUE - 2013/2014 SEASON MATCH PRESS KITS Ernst-Happel-Stadion - Vienna Wednesday 18 September 2013 20.45 CET (20.45 local time) Austria Wien Group G - Matchday 1 Porto Last updated 17/09/2013 03:49 CET UEFA CHAMPIONS LEAGUE OFFICIAL SPONSORS Previous meetings 2 Match background 4 Match facts 5 Squad list 7 Head coach 11 Match officials 12 Fixtures and results 13 Match-by-match lineups 16 Group Standings 18 Competition facts 20 Team facts 21 Legend 23 1 FK Austria Wien - FC Porto Wednesday 18 September 2013 - 20.45CET, (20.45 local time) Match press kit Ernst-Happel-Stadion, Vienna Previous meetings Head to Head UEFA Cup Date Stage Match Result Venue Goalscorers 2-0 Hélder Postiga 29, 14/11/2002 R2 FC Porto - FK Austria Wien Porto agg: 3-0 Derlei 86 31/10/2002 R2 FK Austria Wien - FC Porto 0-1 Vienna Derlei 70 Home Away Final Total Pld W D L Pld W D L Pld W D L Pld W D L GF GA FK Austria Wien 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 FC Porto 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 FK Austria Wien - Record versus clubs from opponents' country UEFA Europa League Date Stage Match Result Venue Goalscorers Rúben Micael 23, 57, Mateus 32, 16/12/2009 GS CD Nacional - FK Austria Wien 5-1 Funchal Tomašević 61, Felipe Lopes 66; Schumacher 21 Schumacher 76; 01/10/2009 GS FK Austria Wien - CD Nacional 1-1 Vienna Rúben Micael 35 UEFA Champions League Date Stage Match Result Venue Goalscorers 3-0 Rui Costa 21, Nuno 22/08/2006 QR3 SL Benfica - FK Austria Wien Lisbon agg: 4-1 Gomes 45+1, Petit 57 Blanchard 36; Nuno 08/08/2006 QR3 FK Austria Wien -

Kahlil Gibran a Tear and a Smile (1950)
“perplexity is the beginning of knowledge…” Kahlil Gibran A Tear and A Smile (1950) STYLIN’! SAMBA JOY VERSUS STRUCTURAL PRECISION THE SOCCER CASE STUDIES OF BRAZIL AND GERMANY Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Susan P. Milby, M.A. * * * * * The Ohio State University 2006 Dissertation Committee: Approved by Professor Melvin Adelman, Adviser Professor William J. Morgan Professor Sarah Fields _______________________________ Adviser College of Education Graduate Program Copyright by Susan P. Milby 2006 ABSTRACT Soccer playing style has not been addressed in detail in the academic literature, as playing style has often been dismissed as the aesthetic element of the game. Brief mention of playing style is considered when discussing national identity and gender. Through a literature research methodology and detailed study of game situations, this dissertation addresses a definitive definition of playing style and details the cultural elements that influence it. A case study analysis of German and Brazilian soccer exemplifies how cultural elements shape, influence, and intersect with playing style. Eight signature elements of playing style are determined: tactics, technique, body image, concept of soccer, values, tradition, ecological and a miscellaneous category. Each of these elements is then extrapolated for Germany and Brazil, setting up a comparative binary. Literature analysis further reinforces this contrasting comparison. Both history of the country and the sport history of the country are necessary determinants when considering style, as style must be historically situated when being discussed in order to avoid stereotypification. Historic time lines of significant German and Brazilian style changes are determined and interpretated. -

Nach Dem Spiel Ist Vor Dem Spiel Was Ein Fußball-Trainer Heute Können Muss Von Marcus Schwandner
SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Wissen Nach dem Spiel ist vor dem Spiel Was ein Fußball-Trainer heute können muss Von Marcus Schwandner Sendung: Mittwoch, 16. Dezember 2015, 08.30 Uhr Redaktion: Sonja Striegl Regie: Autorenproduktion Produktion: SWR 2015 Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Service: SWR2 Wissen können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml Die Manuskripte von SWR2 Wissen gibt es auch als E-Books für mobile Endgeräte im sogenannten EPUB-Format. Sie benötigen ein geeignetes Endgerät und eine entsprechende "App" oder Software zum Lesen der Dokumente. Für das iPhone oder das iPad gibt es z.B. die kostenlose App "iBooks", für die Android-Plattform den in der Basisversion kostenlosen Moon-Reader. Für Webbrowser wie z.B. Firefox gibt es auch sogenannte Addons oder Plugins zum Betrachten von E-Books: Mitschnitte aller Sendungen der Redaktion SWR2 Wissen sind auf CD erhältlich beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden zum Preis von 12,50 Euro. Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de MANUSKRIPT Atmo 01: Geräusche aus den Büros des Trainingszentrums Autor: Montagvormittag im Geißbockheim in Köln. -

Rücktritt & Rückblick
No. 28/2016 Rücktritt & Rückblick 2 CDN-MAGAZIN 28/2016 EDITORIAL Rücktritt nach großen SERIE Turnieren: Schwein- Uwe Seeler über den steiger, Podolski und DER „VERBORGENE“ Rücktritt großer Spieler aus andere Ikonen des NATIONALSPIELER // der Nationalmannschaft // Nationalteams // Lieber früher und V O R B E I ! Reinhard Häfner: ohne Zwang als am Doch unvergessen 12 Kämpfer im Fahrstuhl 20 Ende zu spät 04 AKTUELL IM BLICKPUNKT „Mit Silber, das sich wie Gold anfühlt“, tritt Horst Hrubesch als Trainer- Legende beim DFB zurück // Ein P A T R O N als Freund und Helfer 06 VOR 90 JAHREN 1926 übernahm mit Otto Nerz erstmals ein Trainer die Verantwortung für die Nationalmannschaft // AUFBRUCH „in die Weltspitze“ 24 „Klassentreffen“ der Wembley-Legenden im Deutschen Fußball- Bilderseite // museum in Dortmund // Die SILBER-Helden Der M Y T H O S von Rio 10 lebt weiter 16 3 AKTUELL IM BLICKPUNKT DIAGONALPÄSSE Kalle Rummenigge bis Ende 2019 an der Bayern-Spitze 37 Sie sind das Sondereinsatz- Jérôme Boateng: kommando für das späte Glück: Weltmeister und enga- 20.000 beim „Tag der die letzten Trümpfe von der Bank // gierter Wohltäter 36 Legenden“ in Hamburg 38 „Hofnarr“ als König: der J O K E R 28 Die „1“ – mehr als nur Adlers Rückennummer 38 VOR 60 JAHREN „Icke“ Häßler mit gutem Einstand in der 8. Liga 36 Über Saarlands Nationalelf und den 1. FCS als „interessantestes Fußballteam Europas“ // Technik, Akrobatik und Fußballbesessenheit 32 Welt- und Europameister beim Golf für guten Zweck 39 Große Ehre für Uwe Seeler, Hrubesch und Bruchhagen 37 Marco Reus nach Messi Cover-Star bei „FIFA 17“ 37 IN MEMORIAM 39 JUBILÄEN/ RUNDE GEBURTSTAGE 40 IMPRESSUM 43 4 CDN-MAGAZIN 28/2016 Uwe Seeler über den Rücktritt großer Spieler aus der Nationalmannschaft Lieber früher und ohne Zwang als am Ende zu spät Liebe Freunde! Danke, das war’s! Zumindest zu sich ruhiger angehen lassen und sich Zeitpunkt gewählt hat. -
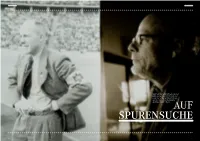
2011 2012 Schalker Kreisel Hertha
AUF SCHALKE AUF SCHALKE Manfred Faist erforschte die letzten Jahre seines Vaters Otto Faist, der einer der erfolgreichsten Trainer des S04 war – und überzeugter Anhänger Adolf Hitlers AUF SPURENSUCHE 60 61 AUF SCHALKE AUF SCHALKE Otto Faists zweites Meisterstück: Nach dem 1:0 gegen den Dresdner SC reihen sich die stolzen Knappen im Berliner Olympiastadion vor 95.000 Zuschauern zum Siegerfoto auf. Trainer Faist steht mit dem Eimer in der Hand zwischen dem Torschützen Ernst Kalwitzki und Bernhard „Natz“ Füller. Manfred Faist war auf Spurensuche, und das hat Spuren auf seiner Seele hinterlassen. Sein Vater Otto Faist ist mit drei Meis ter titeln einer der erfolgreichsten Trai ner der Vereinsgeschichte und er war – das kann Man fred Faist bis heute nicht verstehen – über zeugter National sozialist. Eine Frage treibt den Psychologen immer noch um: „Wie konnte er nur?“ ass die Vergangenheit seine Gegenwart aufs Neue chen Faists Parteimitgliedschaft nicht gefunden, was da ran liegen aufwühlt, das hat damit angefangen, dass Manfred kann, „dass die von den Amerikanern nach der Be frei ung vom Na - Faists Tochter Christiane ihn aufforderte, doch mal tio nalsozialismus vorgenommene Neuordnung der NSDAP-Mitglie - etwas über sein Leben aufzuschreiben. Jahre spä- der kartei bei ‚ei‘ und ‚ai‘ einige Schwierigkeiten mach te. Auf jeden ter, das Kalenderblatt zeigt 2011, liegen 250 Sei ten Fall ist nun die NSDAP-Mitgliedschaft von Otto Faist nachgewie- Dbedrucktes Papier vor ihm – der „Brief an Malin“, seine fünf jährige sen“, wie Goch erklärt. Enkelin. Es werden viele Jahre vergehen, bis Malin dieses Buch liest, bis sie versteht oder einzuordnen vermag, was die Hälfte die- Als Otto Faist in sowjetischer Kriegsgefangenschaft starb, eine ser Lebensnotizen einnimmt und was selbst ihr Groß va ter nicht eidesstattliche Erklärung datiert seinen Tod auf Februar 1946, war versteht: Warum Malins Urgroßvater, warum Otto Faist ein über- Manfred sieben Jahre alt. -
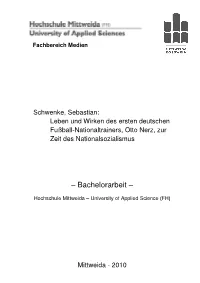
– Bachelorarbeit –
Fachbereich Medien Schwenke, Sebastian: Leben und Wirken des ersten deutschen Fußball-Nationaltrainers, Otto Nerz, zur Zeit des Nationalsozialismus – Bachelorarbeit – Hochschule Mittweida – University of Applied Science (FH) 1 Mittweida - 2010 2 Fachbereich Medien Schwenke, Sebastian: Leben und Wirken des ersten deutschen Fußball-Nationaltrainers, Otto Nerz, zur Zeit des Nationalsozialismus – eingereicht als Bachelorarbeit – Hochschule Mittweida – University of Applied Science (FH) Erstprüfer Zweitprüfer Prof. Dr. Otto Altendorfer Rika Fleck M.Sc. Mittweida 2010 3 Schwenke, Sebastian: Leben und Wirken des ersten deutschen Fußball-Nationaltrainers, Otto Nerz, zur Zeit des Nationalsozialismus. – 2010 – 78 S. Hochschule Mittweida (FH), Fachbereich Medien, Bachelorarbeit Referat: Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem beruflichen und privaten Leben von Otto Nerz in den zwölf Jahren von 1933 bis ‘45. Nerz war erster Nationaltrainer des DFB, zudem Arzt und Dozent an der Deutschen Hochschule für Leibesübungen. Neben seiner Arbeit am Spielfeldrand werden auch sein akademischer Werdegang, sowie seine Mitgliedschaft in SA und NSDAP beleuchtet. Auf eine antisemitische Artikelserie, die unter seinem Namen im Jahr 1943 erschien, wird ebenfalls eingegangen. Die Informationen aus der sportgeschichtlichen Literatur wurden dafür zusammengetragen und durch weit darüber hinausgehende Fakten aus Originalquellen ergänzt. Die Arbeit beinhaltet einen Abriss des Lebens von Nerz während der Zeit des National-sozialismus. Sein Wirken bis zum Jahre 1933 -

DER SPIEGEL Jahrgang 2002 Heft 13
Werbeseite Werbeseite DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Hausmitteilung 25. März 2002 Betr.: Titel, New Economy, Rushdie m 28. Februar 1945 war die Kindheit von Hans-Joachim Noack, 6, zu Ende. Sein AOpa nahm ihn an die Hand und sagte: „Jetzt gehen wir flüchten.“ Von Bär- walde in Pommern sollte es nach Kolberg aufs Schiff Richtung Swinemünde gehen. Endlich an Bord, kamen sowjetische Kampfflugzeuge und warfen Phosphorbomben. In Panik wurde das Schiff geräumt. Wochenlang irrte Noack mit seiner Familie im Niemandsland zwischen heranrückender Roter Armee und abziehender Wehrmacht umher. Die Erlebnisse verfolgten Noack, heute Ressortleiter Politik beim SPIEGEL, jahrelang. Wie ihm ging es Millionen anderer Deutscher, die ihre Heimat verloren, nachdem Hitler Europa mit Terror und Völkermord überzogen hatte. Das Leid der Flüchtlinge und Fortgejagten fand vor allem in den Vertriebenenverbänden Gehör. Die Generation der Nazi-Täter verrechnete es gern mit der eigenen Schuld, die Jüngeren (wie Noack) kümmerten sich vornehmlich um die Verantwortung ihrer Eltern für die Verbrechen Hitlers. „Erst jetzt scheint ein Blick auf die Deutschen auch als Opfer mög- lich zu sein“, sagt Noack, der gemeinsam mit den SPIEGEL-Redakteuren Thomas Darnstädt, 52, und Klaus Wiegrefe, 36, die Titelgeschichte schrieb – Auftakt einer vier- teiligen Serie zum Drama von Flucht und Vertreibung (Seite 36). mlagert von den Gewinnern der Internet-Ära war USPIEGEL-Korrespondentin Michaela Schießl, 40, als sie vor einem Jahr ihr Büro in San Franciscos Hancock Street bezog. Die hatten sich Luxusapartments bauen lassen, fuhren teure Autos, trugen edle Kleidung und gingen zum Essen ins Nobelrestaurant „Bacar“. „Wer in dieser Straße zur Miete wohnte, galt schon als Under- dog“, sagt Schießl. -

Leseprobe Novakovic
2007/08 2. BUNDESLIGA Der Aufstieg als Mannschaftsleistung [ LEGENDEN ] Milivoje Novakovic Beim FC ab 2006 Geboren: 18.05.1979 in Ljubljana/Slowe- nien Spiele: 61 Tore: 32 Unverzichtbarer „nova“ Nach zähen Verhandlungen konnte Ma- nager Michael Meier endlich den Wunsch- Hintere Reihe von links: Matthias Scherz, Kevin McKenna, Milivoje Novakovic, Tobias Nickenig, Carsten Cullmann, Roda Antar, Alpay (wurde im Saisonverlauf aussortiert), Konditionstrainer Cem Bagci. Mittlere Reihe von links: Co-Trainer Roland Koch, stürmer des damaligen Trainers Hanspeter Torwarttrainer Holger Gehrke, Nemanja Vucicevic, Fabrice Ehret, Ümit Özat, Aleksandar Mitreski, Baykal Kulaksizoglu, Thomas Latour, Milivoje Novakovic, für die stolze Broich, Marvin Matip, Kevin Schöneberg, Teambetreuer Murat Kus. Vordere Reihe von links: Cheftrainer Christoph Daum, Patrick Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro von Helmes, André, Dieter Paucken, Stefan Wessels, Faryd Mondragon, Thomas Kessler, Salvatore Gambino, Adil Chihi, Techniktrainer Litex Lovetsch nach Köln lotsen. Der 1,92 Thomas Häßler. Es fehlen: Youssef Mohamad, Kevin Pezzoni, Maynor Suazo, Michael Niedrig, Michael Parensen. Meter große slowenische Nationalspieler tat sich im neuen Umfeld anfangs schwer und bekam von der Bild vorschnell den In der vergangenen Saison Empfehlung von Thomas Nachwuchskräften mit seiner Spitznamen „Novakonix“ verpasst. Doch wurde der avisierte Aufstieg Häßler kam der defensive Erfahrung weiterhelfen. schon im Laufe der insgesamt verkorksten trotz der Rückkehr von Mittelfeldspieler Maynor Suazo Saison 2006/07 deutete der schlaksige Stür- Wunsch trainer Christoph leihweise aus der Türkei. Für „looKing for mer seine Torgefährlichkeit an, immerhin Daum meilen weit verpasst, mehr Kreativität im Mittelfeld eXcellence“ zehnmal traf er in der ersten Saison beim und große „Topstars“ gab es sollte der Libanese Roda Antar Unter das Motto „Looking FC.