Bmwi Digital-Gipfel 2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Water, Food and Agriculture: Challenges for Farmers and Agribusiness”
Global Forum for Food and Agriculture 20142017 Landwirtschaft stärken – Ernährung sichern 16.Summary – 18. Januar of 2014, Results ICC Berlin bmel.de GFFA Berlin e.V. 2 Global Forum for Food and Agriculture 2017 Foreword Dear Readers, The Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), host- ed by the Federal Ministry of Food and Agriculture, has firmly established itself as a driving force and market- place for innovative ideas on international agricultural policy issues relating to the global food situation. This year‘s 9th GFFA once again brought together around 2000 international guests from 136 different countries to take part in the three-day international conference, including many high-level representatives from poli- tics, industry, science and civil society. It is precisely this cross-sectoral exchange, transcending national borders and continents, that makes the GFFA so unique. The 2017 GFFA was dedicated to the issue of water, a particularly vital resource for the agricultural sector. Because it is only if agriculture has sufficient clean water that it will be able to fulfil its role as a major supplier of food and ensure food supplies for the growing world population. However, the competition over this unique resource is becoming increasingly fierce. There are many reasons for this: rapid economic development, steady growth of the world population, climate change and also changes in lifestyles and eating habits. Summary of Results 3 The GFFA discussions therefore focused on what the German presidency on the day after the GFFA, as contribution agriculture could make to the sustainable a basis for the jointly adopted Action Plan. -

Plenarprotokoll 16/3
Plenarprotokoll 16/3 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 3. Sitzung Berlin, Dienstag, den 22. November 2005 Inhalt: Nachruf auf die Abgeordnete Dagmar Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister Schmidt (Meschede) . 65 A des Innern . 68 D Begrüßung der neuen Abgeordneten Brigitte Zypries, Bundesministerin der Justiz 68 D Christoph Pries und Johannes Singhammer 65 D Peer Steinbrück, Bundesminister der Finanzen 68 D Michael Glos, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie . 69 A Tagesordnungspunkt 1: Horst Seehofer, Bundesminister für Ernährung, Wahl der Bundeskanzlerin . 65 D Landwirtschaft und Verbraucherschutz . 69 A Präsident Dr. Norbert Lammert . 66 B Dr. Franz Josef Jung, Bundesminister der Verteidigung . 69 A Ergebnis . 66 C Dr. Ursula von der Leyen, Bundesministerin Dr. Angela Merkel (CDU/CSU) . 66 D für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 69 B Ulla Schmidt, Bundesministerin für Tagesordnungspunkt 2: Gesundheit . 69 B Eidesleistung der Bundeskanzlerin . 67 A Wolfgang Tiefensee, Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung . 69 B Präsident Dr. Norbert Lammert . 67 A Sigmar Gabriel, Bundesminister für Umwelt, Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin . 67 B Naturschutz und Reaktorsicherheit . 69 B Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung . 69 C Tagesordnungspunkt 3: Heidemarie Wieczorek-Zeul, Bundesministerin Bekanntgabe der Bildung der Bundesregie- für wirtschaftliche Zusammenarbeit und rung . 67 C Entwicklung . 69 C Präsident Dr. Norbert Lammert . 67 C Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister für besondere Aufgaben . 69 C Tagesordnungspunkt 4: Eidesleistung der Bundesminister . 68 B Tagesordnungspunkt 5: Präsident Dr. Norbert Lammert . 68 B Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, der SPD, der FDP, der LINKEN und des BÜND- Franz Müntefering, Bundesminister für Arbeit NISSES 90/DIE GRÜNEN: Bestimmung des und Soziales . 68 C Verfahrens für die Berechnung der Stellen- Dr. -

G O So No Germa on So Oil P Ov 1 An-S Oil Sc Rote 17-20
GERMAN-SINO SYMPOSIUM ON SOIL SCIENCE AND SOIL PROTECTION NOV 17-20, 2015 2016 German-Chinese Agricultural Center (DCZ) Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) Final report compiled and edited by Dr. Marco Roelcke, DCZ German-Sino Symposium on Soil Science and Soil Protection November 17-20, 2015 Final Report Compiled and edited by Dr. Marco Roelcke (June 2016) Contents page Executive Summary 1 Summarizing report by Dr. Marco Roelcke, DZC (May 2016) 3 Reports by the six invited German experts (Dec. 2015-March 2016) 37 Summarizing report by Chinese side on Symposium and S&T Platform (Jan. 2016) 63 Annexes: 73 Workshop Programme 75 Participants list German side 85 Participants list Chinese side 89 1 Executive summary On November 17-18, 2015, a “German-Sino Symposium on Soil Science and Soil Protection” was jointly organized by the DCZ and the Institute of Agricultural Resources and Regional Planning (IARRP) of the Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS). This major event was one of the activities of the DCZ during the “German-Sino Agricultural Week” (Nov. 16-19, 2015), and in a broader context, also a part of the UN-FAO “2015 International Year of Soils”. Over 130 participants (soil scientists, soil policy officers, German and Chinese agro-industry representatives, extension services, practitioners and students) attended the event on November 18. Topics dealt with in several sessions included Soil Protection Policy and Strategies, Cutting-edge Knowledge on Soil Science and Soil Protection, Transfer and Extension: Demonstration Farms in China, and Technological Solutions to Soil Protection. The Concluding Discussion Session was attended by the German Parliamentary State Secretary (BMEL) Mr. -

Entschließungsantrag Der Abgeordneten Steffi Lemke, Ulrike Höfken, Michaele Hustedt Und Der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Deutscher Bundestag Drucksache 13/3634 13. Wahlperiode 31.01.96 Entschließungsantrag der Abgeordneten Steffi Lemke, Ulrike Höfken, Michaele Hustedt und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu der Großen Anfrage der Abgeordneten Peter Harry Carstensen (Nordstrand), Renate Blank, Peter Bleser, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Dr. Hermann Otto Solms, Günther Bredehorn, Ulrich Heinrich, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der F.D.P. — Drucksachen 13/1633, 13/2583, 13/3044 (Berichtigung) — Lage der Fischerei Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Die Entwicklung der Fischbestände in Nordwest-Atlantik, im Nordost-Atlantik sowie in der Nord- und Ostsee ist seit Jahren rückläufig. Neben der jahrzehntelang überhöhten Schadstoff- einleitung in die Meere trägt die Fischereiwirtschaft die Haupt- verantwortung am rapiden Schrumpfen der Fischbestände und am ökologischen Ausverkauf der Meere. Aus der Nordsee werden seit langem mehr Fische entnommen als nachwachsen können. Dabei wird ein Drittel der Gesamtfangmenge als Abfall ins Meer zurückgeworfen (Discard), ein Viertel wird zu Fischöl oder Fischmehl verarbeitet (Industriefischerei). Die wichtigsten Speisefischarten Kabeljau, Schellfisch, Seelachs, Scholle, Seezunge und Makrele sind in der Nordsee bis zur biologisch kritischen Grenze dezimiert. Die Erholung der Be- stände ist akut gefährdet, da immer mehr Fische entnommen werden, bevor sie geschlechtsreif sind. Da das Durchschnitts- gewicht der Fische stetig abnimmt, verschlechtert sich auch das wirtschaftliche Ergebnis der Fischer. Die Fischereiwirt- schaft steht ökonomisch vor dem Aus, da sie sich selbst ihre Wirtschaftsgrundlage entzieht. Die deutsche Große Hochsee- fischerei ist aufgrund des massiven Ertragrückgangs bereits völlig eingestellt worden. Die Europäische Kommission erkennt an, daß die intensive Fischerei zur Überfischung geführt und sich das Verhältnis der Arten zueinander drastisch geändert hat. -

Deutscher Bundestag
Plenarprotokoll 15/34 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 34. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 19. März 2003 Inhalt: Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 2701 A Dr. Angela Merkel CDU/CSU . 2740 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 2701 D Gerhard Rübenkönig SPD . 2741 B Steffen Kampeter CDU/CSU . 2743 D Tagesordnungspunkt I: Petra Pau fraktionslos . 2746 D Zweite Beratung des von der Bundesregie- Dr. Christina Weiss, Staatsministerin BK . 2748 A rung eingebrachten Entwurfs eines Geset- Dr. Norbert Lammert CDU/CSU . 2749 C zes über die Feststellung des Bundeshaus- haltsplans für das Haushaltsjahr 2003 Günter Nooke CDU/CSU . 2750 A (Haushaltsgesetz 2003) Petra-Evelyne Merkel SPD . 2751 D (Drucksachen 15/150, 15/402) . 2702 B Jens Spahn CDU/CSU . 2753 D 13. Einzelplan 04 Namentliche Abstimmung . 2756 A Bundeskanzler und Bundeskanzleramt Ergebnis . 2756 A (Drucksachen 15/554, 15/572) . 2702 B Michael Glos CDU/CSU . 2702 C 19. a) Einzelplan 15 Franz Müntefering SPD . 2708 A Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung Wolfgang Bosbach CDU/CSU . 2713 A (Drucksachen 15/563, 15/572) . 2758 B Franz Müntefering SPD . 2713 D Dr. Guido Westerwelle FDP . 2714 C b) Erste Beratung des von den Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/ Otto Schily SPD . 2718 B DIE GRÜNEN eingebrachten Ent- Hans-Christian Ströbele BÜNDNIS 90/ wurfs eines Gesetzes zur Änderung der DIE GRÜNEN . 2719 A Vorschriften zum diagnoseorientierten Fallpauschalensystem für Kranken- Dr. Guido Westerwelle FDP . 2719 C häuser – Fallpauschalenänderungs- Krista Sager BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2720 C gesetz (FPÄndG) (Drucksache 15/614) . 2758 B Dr. Wolfgang Schäuble CDU/CSU . 2724 D Dr. Michael Luther CDU/CSU . 2758 D Gerhard Schröder, Bundeskanzler . -
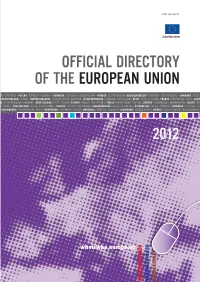
Official Directory of the European Union
ISSN 1831-6271 Regularly updated electronic version FY-WW-12-001-EN-C in 23 languages whoiswho.europa.eu EUROPEAN UNION EUROPEAN UNION Online services offered by the Publications Office eur-lex.europa.eu • EU law bookshop.europa.eu • EU publications OFFICIAL DIRECTORY ted.europa.eu • Public procurement 2012 cordis.europa.eu • Research and development EN OF THE EUROPEAN UNION BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑΔΑ • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND • ÖSTERREICH • POLSKA • PORTUGAL • ROMÂNIA • SLOVENIJA • SLOVENSKO • SUOMI/FINLAND • SVERIGE • UNITED KINGDOM • BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑ∆Α • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND • ÖSTERREICH • POLSKA • PORTUGAL • ROMÂNIA • SLOVENIJA • SLOVENSKO • SUOMI/FINLAND • SVERIGE • UNITED KINGDOM • BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑΔΑ • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND • ÖSTERREICH • POLSKA • PORTUGAL • ROMÂNIA • SLOVENIJA • SLOVENSKO • SUOMI/FINLAND • SVERIGE • UNITED KINGDOM • BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑΔΑ • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND -

Deutscher Bundestag
Plenarprotokoll 17/31 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 31. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 18. März 2010 I n h a l t : setzes über die Feststellung des Bun- Glückwünsche zum Geburtstag der Abgeord- deshaushaltsplans für das Haushalts- neten Dr. Claudia Winterstein ................... jahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010) 2833 A (Drucksachen 17/200, 17/201) ................. 2833 B b) Beschlussempfehlung des Haushaltsaus- schusses zu der Unterrichtung durch die Bun- desregierung: Finanzplan des Bundes 2009 Wahl der Abgeordneten Petra Pau zum Mit- bis 2013 glied des Gemeinsamen Ausschusses nach (Drucksachen 16/13601, 17/626) .................. Art. 53 a des Grundgesetzes und der Abge- 2833 C ordneten Kersten Steinke zum stellvertreten- den Mitglied des Gemeinsamen Ausschusses nach Art. 53 a des Grundgesetzes .............. 13 Einzelplan 10 2833 B Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Drucksachen 17/610, 17/623) ................. 2833 D Nachträgliche Ausschussüberweisung .......... Rolf Schwanitz (SPD) .................................. 2833 B 2834 A Georg Schirmbeck (CDU/CSU) .................... 2835 B Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE) ............ 2837 D Tagesordnungspunkt I (Fortsetzung): Heinz-Peter Haustein (FDP) ......................... a) Zweite Beratung des von der Bundesre- 2839 B gierung eingebrachten Entwurfs eines Ge- II Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 31. Sitzung, Berlin, Donnerstag, den 18. März 2010 Alexander Bonde (BÜNDNIS 90/ Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister DIE GRÜNEN) -

Press Relaese
Press Release Simmern, Juin, 2018 ERO celebrates plant opening ERO GmbH has invested over €20 million in its new production plant in Simmern. The plant was officially unveiled on Monday with the Rhineland‐ Palatinate Economics Minister Dr. Volker Wissing and 400 guests from business, politics and the ERO company present. Just under two years after the cornerstone was laid, ERO GmbH celebrated the opening of the new plant in the Industriepark West in Simmern. “Today is an especially memorable day for us and we are delighted that all of you have taken the time to celebrate opening the new plant with us,” said ERO managing director Michael Erbach to the guests. The manufacturer of vineyard devices had invited political representatives, construction companies and neighboring companies. A special ceremony with employees marked the grand opening of the plant. Minister of Economics Dr. Volker Wissing emphasized the importance of medium‐ sized family businesses to the state: “Rooted in the Hunsrück and at home in world markets. This is ERO’s recipe for success and is an example of our successful medium‐sized enterprises. Companies such as ERO create innovative products used in our state of Rhineland‐Palatinate while also in demand on international markets. They secure jobs in the region and supply important machines for our local winemakers and farmers. Last but not least, as Rhineland‐ Palatinate Minister of Economic Affairs, Transport, Agriculture and Viticulture, I am impressed by how these areas overlap here at ERO. These show: Rhineland‐ Palatinate is a strong agricultural location and the no. 1 wine state in Germany, and, at the same time, home to the leading companies in the agricultural machinery industry. -

Policies Against Hunger XI
Policies against Hunger XI Responsible Agricultural Investments – an Expert Meeting 30 June and 1 July 2014 Federal Foreign Office, Berlin Programme (as per 17.06.2014) Monday, 30.06.2014 11:30 Admission 12:00 – 13:45 Lunch / informal get-together 14:00 Opening Opening addresses by Christian Schmidt, Federal Minister of Food and Agriculture Hans-Joachim Fuchtel, Parliamentary State Secretary to the Federal Minister for Economic Cooperation and Development Patricia Flor, Director-General for United Nations and Global Issues at the Federal Foreign Office 14:30 – 15:45 Opening Panel (de, en, fr, es) Responsible Agricultural Investment: Assessment of the First Round of CFS-RAI Negotiations and Expectations Moving Forward Gerda Verburg, Chair of the Committee on World Food Security (CFS) -Keynote Speech- Tanja Busse -Facilitator- Panelists: Proceso Alcala, Secretary of Agriculture, Philippines (tbc) Evelyn Nguleka, WFO, Zambia Cheikh Mouhamady Cissokho, ROPPA, Senegal Lisa Coen, Bayer Crop Science, USA Maryam Rahmanian, CENESTA, Iran 15:45 – 16:15 Coffee break 1 16:15 – 18:15 Discussion in Working Groups WG 1: What are the states' obligations with regard to providing a framework for investments that is based on human rights and the principles of good governance? (de, en, es) Michael Windfuhr, DIMR, Germany -Keynote Speech- Bettina Rudloff, SWP, Germany -Facilitator- Annotations from: Alphajoh Cham, Ministry of Lands, Country Planning and the Environment, Sierra Leone Iris Krebber, DFID, United Kingdom Rajashekar Reddy Seelam, Sresta Natural -

Deutscher Bundestag
Plenarprotokoll 15/10 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 10. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 14. November 2002 Inhalt: Begrüßung der Präsidenten der Nationalver- Dr. Werner Hoyer FDP . 541 D sammlung der Republik Korea, Herr Park Dr. Ludger Volmer BÜNDNIS 90/ Kwan Yong . 531 A DIE GRÜNEN . 543 C Verabschiedung des Abgeordneten Dr. Ingo Dr. Friedbert Pflüger CDU/CSU . 544 D Wolf . 531 B Dr. Gerd Müller CDU/CSU . 545 D Begrüßung der neuen Abgeordneten Gisela Pilz . 531 B Dr. Peter Struck, Bundesminister BMVg . 547 C Wahl der Abgeordneten Eckhardt Barthel Dr. Karl A. Lamers (Heidelberg) CDU/CSU 549 C (Berlin), Monika Griefahn, Michael Roth Winfried Nachtwei BÜNDNIS 90/ (Heringen), Karl-Theodor Freiherr von und DIE GRÜNEN . 551 A zu Guttenberg, Günter Nooke, Annette Widmann-Mauz, Volker Beck und Hans- Monika Heubaum SPD . 552 B Joachim Otto (Frankfurt) als Mitglieder des Petra Pau fraktionslos . 553 C Kuratoriums der „Stiftung Denkmal für die er- mordeten Juden Europas“ . 531 B Tagesordnungspunkt 4: Erweiterung der Tagesordnung . 531 C a) Erste Beratung des von den Abgeordne- ten Wolfgang Bosbach, Dr. Norbert Tagesordnungspunkt 3: Röttgen, weiteren Abgeordneten und der Fraktion der CDU/CSU eingebrach- a) Abgabe einer Regierungserklärung: ten Entwurfs eines Gesetzes zur Ver- NATO-Gipfel am 21./22. November besserung des Schutzes der Bevölke- 2002 in Prag . 532 B rung vor Sexualverbrechen und b) Antrag der Abgeordneten Dr. Friedbert anderen schweren Straftaten Pflüger, Dr. Wolfgang Schäuble, weite- (Drucksache 15/29) . 554 C rer Abgeordneter und der Fraktion der b) Antrag der Abgeordneten Wolfgang CDU/CSU: Die NATO auf die neuen Bosbach, Dr. Norbert Röttgen, weiterer Gefahren ausrichten Abgeordneter und der Fraktion der (Drucksache 15/44) . -

Plenarprotokoll 18/16
Inhaltsverzeichnis Plenarprotokoll 18/16 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 16. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 19. Februar 2014 Inhalt: Tagesordnungspunkt 1: Antwort Dr. Ralf Brauksiepe, Parl. Staatssekretär Fragestunde BMVg . 1163 D Drucksache 18/527 . 1161 B Zusatzfrage Doris Wagner (BÜNDNIS 90/ Mündliche Frage 1 DIE GRÜNEN) . 1164 A Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE) Steuerung des Milchmarktes für den Aus- stieg aus dem Milchquotensystem 2015 Mündliche Frage 7 Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/ Antwort DIE GRÜNEN) Peter Bleser, Parl. Staatssekretär BMEL . 1161 B Einsatz der von der Bundeswehr ange- schafften Mobilen Geschützten Fernmel- Zusatzfragen deaufklärungssysteme der Plath GmbH Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE) . 1161 D Friedrich Ostendorff (BÜNDNIS 90/ Antwort DIE GRÜNEN) . 1162 B Dr. Ralf Brauksiepe, Parl. Staatssekretär BMVg . 1164 C Mündliche Frage 2 Zusatzfragen Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE) Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 1164 C Ergebnis des Abschlussberichts zum soge- Katja Keul (BÜNDNIS 90/ nannten Blutschwitzen bei Kälbern DIE GRÜNEN) . 1165 B Antwort Peter Bleser, Parl. Staatssekretär BMEL . 1162 D Mündliche Frage 8 Andrej Hunko (DIE LINKE) Zusatzfragen Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE) . 1163 A Aufbau eines Kommandos „Computer Netz- werk Operation“ der Bundeswehr Mündliche Frage 5 Antwort Doris Wagner (BÜNDNIS 90/ Dr. Ralf Brauksiepe, Parl. Staatssekretär DIE GRÜNEN) BMVg . 1165 C Einsatz der „Lotsen für Einsatzgeschä- Zusatzfragen digte“ Andrej Hunko (DIE LINKE) . 1166 A II Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 16. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 19. Februar 2014 Mündliche Frage 9 Mündliche Frage 15 Andrej Hunko (DIE LINKE) Peter Meiwald (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) Übungsflüge und Abstürze von Drohnen des Typs LUNA Einführung eines Handypfandes zur Ver- besserung der Rücklaufquoten von Handys Antwort und Smartphones Dr. -

Plenarprotokoll 16/25
Plenarprotokoll 16/25 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 25. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 16. März 2006 Inhalt: Wahl der Abgeordneten Wolfgang Börnsen Dr. Heinrich L. Kolb (FDP) . 1889 D (Bönstrup) und Monika Griefahn als ordent- liche Mitglieder in den Verwaltungsrat der Andreas Steppuhn (SPD) . 1890 C Filmförderungsanstalt und des Abgeordneten Johann-Henrich Krummacher und der frü- Namentliche Abstimmung . 1891 D heren Abgeordneten Gisela Hilbrecht als stell- vertretende Mitglieder in den Verwaltungsrat der Filmförderungsanstalt . 1875 B Ergebnis . 1894 A Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- nung . 1875 B Absetzung der Tagesordnungspunkte 12, 19 c Tagesordnungspunkt 4: und 22 . 1876 D Erste Beratung des von den Abgeordneten Nachträgliche Ausschussüberweisung . 1876 D Dr. Hermann Otto Solms, Carl-Ludwig Thiele, Dr. Volker Wissing, weiteren Abge- ordneten und der Fraktion der FDP einge- brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Tagesordnungspunkt 3: Reform der direkten Steuern (Drucksache 16/679) . 1892 A Zweite und dritte Beratung des von den Frak- tionen der CDU/CSU und der SPD einge- Dr. Hermann Otto Solms (FDP) . 1892 B brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Förde- rung ganzjähriger Beschäftigung Otto Bernhardt (CDU/CSU) . 1896 B (Drucksachen 16/429, 16/971) . 1877 A Dr. Barbara Höll (DIE LINKE) . 1898 B Klaus Brandner (SPD) . 1877 A Gabriele Frechen (SPD) . 1899 C Jörg Rohde (FDP) . 1878 D Dr. Hermann Otto Solms (FDP) . 1901 C Dr. Ralf Brauksiepe (CDU/CSU) . 1880 C Christine Scheel (BÜNDNIS 90/ Kornelia Möller (DIE LINKE) . 1883 B DIE GRÜNEN) . 1902 A Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/ Dr. Hermann Otto Solms (FDP) . 1902 B DIE GRÜNEN) . 1884 D Hans Michelbach (CDU/CSU) . 1904 C Gerd Andres, Parl.