Integrierte Ländliche Entwicklung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BFV Ü50-Cup 2019
BFV Ü50-Cup 2019 Samstag, 04. Mai 2019 Schwarzhofen, Am Kaplanacker 1 Beginn: 12:00 Uhr Spielzeit: 1 x 15:00 min Pause: 02:00 min I. Teilnehmende Mannschaften Gruppe A Gruppe B 1. SV Schwarzhofen 1. TSV Deuerling 2. RT Regensburg 2. FC Amberg 3. FK Phönix Regensburg 3. SV Raigering 4. SG Saal/Teugn 4. DJK Vilzing 5. SG Mantel/Etzenricht 5. SG Brennberg/Rettenbach 6. spielfrei 6. SG Bernhardswald/Regenstauf II. Spielplan Vorrunde Nr. Platz Grp. Beginn Spielpaarung Ergebnis 1 1 A 12:00 SV Schwarzhofen - RT Regensburg : 2 2 B 12:00 TSV Deuerling - FC Amberg : 3 1 A 12:17 FK Phönix Regensburg - SG Saal/Teugn : 4 2 B 12:17 SV Raigering - DJK Vilzing : 5 1 A 12:34 SG Mantel/Etzenricht - spielfrei : 6 2 B 12:34 SG Brennberg/Rettenbach - SG Bernhardswald/Regenstauf : 7 1 A 12:51 SV Schwarzhofen - FK Phönix Regensburg : 8 2 B 12:51 TSV Deuerling - SV Raigering : 9 1 A 13:08 RT Regensburg - SG Mantel/Etzenricht : 10 2 B 13:08 FC Amberg - SG Brennberg/Rettenbach : 11 1 A 13:25 SG Saal/Teugn - spielfrei : 12 2 B 13:25 DJK Vilzing - SG Bernhardswald/Regenstauf : 13 1 A 13:42 SV Schwarzhofen - SG Mantel/Etzenricht : 14 2 B 13:42 TSV Deuerling - SG Brennberg/Rettenbach : 15 1 A 13:59 RT Regensburg - SG Saal/Teugn : 16 2 B 13:59 FC Amberg - DJK Vilzing : 17 1 A 14:16 spielfrei - FK Phönix Regensburg : 18 2 B 14:16 SG Bernhardswald/Regenstauf - SV Raigering : 19 1 A 14:33 SG Saal/Teugn - SV Schwarzhofen : 20 2 B 14:33 DJK Vilzing - TSV Deuerling : 21 1 A 14:50 spielfrei - RT Regensburg : 22 2 B 14:50 SG Bernhardswald/Regenstauf - FC Amberg : 23 1 A 15:07 FK Phönix Regensburg - SG Mantel/Etzenricht : 24 2 B 15:07 SV Raigering - SG Brennberg/Rettenbach : 25 1 A 15:24 spielfrei - SV Schwarzhofen : 26 2 B 15:24 SG Bernhardswald/Regenstauf - TSV Deuerling : 27 1 A 15:41 RT Regensburg - FK Phönix Regensburg : 28 2 B 15:41 FC Amberg - SV Raigering : 29 1 A 15:58 SG Mantel/Etzenricht - SG Saal/Teugn : 30 2 B 15:58 SG Brennberg/Rettenbach - DJK Vilzing : Spielplan Ü50-Cup 2019 Schwarzhofen 1 von 3 BFV Ü50-Cup 2019 III. -

Amtsblatt Juni 2020
An alle Haushalte Juni 2020 Amtsblatt der Gemeinde Wenzenbach Storchenkinder ! FOTO: GERTRAUD WOLF ANZEIGE ANZEIGE Amtliches Mitteilungsblatt VORWORT Wenzenbach Ausgabe 06/2020 3 Liebe Wenzenbacherinnen und Wenzenbacher, im letzten Amtsblatt haben wir angekündigt, behelfsbrücke getätigt. Dass es also zu Verzö- diverser Sicherheitsvorkehrungen wie dem dass in den Pfingstferien für Probstberger Fuß- gerungen im kommunizierten Bauzeitenplan durchgängigen Tragen von Masken und groß- gänger und Radfahrer die Behelfsbrücke über kommt, ärgert auch mich gewaltig, aber wir zügigen Sicherheitsabständen in der Kirche am die B16 eingehoben wird. Leider kam es zu müssen es so nehmen, wie es kommt. Fronleichnamsgottesdienst teil. Mir hat das vor einer zeitlichen Verschiebung, die uns vom Augen geführt, dass wir zwar langsam wieder Staatlichen Bauamt erst einige Tage nach Jedenfalls haben wir nun für Schulkinder vom zu einer (vermeintlichen) Normalität zurück- Erscheinen des letzten Amtsblatts mitgeteilt unteren Probstberg eine Bushaltestelle einge- kehren, es bis dahin aber trotzdem noch ein wurde. Dies hatte größere Unmutsbekundun- richtet, obwohl für diese unter normalen weiter Weg sein wird. Ich bin mir sicher, dass gen von einigen Bürgerinnen und Bürgern zur Umständen kein Beförderungsanspruch gege- vor allem viele Wenzenbacher Geschäftsbe- Folge. Gerade deshalb möchte ich in diesem ben wäre. Meiner Kenntnis nach plant das triebe immer noch hart von der Corona-Krise Amtsblatt nochmals darauf hinweisen, dass die Staatliche Bauamt nun die Fertigstellung der erfasst sind, sodass ich Sie letztlich auch als Gemeinde stets darum bemüht ist, die Beein- Brücke bis Ende Juni. Bis dahin bitte ich um potenzielle Kunden darum bitten möchte, die trächtigungen durch diese Baumaßnahme des Ihr Verständnis! heimische Wirtschaft in diesen Tagen beson- Bundes für die Bevölkerung so gering wie mög- ders zu unterstützen! lich zu halten. -

Heft 50 / April 2015 Schutzpreis Für Nichtmitlieder 2,00 € BJV Heft 50 2015 25.03.15 08:10 Seite 2 BJV Heft 50 2015 25.03.15 08:10 Seite 3
BJV_Heft_50_2015 25.03.15 08:10 Seite 1 JAGD UND NATURSCHUTZ Anerkannter Naturschutzverband LANDESJAGDVERBAND BAYERN e.V. BEZIRKSVERBAND REGENSBURG e.V. 50. Jubiläumsausgabe Einladung zur Ordentlichen Mitgliederversammlung 2015 Termine unter: www.jagd-regensburg.de JAHRGANG 25 Heft 50 / April 2015 Schutzpreis für Nichtmitlieder 2,00 € BJV_Heft_50_2015 25.03.15 08:10 Seite 2 BJV_Heft_50_2015 25.03.15 08:10 Seite 3 Inhalt Einladung zur Hubertusmesse 2015 . 4 Aus der Redaktion Im Visier . 5 Liebe Jägerinnen, liebe Jäger, Hubertus Mühlig, 1. Vorsitzender über fast ein Jahrzehnt hat Dr. Otto Spanner in der „Jagd und Naturschutz“ zu Themen aus Jagd und Naturschutz berichtet. Es fing an unter der Überschrift „Die Seltenen“ mit der Vorstellung Schießsportzentrum Bockenberg . 6 seltener Blumen in unserem Land, weil er der vermutlich richti- gen Ansicht war, dass Jäger auch über Blumen mehr Bescheid Untere Jagdbehörde . 7–10 wissen sollten als nur über das Gänseblümchen oder den Lö - Karl Frank wen zahn. Aus diesen Anfängen heraus sind dann viele Berichte über seine Erlebnisse bei der Jagd entstanden, ergänzt durch die Jagderlebnisse von Manfred H. J. Gold, die unsere Zeitschrift, UVV Jagd . 11 weit über ein Organ der Informationsvermittlung, zu einem von der ersten bis zur letzten Seite lesenswerten Heft aufgewertet Hygieneverordnung Tierische Lebensmittel . 12 haben. Otto Spanner hat mit dem Beitrag im letzten Heft vorerst seinen letzten Artikel geliefert. Es bleibt offen, ob er sich in die- Hundewesen in der BJV Kreisgruppe . 13 sem Heft noch einmal zu Wort melden wird. Den Jägerinnen und Jägern wird er in dankbarer Erinnerung bleiben. Klaus Wiesner Ihr Kai Taeger Hubertusmesse in der Alten Kapelle 2014 . -

1905 Mitteilungsblatt Mai 2019.Pdf
MITTEILUNGSBLATT für die Verwaltungsgemeinschaft Kallmünz www.vg-kallmuenz.de Mitgliedsgemeinden: Gemeinde Duggendorf Markt Kallmünz Gemeinde Holzheim a. Forst www.duggendorf.de www.kallmuenz.de www.holzheim-a-forst.de Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kallmünz, Keltenweg 1, 93183 Kallmünz • Telefon (09473) 9401- 0 Telefax (09473) 9401-19 Öffnungszeiten: vormittags Montag mit Freitag von 8.00–12.00 Uhr e-mail: [email protected] nachmittags Dienstag von 13.30–17.00 Uhr, Donnerstag von 13.30 –18.00 Uhr Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe: Kallmünz Duggendorf Holzheim a. Forst Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr Freitag von 14.00 bis 16.30 Uhr Freitag von 14.30 bis 16.30 Uhr Freitag von 12.30 bis 16.30 Uhr Samstag von 9.30 bis 12.00 Uhr Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr von Mai bis einschl. Oktober von Mai bis einschl. September Dienstag von 18.00 bis 19.00 Uhr Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr nur Grüngutanlieferungen Öffnungszeiten der Gemeindebücherei Kallmünz jeden Dienstag von 16.00 bis 19.30 Uhr, Mittwochsausleihe siehe Aushang Bücherei 7.45–12.15 Uhr, Donnerstag 16.30–18.30 Uhr, Ferienzeiten nur donnerstags geöffnet. 40. Jahrgang Mai 2019 Nr. 5 Verwaltungsgemeinschaft Kallmünz Die Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kallmünz ist am Freitag, 31.5.2019 ganztägig geschlossen. Hör- und Sprachtest für Kinder Die Abfallwirtschaft des Landkreises Regensburg infor- „pädagogisch-audiologischer Sprechtag“ miert Beim Staatlichen Landratsamt Regensburg, Gesundheits- Bitte Anlieferkriterien für Bauschutt und Grüngut auf amt, Altmühlstraße 3, besteht die Möglichkeit, hör- und den Wertstoffhöfen beachten sprachauffällige Kinder vorzustellen. -

Regionaltage: Leben, Bauen, Wohnen
www.landkreis-regensburg.de Unser Land ZEITUNG DES LANDKREISES REGENSBURG 3/2009 September · KW 38 Das ausführliche Programm zu den Regionaltagen 2009 finden Sie in der Mitte der Landkreiszeitung! Regionaltage: Leben, Bauen, Wohnen Ausgezeichnete Wohn- und Lebensqualität im Regensburger Land Attraktive Erfolgreiches Kinder schreiben Schullandschaft Burgenfestival für Kinder BOB und Mittelschule bieten Chancen Spektakel begeisterte Kulturfans Buchvorstellung wurde zum Fest Unser Land www.landkreis-regensburg.de Inhalt Zuhause fühlen Starke Wirtschafts- zeigt die Stärken der Region und präsentiert je nach Regionaltage-Start räume , Kulturerlebnis- Jahresmotto die regionalen Besonderheiten. mit Bau-Infotag 3 se und attraktive Frei- Sehr gut leben in Neutraubling 4 zeitmöglichkeiten in Die Regionaltage vom 25. September bis 4. Oktober www.bauen-im- einer wunderschönen zeigen die hohe Lebensqualität und die vielfältigen regensburger-land.de 5 Landschaft zeichnen Wohnmöglichkeiten im Regensburger Land. Nutzen Triftlfi ng – Ein Dorf die Wohn- und Lebens- Sie die Angebote des umfassenden Programms. im Wandel der Zeit 6 qualität im Regens bur- Ausstellung „Hand - ger Land aus. Wohn- Besuchen Sie den Informationstag im Landratsamt werk und Handel“ 7 Baugebiet im qualität heißt sich am Samstag, 26. September, bei dem Sie Fachleute Zeichen der Burg 8 zuhause fühlen. Dazu zu Fragen über Bauplätze, Baufi nanzierung, Bauför- „Tag des offenen Dorfes“ gehört eine gute In- derung und Energieoptimierung beraten oder ent- in Brennberg 10 frastruktur in allen decken Sie bei den Orts- und Landschaftsführungen Vom Kuhstall zur Lebensbereichen und die Besonderheiten im Regensburger Land. Zusam- Computerschmiede 11 soziale Kontakte, die men mit den beteiligten Gemeinden und Organi- Programm der unter anderem durch satoren möchte ich Sie herzlich zum Besuch der Regionaltage 12 – 17 ein breit gefächertes Regional tage einladen. -

Altwege Zwischen Abens, Donau Und Isar
Johann Auer Altwege zwischen Abens, Donau und Isar 2 Vorwort Die vorliegende Arbeit versucht auf der Basis von mehr als 20 Jahre andauernden, intensiven Begehungen des Gebietes zwischen Abens, Donau und Isar - wobei diese drei Flüsse keine strikte Grenze bilden - die Geschichte der Fernwege bzw. Straßen in diesem Raum zu schreiben. Nach einem kurzen Überblick über den Forschungsstand werden 21 Trassen mit vermutlich römerzeitlichem, zum Teil wohl noch älterem Ursprung vorgestellt. Anschließend sollen Aspekte zur Sprache kommen, die für die Anlage und den Verlauf der nachrömischen Fernwege bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts bestimmend gewesen sind, bevor die mittelalterlichen und neuzeitlichen Straßen und Straßenvarianten, besser definiert als Straßensysteme, detailliert beschrieben werden. Außer den Begehungen dienten Ergebnisse der Geschichts- und Namenforschung, alte Karten und Pläne aus der Zeit vor 1800, die sog. Liquidationspläne und Extraditionspläne aus dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, topographische Karten, die verfügbaren Archivalien und luftarchäologische Aufnahmen als Grundlage für die Anfertigung dieser Arbeit. Der Verfasser ist sich bewußt, daß ihm trotz aller Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit Fehler unterlaufen sein können, wofür er sich schon jetzt entschuldigt. Die fast ausschließlich in den Wäldern gelegenen Überreste der Altwege - Geleisbündel mit bis zu 40 einzelnen Fahrrinnen, Hohlwege bis zu einer Tiefe von 10 m und mehr, Hohlwegfächer, Dammstücke mit einer Höhe bis zum 2,5 m und einer Länge bis zu 1,8 km - werden allenthalben zugeschüttet und eingeebnet, besonders dort, wo sie auf ausgebauten Wegen leicht zu erreichen sind. Dadurch wird ein kulturelles Erbe vernichtet, daß genauso wertvoll und deshalb ebenso schützenswert ist wie alte Bauten und andere Bodendenkmäler. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist es mir ein echtes Bedürfnis, all den Personen zu danken, ohne deren Hilfe und Unterstützung die vorliegende Arbeit nicht in Druck gegangen wäre. -

TSV Alteglofsheim Alle Vereinsspiele in Der Übersicht Zeit: 22.08
TSV Alteglofsheim Alle Vereinsspiele in der Übersicht Zeit: 01.10.2021 - 21.11.2021 Seite 1 von 2 Stand: Montag, 27. September 2021 Spieltyp Spielklasse Datum Anstoß Spielpaarung Herren ME B Klasse 01.10.2021 18:30 TV Geisling II TSV Alteglofsheim II Sportgelände Geisling, Platz 1,Donauweg,93102 Pfatter ME Kreisklasse 03.10.2021 15:15 TSV Aufhausen TSV Alteglofsheim Sportgelände Aufhausen Platz 1,Seilerberg 34,93089 Aufhausen ME B Klasse 10.10.2021 13:00 TSV Alteglofsheim II SSV Brennberg II Alter Sportplatz Alteglofsheim,Jahnstr. 15,93087 Alteglofsheim ME Kreisklasse 10.10.2021 15:15 TSV Alteglofsheim SG Peising I / TSV Bad Abbach II Alter Sportplatz Alteglofsheim,Jahnstr. 15,93087 Alteglofsheim ME B Klasse 17.10.2021 13:00 TSV Alteglofsheim II SG FC Mötzing II/SV Sünching II Alter Sportplatz Alteglofsheim,Jahnstr. 15,93087 Alteglofsheim ME Kreisklasse 17.10.2021 15:15 TV Geisling TSV Alteglofsheim Sportgelände Geisling, Platz 1,Donauweg,93102 Pfatter ME B Klasse 24.10.2021 13:15 SG TSV Pettenreuth/DJK Altenthann II TSV Alteglofsheim II Sportgelände Altenthann Platz 2,Vorwaldstr.,93177 Altenthann ME Kreisklasse 24.10.2021 15:15 SV Moosham TSV Alteglofsheim Sportgelände Moosham, Platz 1,zwischen Moosham u Sengkofen,93098 Moosham ME B Klasse 29.10.2021 18:30 SV Sulzbach/Do. II TSV Alteglofsheim II Sportgelände Sulzbach/Do., Platz 1,Tulpenweg 26,93093 Donaustauf ME Kreisklasse 31.10.2021 14:15 TSV Alteglofsheim SV Pfatter Alter Sportplatz Alteglofsheim,Jahnstr. 15,93087 Alteglofsheim ME Kreisklasse 07.11.2021 14:00 FC Tegernheim II TSV Alteglofsheim Sportzentrum Tegernheim, Platz 1,Am Hohen Sand 10,93105 Tegernheim ME B Klasse 07.11.2021 SPIELFREI TSV Alteglofsheim II ME B Klasse 14.11.2021 12:00 TSV Alteglofsheim II FC Labertal II Alter Sportplatz Alteglofsheim,Jahnstr. -

Beratungslehrkräfte Für Grund- Und Mittelschulen in Der Oberpfalz
28.09.2021 Beratungslehrkräfte für Grund- und Mittelschulen in der Oberpfalz Name Titel Vorname DBZ Stammschule Zuständigkeit Telefon Amann- Manuela Lin Hans-Scholl-Grundschule Hans-Scholl-Grundschule 09471-604940 Viehbacher Burglengenfeld, Burglengenfeld Burglengenfeld, GS u. MS Maxhütte- 1 Haidhof Bayer Carina Lin Barbara-Grundschule Amberg, Amberg Barbara-Grundschule Amberg, Albert- 09621-104400 Schweitzer-Grundschule Amberg 2 Beck Christian L Grundschule an der Bräugasse GS Burggriesbach, GS/MS Berngau, GS 09181-254585 Neumarkt i.d.OPf, Neumarkt i.d.OPf. Sulzbürg Montessori-Schule 3 Berger Monika Lin Mittelschule Neutraubling, Mittelschule Regenstauf, Mittelschule 09401-92200 Neutraubling Laaber, Grundschule Laaber 4 Bergmann Marina Lin Max-Reger-Mittelschule Weiden Rehbühl-GS WEN, GS Bechtsrieth, GS 0961-391640 5 i.d.OPf., Weiden i.d.OPf. Luhe-Wildenau Biersack Christian L Krötensee-Mittelschule Sulzbach- Krötensee-Mittelschule Sulzbach- 09661-877690 Rosenberg, Sulzbach-Rosenberg Rosenberg, Grundschule Illschwang 6 Birgmann Bärbel Lin Dreifaltigkeits-Grundschule I Amberg, Pestalozzi-Grundschule Sulzbach- 09621-970336 Amberg Rosenberg, Jahn-Grundschule Sulzbach- 7 Rosenberg Birk Christian L Sophie-Scholl-Mittelschule MS Burglengenfeld 09471-604930 8 Burglengenfeld, Burglengenfeld Brandmüller Ingrid Lin Grundschule Hohes Kreuz Regensburg, Grundschule Burgweinting 0941-5071957 Regensburg Regensburg, Hermann-Zierer- 9 Grundschule Obertraubling 10 Bräundl Martina Lin Mittelschule Berching, Berching 0 Braunreuther- Sabine Lin Bischof Manfred -

Zuständigkeitsbereiche Der Beratungslehrkräfte Im Schuljahr 2019/20
Zuständigkeitsbereiche der Beratungslehrkräfte im Schuljahr 2019/20 Grundschulen in der Stadt Regensburg Zuständige Schule Erreichbar unter Beratungslehrkraft 0941/ 507-1957 GS Burgweinting Fr. Brandmüller (Grundschule Hohes Kreuz) 09406/ 2150 GS Gerhardinger Hr. Gilg (Grundschule Mintraching) 0941/ 507-1957 GS Hohes Kreuz Fr. Brandmüller (Grundschule Hohes Kreuz) 0941/ 507-4923 GS Keilberg Fr. Schmidt (Mittelschule Pestalozzi) 0941/ 507- 3930 GS Königswiesen Hr. Ederer (Grundschule Königswiesen) 09406/ 2150 GS Konradschule Hr. Gilg (Grundschule Mintraching) 09406/ 283000 (Grundschule GS Kreuzschule Fr. Stadler Köfering) 0941/ 507- 2092 GS Napoleonstein Fr. Seidl (Grundschule St. Wolfgang) 0941/ 507- 2046 GS Pestalozzi Fr. Kiefer (Grundschule ViTo) 0941/ 507- 3930 GS Prüfening Hr. Ederer (Grundschule Königswiesen) 0941/ 65528 GS Sallerner Berg Fr. Titz (Grundschule Zeitlarn) 09401/6609 GS Schwabelweis Fr. Zirngibl (Grundschule Obertraubling) 09401/1200 GS St. Nikola Fr. Wiesmann (Grundschule Barbing) 0941/ 507- 2046 GS ViTo Fr. Kiefer (Grundschule ViTo) 0941/ 507-1900 GS von-der-Tann Fr. Köppl (Mittelschule R Otto-Schwerdt) 0941/ 507- 2092 GS St. Wolfgang Fr. Seidl (Grundschule St. Wolfgang) 0941/ 296820 GS BiMaMü Fr. Braunreuther-Weinem (Grundschule BiMaMü) 0941/ 507- 1900 GS Montessori Fr. Köppl (Mittelschule Otto-Schwerdt) 09406/ 2150 GS Domspatzen Hr. Gilg (Grundschule Mintraching) 0941/ 507- 2092 GS SIS Fr. Seidl (Grundschule St. Wolfgang) 0941/507-4923 Freie Waldorfschule Fr. Schmidt (Mittelschule Pestalozzi) Mittelschulen in der StadtRegensburg Zuständige Schule Erreichbar unter Beratungslehrkraft 0941/ 507- 1932 MS Clermont-Ferrand Fr. Kriegbaum (Mittelschule Clermont-Ferrand) 09406/ 2150 MS Konrad Hr. Gilg (Grundschule Mintraching) 0941/ 507- 1900 MS Otto-Schwerdt Fr. Köppl (Mittelschule Otto-Schwerdt) 0941/ 507- 4923 MS Pestalozzi Fr. Schmidt (Mittelschule Pestalozzi) 0941/ 507- 2095 MS St. -

Bekanntmachung Der Zugelassenen Wahlvorschläge Für Die Wahl Des Kreistags Am 15.03.2020
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistags am 15.03.2020 Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Kreistags die folgenden Wahlvorschläge zugelassen: Ordnungs- Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) zahl 01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 02 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 03 FREIE WÄHLER 04 Alternative für Deutschland (AfD) 05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 06 Freie Demokratische Partei (FDP) 07 Ökologisch-Demokratische Partei / Parteifreie Umweltschützer (ÖDP/PU) 08 DIE LINKE Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der nach- folgend abgedruckten Anlage. Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen. Anlage zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistags am 15.03.2020 Für die Wahl des Kreistags wurden beim Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen: Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der Geburt 101 Mißlbeck, Rainer, Geschäftsführer, Gemeinderat, Roith, Wenzenbach 1971 102 Stierstorfer, Sylvia, Landtagsabgeordnete, Kreisrätin, Gemeinderätin, Pfatter 1963 103 Aumer, Peter, Dipl.-Betriebswirt (FH), Bundestagsabgeordneter, Kreisrat, Ramspau, 1976 Regenstauf 104 Kerscher, Elisabeth, 1.Bürgermeisterin, Kreisrätin, Wiesent 1968 105 Kiendl, Christian, 1.Bürgermeister, Kreisrat, Schierling 1968 106 Dr. Baumer, Daniela, Gymnasiallehrerin, Kreisrätin, Deuerling 1974 107 Hoheisel, Florian, Industriemeister, Undorf, Nittendorf 1988 108 Blümel, Rita, Bäuerin, Kreisrätin, Markträtin, Schierling 1961 109 Gabler, Thomas, B.A., Geschäftsführer, Kreisrat, Stadtrat, Hohenschambach, Hemau 1972 110 Willamowski, Bettina, M.A., Kfm. Geschäftsführerin, Gemeinderätin, Pielenhofen 1976 111 Thiel, Johann, 1.Bürgermeister, Kreisrat, Illkofen, Barbing 1957 112 Dr. -

Nummer 39/13 25 September 2013 Nummer 39/13 1 25 September 2013
Nummer 39/13 25 september 2013 Nummer 39/13 1 25 september 2013 Inleiding Introduction Hoofdblad Patent Bulletin Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de The Patent Bulletin appears on the 3rd working derde werkdag van een week. Indien NL day of each week. If the Netherlands Patent Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de Office is closed to the public on the above verschijningsdag van het blad verschoven naar de mentioned day, the date of issue of the Bulletin is eerstvolgende werkdag, waarop NL Octrooicentrum is the first working day thereafter, on which the geopend. Het blad verschijnt alleen in electronische Office is open. Each issue of the Bulletin consists vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14 of 14 headings. rubrieken. Bijblad Official Journal Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, Appears four times a year (January, April, July, oktober) in electronische vorm via de website van NL October) in electronic form on the website of the Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële Netherlands Patent Office. The Official Journal mededelingen en andere wetenswaardigheden contains announcements and other things worth waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken knowing for the benefit of the Netherlands Patent hebben. Office and its customers. Abonnementsprijzen per (kalender)jaar: Subscription rates per calendar year: Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in Patent Bulletin and Official Journal: free of electronische vorm op de website van NL charge in electronic form on the website of the Octrooicentrum. -
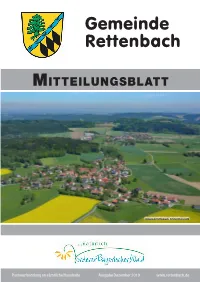
Mitteilungsblatt
Gemeinde Rettenbach MITTEILUNGSBLATT Gemeinde Rettenbach, Ortsteil Ebersroith Postwurfsendung an sämtliche Haushalte Ausgabe Dezember 2019 www.rettenbach.de Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenbach Aus dem Rathaus Gemeinde Rettenbach Öffnungszeiten im Rathaus Rettenbach Alois Hamperl Montag: 14.00-18.00 Uhr 1. Bürgermeister Mittwoch: 08.00-12.00 Uhr Schulstraße 2 Öffnungszeiten Wertstoffhof Rettenbach, Langauer Straße 11 93191 Rettenbach Di 16.00-19.00 Uhr Fr 14.00-18.00 Uhr Tel. 09462/910026 Fax 09462/910027 Die Sammelstelle in Ebersroith, Am Anger, ist ganzjährig für die [email protected] Anlieferung von holzigen Gartenabfällen und Grüngut geöffnet. (Wurzelstöcke dürfen nicht angeliefert werden.) www.rettenbach.de Beim Sportplatz in Rettenbach, Langauer Straße, steht ganzjährig ein Container nur für Grüngut bereit. Öffnungszeiten VG Falkenstein (Tel.: 0 94 62 /94 22-0): Montag – Freitag 08.00-12.00 Uhr Montag + Dienstag 14.00-16.00 Uhr Donnerstag 14.00-18.00 Uhr Öffnungszeiten Wertstoffhof Falkenstein, Rodinger Str. 27 Mi 09.00-12.00 Uhr Fr 13.00-17.00 Uhr Sa 09.00-12.00 Uhr Erreichbarkeit des 1. Bürgermeisters Der 1. Bürgermeister der Gemeinde Rettenbach, Herr Alois Hamperl, ist während der Amts- stunden in Rettenbach unter der Tel.-Nr. 09462/910026 oder auch über die Verwaltungs- gemeinschaft Falkenstein unter der Tel.-Nr. 09462/9422-0 erreichbar. In dringenden Fällen steht Ihnen Herr Hamperl unter der Handy-Nr. 0171/7308945 zur Verfügung. Termine können auch bei der Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein unter der Tel.-Nr. 09462/9422-30 vereinbart werden. Impressum EINRICHTUNGEN IN DER GEMEINDE Mitteilungsblatt Gemeinde Rettenbach Grundschule Kinderhaus + Kita Ausgabe Dezember 2019 Tel.: 09462/498 09462/668 Herausgeber Fax: 09462/5664 09462/942188 Gemeinde Rettenbach eMail: vs-rettenbach.sekretariat@ [email protected] t-online.de V.i.S.d.P.