Österreich in Der Zweiten Republik
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Program November 2020
View this email in your browser PROGRAM NOVEMBER 2020 Exhibition - outdoors PHOTO IS:RAEL (9.-21.11.2020, Tel Aviv) --> Stefanie Moshammer: I'll Remember to Forget Loving Art. Making Art. (12.-14.11.2020, Tel Aviv) --> Michael Kienzer: hanging around Film - digital format TLV Fest (12.-21.11.2020) --> Sangam Sharma: Another Europe --> Monja Art: Seventeen --> Gregor Schmidinger: Nevrland --> Stefan Langthaler: Fabiu Lectures & Discussion - digital format The Kelsen Legacy: Reflections upon the Centennial to the Austrian Constitution (11.11.2020) --> Prof. Clemens Jabloner, Former Vice-Chancellor of Austria, Professor for Legal Theory at the Univerity of Vienna and Director of the Hans Kelsen Institute --> Karoline Edtstadler, Austrian Federal Minister for the EU and Constitution at the Federal Chancellery When Peace Still Seemed Possible: 25th Yitzhak Rabin Memorial Day (4.11.2020) --> Maria Sterkl, correspondent of the Austrian daily Der Standard EXHIBITION OUTDOORS PHOTO IS:RAEL feat. Stefanie Moshammer (9.-21.11.2020; Tel Aviv) Ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender Tel Avivs ist das im Herbst stattfindende Fotografiefestival PHOTO IS:RAEL. Das Festival steht dieses Jahr unter dem Motto "Transformationen" und beschreitet neue Wege. Die Ausstellungen finden im öffentlichen Raum im Freien statt und werden von einem reichhaltigen digitalen Programm begleitet. Das Festival ist erstmals als Wanderausstellung konzipiert; die Ausstellungen werden bis ins Jahr 2021 noch an weiteren Orten in Israel zu sehen sein. Aus Österreich ist die aufstrebende Foto- Künstlerin Stefanie Moshammer mit der Ausstellung I'll Remember to Forget vertreten. The photography festival PHOTO IS:RAEL, is a regular highlight on Tel Aviv's event calendar. The festival runs under the theme "transformations" and is breaking new ground. -
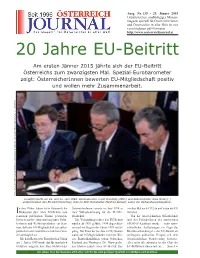
20 Jahre EU-Beitritt
Ausg. Nr. 139 • 29. Jänner 2015 Unparteiisches, unabhängiges Monats- magazin speziell für Österreicherinnen und Österreicher in aller Welt in vier verschiedenen pdf-Formaten http://www.oesterreichjournal.at 20 Jahre EU-Beitritt Am ersten Jänner 2015 jährte sich der EU-Beitritt Österreichs zum zwanzigsten Mal. Spezial-Eurobarometer zeigt: ÖsterreicherInnen bewerten EU-Mitgliedschaft positiv und wollen mehr Zusammenarbeit. Foto: Aus der ORF-Dokumentation »Menschen & Mächte. Der lange Weg nach Europa.« / metafilm EU-Gipfel Korfu am 24. und 25. Juni 1994: Bundeskanzler Franz Vranitzky (Mitte) und Außenminister Alois Mock (r.) unterschreiben den EU-Beitrittsvertrag; links im Bild: Botschafter Manfred Scheich, Leiter der Verhandlungsdelegation. n den 1980er Jahren ist in Österreich die ÖsterreicherInnen votierte im Juni 1994 in zweiten Mal nach 1972 ab und traten der EU IDiskussion über einen EG-Beitritt zum einer Volksabstimmung für die EU-Mit- nicht bei. zentralen politischen Thema geworden. gliedschaft. Von der österreichischen Öffentlichkeit Davor herrschte jahrzehntelang unter Politi- Die Verhandlungen über den EU-Beitritt und den PolitikerInnen der amtierenden kerInnen und RechtsexpertInnen ein Kon- wurden ab 1993 geführt, 1994 abgeschlos- SPÖ/ÖVP-Koalition wurde – trotz unter- sens, daß eine EG-Mitgliedschaft aus außen- sen und mit Beginn des Jahres 1995 rechts- schiedlicher Auffassungen im Zuge der politischen und neutralitätsrechtlichen Grün- gültig. Der Kreis der bis dato 12 EU-Staaten Beitrittsverhandlungen – der EU-Beitritt als den unmöglich sei. wurde auf 15 Mitgliedsländer erweitert. Wei- wichtigstes politisches Ereignis seit dem Mit dem Beitritt zur Europäischen Union tere Beitrittskandidaten waren Schweden, österreichischen Staatsvertrag bewertet. am 1. Jänner 1995 wurde das für unmöglich Finnland und Norwegen. Die NorwegerIn- Aber nicht alle stimmten in den Chor der Gehaltene möglich. -

CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18
The Schüssel Era in Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18 innsbruck university press Copyright ©2010 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, ED 210, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Published and distributed in the United States by Published and distributed in Europe by University of New Orleans Press: Innsbruck University Press: ISBN 978-1-60801-009-7 ISBN 978-3-902719-29-4 Library of Congress Control Number: 2009936824 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Assistant Editor Ellen Palli Jennifer Shimek Michael Maier Universität Innsbruck Loyola University, New Orleans UNO/Vienna Executive Editors Franz Mathis, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität -

Austria 2019 International Religious Freedom Report
AUSTRIA 2019 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT Executive Summary Historical and modern constitutional documents provide for freedom of religious belief and affiliation and prohibit religious discrimination. The law bans public incitement to hostile acts against religious groups and classifies registered religious groups into one of three categories: religious societies, religious confessional communities, and associations. The 16 groups recognized as religious societies receive the most benefits. Unrecognized groups may practice their religion privately if the practice is lawful and does not offend “common decency.” In May parliament banned head coverings for children in elementary schools. Authorities arrested a Christian couple for murder after they refused, for religious reasons, medical treatment for their sick child, who subsequently died. Scientologists and the Family Federation for World Peace and Unification (Unification Church) said government-funded organizations continued to advise the public against associating with them. Muslim and Jewish groups and nongovernmental organizations (NGOs) expressed concerns over what they said were the frequent and growing number of anti-Semitic and anti-Muslim acts by members of the Freedom Party (FPOe), the junior partner in the coalition government until May. According to the interior ministry, there were 49 anti-Semitic and 22 anti-Muslim incidents reported to police in 2018, the most recent year for which data were available, compared with 39 and 36 incidents, respectively, in 2017. Most incidents involved hate speech. The Islamic Faith Community (IGGIO) and the Jewish Community (IKG) have in the past reported a much higher number of incidents against their members than the interior ministry, but neither group had updated figures beyond the 540 anti-Muslim incidents the IGGIO cited in 2018 and the 503 anti-Semitic incidents the IKG reported in 2017. -

The Marshall Plan in Austria 69
CAS XXV CONTEMPORARY AUSTRIANAUSTRIAN STUDIES STUDIES | VOLUME VOLUME 25 25 This volume celebrates the study of Austria in the twentieth century by historians, political scientists and social scientists produced in the previous twenty-four volumes of Contemporary Austrian Studies. One contributor from each of the previous volumes has been asked to update the state of scholarship in the field addressed in the respective volume. The title “Austrian Studies Today,” then, attempts to reflect the state of the art of historical and social science related Bischof, Karlhofer (Eds.) • Austrian Studies Today studies of Austria over the past century, without claiming to be comprehensive. The volume thus covers many important themes of Austrian contemporary history and politics since the collapse of the Habsburg Monarchy in 1918—from World War I and its legacies, to the rise of authoritarian regimes in the 1930s and 1940s, to the reconstruction of republican Austria after World War II, the years of Grand Coalition governments and the Kreisky era, all the way to Austria joining the European Union in 1995 and its impact on Austria’s international status and domestic politics. EUROPE USA Austrian Studies Studies Today Today GünterGünter Bischof,Bischof, Ferdinand Ferdinand Karlhofer Karlhofer (Eds.) (Eds.) UNO UNO PRESS innsbruck university press UNO PRESS UNO PRESS innsbruck university press Austrian Studies Today Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 25 UNO PRESS innsbruck university press Copyright © 2016 by University of New Orleans Press All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage nd retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. -
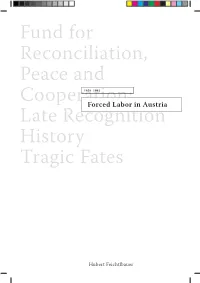
Forced Labor in Austria Late Recognition History Tragic Fates
Fund for Reconciliation, Peace and 19381945 Cooperation:Forced Labor in Austria Late Recognition History Tragic Fates Hubert Feichtlbauer Imprint Austrian Reconciliation Fund (Publisher) Hubert Feichtlbauer (Author) Scientific Advisor Univ. Doz. Florian Freund German Edition: ISBN: 3-901116-21-4 English Edition: ISBN: 3-901116-22-2 Published in German, English, Polish and Russian Printed by Rema Print, Neulerchenfelder Straße 35, A-1160 Vienna, on 100% chlorine-free bleached paper The book, the title, the cover design and all symbols and illustrations used are protected by copyright. All rights reserved, in particular with regard to the translation, reproduction, extraction of photomechanical or similar material and storage in data processing media either in full or in part. Despite careful research, no responsibility is accepted for the correctness of the information contained in this book. In order to ensure the readability of the texts and lists, gender-specific formulations were frequently dispensed with. Quotes from individuals and legal documents were translated solely for the purposes of this publication. No liability is accepted for translation, typesetting and printing errors. www.reconciliationfund.at © 2005 2 Schopenhauerstraße 36, A-1180 Vienna www.braintrust.at Contents 1. ›Preface‹ 5 Wolfgang Schüssel, Maria Schaumayer, Ludwig Steiner, Richard Wotava; About This Book 2. ›Guilt and Atonement‹ 17 3. ›Racism and Exploitation‹ 41 4. ›Every Case a Tragic Fate‹ 71 5. ›Why Such a Late Issue?‹ 127 6. ›The State and the Business Community -
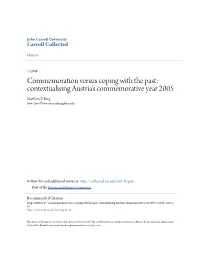
Contextualising Austria's Commemorative Year 2005 Matthew .P Berg John Carroll University, [email protected]
John Carroll University Carroll Collected History 1-2008 Commemoration versus coping with the past: contextualising Austria's commemorative year 2005 Matthew .P Berg John Carroll University, [email protected] Follow this and additional works at: http://collected.jcu.edu/hist-facpub Part of the European History Commons Recommended Citation Berg, Matthew P., "Commemoration versus coping with the past: contextualising Austria's commemorative year 2005" (2008). History. 19. http://collected.jcu.edu/hist-facpub/19 This Article is brought to you for free and open access by Carroll Collected. It has been accepted for inclusion in History by an authorized administrator of Carroll Collected. For more information, please contact [email protected]. Commemoration versus Vergangenheitsbewältigung: Contextualizing Austria’s Gedenkjahr 2005* Abstract This essay explores the politics of memory in post-1945 Austrian political culture, focusing on the shift between the fiftieth anniversary of the Anschluss and the sixtieth anniversary of the end of the Second World War. Postwar Austrian society experienced a particular tension associated with the Nazi past, manifested in communicative and cultural forms of memory. On the one hand, the support of many for the Third Reich—expressed through active or passive complicity—threatened to link Austria with the perpetrator status reserved for German society. On the other, the Allies’ Moscow Declaration (1943) created a myth of victimization by Germany that allowed Austrians to avoid confronting difficult questions concerning the Nazi era. Consequently, discussion of Austrian involvement in National Socialism became a taboo subject during the initial decades of the Second Republic. The 2005 commemoration is notable insofar as it marked a significant break with this taboo. -

The Schüssel Era in Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.)
The Schüssel Era in Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18 innsbruck university press Copyright ©2010 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, ED 210, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Published and distributed in the United States by Published and distributed in Europe by University of New Orleans Press: Innsbruck University Press: ISBN 978-1-60801-009-7 ISBN 978-3-902719-29-4 Library of Congress Control Number: 2009936824 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Assistant Editor Ellen Palli Jennifer Shimek Michael Maier Universität Innsbruck Loyola University, New Orleans UNO/Vienna Executive Editors Franz Mathis, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität -

Abhängigkeit Der Richter Unter Der Austrofaschistischen Und Nationalsozialistischen Herrschaft
BRGÖ 2016 Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs Ilse REITER-ZATLOUKAL, WIEN Die (Un)Abhängigkeit der Richter unter der austrofaschistischen und nationalsozialistischen Herrschaft The (In)Dependence of Judges Under Austrofascist and National Socialist Rule Following the dissolution of parliament in Austria in March 1933, the Dollfuß government massively stripped back the rule of law. Government decrees were used first to limit the independence of the judges and, ultimately, to make it obsolete. In this article, these government measures will be examined within the context of party political power relations in Austria and the constitutional framework of their implementation, as well as in reference to discussions in the council of ministers. Furthermore, for the first time, the actual sanctions against individual judges will be documented in order to illustrate the effects of this government policy in practice. Finally, the claim of a 'national state of emergency', used to justify these measures, will be placed in relation to contemporary discussions of 'na- tional emergency law'. The final chapter will then sketch the conceptual reformulation of judicial independence within National Socialist ideology and demonstrate the formal ending of traditional guarantees of unremovability and non-transferability of professional judges in the 'Third Reich' and consequently, in the wake of the 'Annexa- tion' in 1938, in Austria as well. Keywords: Dollfuß government – independance of judge –National Socialism – state of emergency Nach der Ausschaltung des Parlaments in Ös- Regierungspolitik in der Praxis zu illustrieren. terreich im März 1933 wurden mittels Regie- Schließlich wird der zur Rechtfertigung dieser rungsverordnungen sukzessive „Säulen, die das Maßnahmen behauptete „Staatsnotstand“ in Be- Gebäude des Rechtsstaates getragen hatten, zug zu den zeitgenössischen Diskussionen um umgelegt“,1 darunter die 1934 zunächst zurück- das „Staatsnotrecht“ gesetzt. -
„ORF-Tvthek Goes School“ Videoarchiv: Best of „Zib 2“
ORF. WIE WIR. Videoarchive zu zeit- und kulturhistorischen Themen für den Unterricht „ORF-TVthek goes school“ Videoarchiv: Best of „ZiB 2“-Interviews Die „ZiB 2“ gehört zu den erfolgreichsten Nachrichtensendungen des ORF. Vor allem diverse Studiogespräche haben der Sendung in den vergangenen Jahren ein einzigartiges Profil gegeben. Im „ZiB 2“-TVthek-Archiv wird ein Best-of davon jederzeit online abrufbar sein. Die Inhalte des Videoarchivs im Detail: Titel und kurze inhaltliche Beschreibung Moderator Dauer in Min. Sendedatum Innenpolitik Kurt Waldheim bei Rudolf Nagiller Rudolf Nagiller 07'32“ 25.03.1986 Kurt Waldheim, damals Kandidat zum Amt des Bundespräsidenten, nahm zu den Vorwürfen, die im Zusammenhang mit seiner Kriegsvergangenheit aufgekommen waren, Stellung. Machtkampf zwischen Haider und Steger Robert Hochner 07'46“ 21.05.1986 Jörg Haider, damals 36 Jahre alt und Landesparteiobmann der FPÖ Kärnten, in einem Interview mit Robert Hochner, wenige Monate bevor er Norbert Steger als Vorsitzender der FPÖ ablöste. Alois Mock zur Bedeutung des Staatsvertrags Thomas Fuhrmann 06'08“ 06.11.1990 Alois Mock, damals Außen- und Verteidigungsminister (ÖVP), im Gespräch mit Thomas Fuhrmann über die Bedeutung des Staatsvertrags im Rahmen der europäischen Nachkriegsordnung. Zernatto-Kritik an Haider Robert Hochner 05‘07“ 13.06.1991 Die Aussage von Jörg Haider zur "ordentlichen Beschäftigungspolitik im Dritten Reich" empörte 1991 das Land. Der damalige Koalitionspartner, ÖVP-Kärnten-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Christof Zernatto, kritisierte Haider ebenfalls scharf. 2 Portisch zur Rolle Österreichs im Zweiten Weltkrieg Robert Hochner 11‘03“ 19.06.1991 Hugo Portisch, Journalistenlegende und moralische Instanz des Landes, analysierte 1991 im "ZIB 2"-Interview mit Robert Hochner die Rolle Österreichs im Zweiten Weltkrieg und stellte erstmals die Opferrolle der Österreicher in Frage. -

Bundeskanzler Und Vizekanzler Der Zweiten Republik
ASB5GS4EGK Mag. Christian Schreiberhuber 5.2 Regierungskoalitionen der 2. Republik / Who is who? Bundeskanzler und Vizekanzler der Zweiten Republik 1945 Provisorische Staatsregierung: 3 Parteien-Koalition SPÖ/ÖVP/KPÖ Staatskanzler Karl Renner 1945-1947 3 Parteien-Koalition ÖVP/SPÖ/KPÖ Bundeskanzler Vizekanzler Leopold Figl Adolf Schärf 1947-1966 Große Koalition ÖVP/SPÖ Bundeskanzler Vizekanzler Leopold Figl Adolf Schärf (bis 1953) (bis 1957) Bundeskanzler Vizekanzler Julius Raab Bruno Pittermann (1953-1961) (1957-1966) Seite 113 ASB5GS4EGK Mag. Christian Schreiberhuber Bundeskanzler Alfons Gorbach (1961-1964) Bundeskanzler Josef Klaus (ab 1964) 1966-1970 ÖVP-Alleinregierung Bundeskanzler Vizekanzler Josef Klaus Fritz Bock (1966-1968) Vizekanzler Hermann Withalm (1968-1970) 1970-1983 SPÖ-Alleinregierung Bundeskanzler Vizekanzler Bruno Kreisky Rudolf Häuser (1970-1976) Seite 114 ASB5GS4EGK Mag. Christian Schreiberhuber Vizekanzler Hannes Androsch (1976-1981) Vizekanzler Fred Sinowatz (1981-1983) 1983-1987 Kleine Koalition SPÖ/FPÖ Bundeskanzler Vizekanzler Fred Sinowatz (bis 1986) Norbert Steger Bundeskanzler Franz Vranitzky (1986-1987) 1987-2000 Große Koalition SPÖ/ÖVP Bundeskanzler Vizekanzler Franz Vranitzky Alois Mock (bis 1997) (bis 1989) Seite 115 ASB5GS4EGK Mag. Christian Schreiberhuber Vizekanzler Josef Riegler (1989-1991) Vizekanzler Erhard Busek (1991-1995) Bundeskanzler Viktor Klima Vizekanzler (1997-2000) Wolfgang Schüssel (1995-2000) 2000-2003 Kleine Koalition ÖVP/FPÖ Bundeskanzler Vizekanzlerin Wolfgang Schüssel Susanne Riess-Passer -

175Years USA-Austria.Pdf
175 Years U.S.-Austrian Diplomatic Relations Published by the U.S. Embassy Vienna, Austria 2 3 The Federal President Der Bundespräsident of the Republic of Austria Dr. Heinz Fischer Heinz Fischer lch freue mich, dass wir im heurigen Jahr 175 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen I am delighted that this year we are able to celebrate 175 years of U.S.-Austrian diplomatic Österreich und den USA feiern können. Die USA standen zwei Mal an der Wiege der Republik relations. The United States stood at the cradle of the Austrian Republic twice: for the first Österreich: zuerst nach dem 1. Weltkrieg und danach – und ungleich erfolgreicher – 1945. time following World War One, and again in 1945 – this time with considerably more success. Für den amerikanischen Anteil an der Befreiung Österreichs von der Hitler-Diktatur sind wir We are grateful to the United States both for its share in liberating Austria from Adolf Hitler’s ebenso dankbar wie für den signifikanten Beitrag der USA zum Wiederaufbau in Form des dictatorship, and for the significant contribution the United States has made towards rebuilding Marshallplans. Die USA waren aber auch ein wichtiger Zufluchtsort für in Österreich nach 1938 Austria by way of Marshall Plan aid. The United States also served as an important safe haven verfolgte Juden. for Austrian Jews who fled the country following persecutions starting in 1938. Heute können wir mit Befriedigung feststellen, dass unsere bilateralen Beziehungen Today we observe with satisfaction that our bilateral relations are truly excellent. Although once ausgezeichnet sind. Gelegentliche Meinungsverschiedenheiten gibt es auch unter den besten in a while, even best friends disagree.