Bebauungsplan "Kirchweg-Nord", 5
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
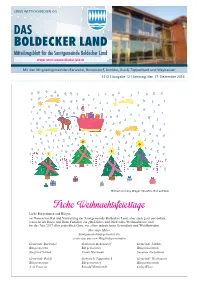
Frohe Weihnachtsfeiertage
LINUS WITTICH MEDIEN KG DAS BOLDECKER LAND Mitteilungsblatt für die Samtgemeinde Boldecker Land ePaper unter: www.boldecker-land.de Mit den Mitgliedsgemeinden Barwedel, Bokensdorf, Jembke, Osloß, Tappenbeck und Weyhausen 5312 | Ausgabe 12 | Samstag, den 17. Dezember 2016 Gemalt von Leny Dreger (10 Jahre, Hort Jembke) Frohe Weihnachtsfeiertage Liebe Bürgerinnen und Bürger, im Namen von Rat und Verwaltung der Samtgemeinde Boldecker Land, aber auch ganz persönlich, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein glückliches und friedvolles Weihnachtsfest und für das Jahr 2017 alles erdenklich Gute, vor allem jedoch beste Gesundheit und Wohlbefi nden. Ihre Anja Meier Samtgemeindebürgermeisterin sowie aus unseren Mitgliedsgemeinden Gemeinde Barwedel Gemeinde Bokensdorf Gemeinde Jembke Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeisterin Siegfried Schink Frank Niermann Susanne Ziegenbein Gemeinde Osloß Gemeinde Tappenbeck Gemeinde Weyhausen Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeisterin Axel Passeier Ronald Mittelstädt Gaby Klose Boldecker Land – 2 – Nr. 12/2016 Aus der Samtgemeinde ❱〉 28 Hort-Kinder malten um die Wette: Erste Weihnachtsbilder-Ausstellung im Rathaus des Boldecker Landes Das Thema war „Weihnachten“ - und der Kreati- vität waren keine Grenzen gesetzt. 28 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren in den Kinderhorten Jembke und Weyhausen griffen begeistert zu bunten Stiften und malten um die Wette, was ihnen dazu einfi el. Weih- nachtsbäume, Schlitten, Rentiere, Zuckerstan- gen, Geschenke und natürlich immer wieder den Weihnachtsmann. Zwei -

Klaus Moritz Präsentiert Seine Werke Im Rathaus
Verlag + Druck Linus Wittich KG Ausgabe 08 I Samstag, den 18. August 2012 online lesen: www.wittich.de Klaus Moritz präsentiert seine Werke im Rathaus Farbenfroh geht es jetzt im Samtgemeinderathaus des Boldecker Landes zu. Denn „Faszination Farbe“ lautet der Titel der Ausstellung des Weyhäuser Künstlers Klaus Moritz. Dieser präsentiert dort bis Mitte Oktober 25 seiner Werke der Öffentlichkeit. Zur Vernissage eingeladen hatte der Arbeitskreis Kunst und Kultur im Rathaus. Unter den Bildern ist auch ein Porträt des amerikanischen Entertainers Frank Sinatra, der seinen berühmtesten Titel „My Way“ singt. „Und My Way steht auch für mein künst- lerisches Schaffen“, sagte Klaus Moritz. Er ist auf kein Motiv, keine Farben und keinen Stil festgelegt. „In tristen Tagen kann Farbe Freude in den grauen Alltag bringen. Und das versuche ich mit den Mitteln eines Hobbymalers“, erklärte der Künstler. Und so fi nden sich im Weyhäuser Rathaus Bilder von Menschen, von Blumen, Gebäu- den, Stimmungen und Strukturen, gemalt in Acryl und Farbe. Geprägt ist des Künstlers Schaffen von den Werken des deutschen Malers Gerhard Richter. Seine Werke sollen die Fantasie des Betrachters anregen. Sie sind sowohl abstrakt als auch realistisch. Und vor allem sind sie eines: vielfältig. Klaus Moritz ist im Boldecker Land kein Unbekannter. Bereits 2009 stellte er seine Bil- der im Samtgemeinderathaus aus. Die jetzige Ausstellung ist bis Freitag, 19. Oktober, jeweils zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Quelle: Aller-Zeitung Boldecker Land – 2 – Nr. 08/2012 - Anzeige - Sitzungen der Ausschüsse und des Rates Im Sitzungssaal des Rathauses der Samtgemeinde in Weyhau- sen, Eichenweg 1, fi nden in der nächsten Zeit die nachfolgend aufgeführten Sitzungen der Ausschüsse und des Rates der Samt- gemeinde Boldecker Land statt. -

Informationsgespräch Dorfentwicklung Ribbesbüttel-Rötgesbüttel 21
Informationsgespräch Dorfentwicklung Ribbesbüttel-Rötgesbüttel 21. März 2019, Ribbesbüttel Quellen: waz-online.de, german-golf-guide.de; kanada-haus.com; allerhoheit.de ILE-Region Südkreis Gifhorn • Gem. Sassenburg • SG Boldecker Land • SG Isenbüttel • SG Papenteich • Ortsteile der Stadt Gifhorn: ‒ Gamsen ‒ Kästorf ‒ Neubokel ‒ Wilsche ‒ Winkel Dorfregionen im Südkreis Gifhorn Dorfregion DAS - Didderse, Adenbüttel, Schwülper mit den OT Adenbüttel, Rolfsbüttel, Didderse, Groß Schwülper, Klein Schwülper, Stüde- Grußendorf- Lagesbüttel, Rothemühle und Bokensdorf Walle Dorfregion Bokensdorf – Grußendorf – Stüde Dorfregion Ribbesbüttel- Rötgesbüttel Ribbesbüttel- mit den OT Ausbüttel, Rötgesbüttel Druffelbeck, Ribbesbüttel, Vollbüttel, Klein Vollbüttel, Didderse- Adenbüttel- Warmbüttel, Rötgesbüttel Schwülper Der Weg zur Dorfentwicklung 2. Planungsphase : Erarbeitung eines Dorfentwicklungsplans Dez. 2018 3. Förderphase : 1. Aufnahmephase: Umsetzung von privaten und Antrag auf Dorfentwicklung öffentlichen Maßnahmen 4 Der Weg zur Dorfentwicklung Schritt 1 : Aufnahme ins Dorfentwicklungsprogramm • Erhalt des offiziellen Bewilligungsbescheid über die „Aufnahme neuer Dörfer ins P DE-Programm“ vom ArL • Einreichen eines Förderantrags zur „Erstellung eines Dorfentwicklungsplans“ P Der Weg zur Dorfentwicklung Schritt 2 : Erstellung des Dorfentwicklungsplans • Ausschreibung und nach Erhalt der Vergabe an ein Planungsbüros Bewilligung • Erstellung des Dorfentwicklungsplans ca. 12 Monate mit Beteiligungsprozess ab Vergabe • Genehmigung des Plans durch -

Wir Sind in Ihrer Nähe
Verlag + Druck Linus Wittich KG Mitteilungsblatt für die Samtgemeinde Boldecker Land Mit den Mitgliedsgemeinden Barwedel, Bokensdorf, Jembke, Osloß, Tappenbeck und Weyhausen Verlag + Druck Linus Wittich KG online lesen: www.wittich.de Ausgabe 330 | Samstag, den 19. März 2011 Große Kunst aus kleinen Händen Am Mittwoch, den 23.02.2011 eröffnete die Kunstausstellung „Große Kunst aus kleinen Händen“ im Rathaus der Samtgemeinde Boldecker Land. An den Wänden hängen schöne bunte Malereien, Skulpturen und Plastiken aller Art, die von den Kindern aus den Kindertagesstätten der Samtgemeinde erstellt wurden. Samtge- meindebürgermeister Lothar Leusmann sagte dazu: „Allen Betei- ligten gebühre Dank – Zuerst den Kindern, aber auch den Erzie- herinnen und dem Arbeitskreis Kultur. Es ist eine einmalige, sehr sehenswerte Ausstellung, an der die Menschen ihre Freude haben werden.“ Ein Kunstwerk wurde sogar von allen Kindergärten und Kunst aus dem Karton der Krippe zusammen erstellt, indem es von einem zum anderen Kindergarten weitergereicht wurde. Auch schön anzusehen ist die „Kunst aus dem Karton“ des Kindergartens Weyhausen. Hier wurde z.B. ein Café nachgebastelt. Ingrid Rollinger, die Leiterin des Kindergartens Osloß, fügte hinzu: „Kinderkunst ist ein Erle- ben der anderen Art. Sie ist sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder.“ Bis zum 13. Mai 2011 können Interessierte und Ideensu- v.L. Herr Fließwasser, Herr Vernunft und Frau Friebe an dem chende die tollen Kunstwerke der Kinder zu den Öffnungszeiten Kunstwerk voN alleN Kindergärten. des Rathauses der Samtgemeinde Boldecker Land bewundern. WIR SIND IN IHRER NÄHE Filiale Jembke Hoitlinger Straße 2 ATel. 05366/96140 Filiale Weyhausen Elsternweg 10 Tel. 05362/936 68-0 www.spk-gifhorn-wolfsburg.de Boldecker Land - 2 - Nr. -

Official Journal L 273 Volume 29
ISSN 0378-6978 Official Journal L 273 Volume 29 of the European Communities 24 September 1986 English edition Legislation Contents I Acts whose publication is obligatory II Acts whose publication is not obligatory Council 86 / 465 / EEC : Council Directive of 14 July 1986 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( Germany ) 1 86 / 466 / EEC : Council Directive of 14 July 1986 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 /268 / EEC ( Spain ) 104 86 / 467 / EEC : Council Directive of 14 July 1986 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( Portugal ) 173 Price : £ 9,20 / £Irl 10,50 Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters , and are generally valid for a limited period . The titles of all other Acts are printed in bold type and preceded by an asterisk . 24 . 9 . 86 Official Journal of the European Communities No L 273 / 1 II (Acts whose publication is not obligatory) COUNCIL COUNCIL DIRECTIVE of 14 July 1986 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( Germany ) ( 86 / 465 / EEC ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , basis of a new definition of criteria for delimiting less-favoured areas and of a transfer of areas previously Having regard to the Treaty establishing the European classified under Article 3 ( 5 ) of the -

Und Bauverwaltungsamt\Presse
LINUS WITTICH MEDIEN KG DAS BOLDECKER LAND Mitteilungsblatt für die Samtgemeinde Boldecker Land ePaper unter: www.boldecker-land.de Mit den Mitgliedsgemeinden Barwedel, Bokensdorf, Jembke, Osloß, Tappenbeck und Weyhausen 5312 | Ausgabe 03 | Samstag, den 18. März 2017 © Heike / pixelio.de Einen schönen Frühlingsanfang, frohe Ostern & entspannte Feiertage wünscht Ihnen Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Boldecker Land - Anzeige - Verstehenist einfach. Wenn man einen Finanzpartner ganz in der Nähe hat, der die Region und ihreMenschen gut kennt. Filiale Jembke Filiale Weyhausen Hoitlinger Straße 2a Elsternweg 10 Telefon 05366 9614-0 Telefon 05362 93668-0 spk-gifhorn-wolfsburg.de Boldecker Land – 2 –Nr. 03/2017 ❱❭ Aus der Samtgemeinde Termine zu Ostern Barwedel 15. April 9:00 - 13:00 Uhr Osterfeuerholz anliefern (Brennplatz Dannebusch) 15. April ab 19:00 Uhr Osterfeuer abbrennen Bokensdorf 8. April ab 9:00 Uhr Holzsammeln fürs Osterfeuer und Anlieferung (Sportplatz SV, alter B-Platz) 15. April 9:00 - 12:00 Uhr Anlieferung ab 19:00 Uhr Osterfeuer abbrennen 17. April ab 11:00 Uhr Osterpokal-Schießen Jembke 13. April 19:00 Uhr Agape-Mahl zum Gründonnerstag, St.-Georg-Kirche 15. April 9:00 - 12:00 Uhr Holzannahme Osterfeuer (Brennplatz Dannhopsweg) 19:00 Uhr Osterfeuer abbrennen Osloß 8. April 8:00 - 13:00 Uhr Holzannahme für Osterfeuer und 14:00 - 17:00 Uhr (Brennplatz Barnbruchstrift) 15. April 18:00 Uhr Osterfeuer abbrennen Tappenbeck 15. April 19:30 Uhr Osterfeuer abbrennen (Brennplatz vor Bertrand) 17. April 19:00 - 20:30 Uhr Osterpokalschießen der Kyffhäuser-Kameradschaft (für alle Tappenbecker ab dem 12. Lebensjahr) Weyhausen 14. -

Bericht Aus Der Gifhorner Rundschau
GIFHORNER SPORT Samstag, 11. August 2018 CJunioren des MTV locker Hervorragendes HalbdistanzDebüt inRunde2 Triathlon –Ostseeman 113 Jembker Ausdauersportler landet nach 113Kilometern auf dem 21. Platz. Jugendfußball Klares VonMichael Theuerkauf „Eswar toll,dass ich hatte den 34-Jährigen zudem auch 5:0 im Bezirkspokal. dieStreckenführung. Im eigentlich Flensburg. Er ist nochnichtlange in eine Weilemit einem flachenKüstenlandmussteGruß ei- Gifhorn. Nachdem die Herren auf dieser Sportart aktiv,dochdie Fort- nige Höhenmeterbewältigen. Zu- Bezirksebene ihre erstenPflicht- schritte sind beeindruckend. Am Profi Schritthalten demwar die Radstrecke an einigen spiele bestritten haben,steigen nun vergangenen Wochenende startete konnte.“ Stellen sehreng und schlechteinzu- auchdie Jugendfußballer des Krei- Fabian Gruß,Läufer des SV Jemb- sehen. Erstinder zweiten Runde, Fabian Gruß, Läufer und Triathletdes ses in die neue Saisonein. Einen ke, beimOstseeman in Glücksburg nachdem er sichmit dem Begeben- SV Jembke, der beim Ostseeman in „Frühstarter“ gab es indes: Die C-Ju- erstmals über die Mitteldistanz und heit vertraut gemacht hatte,konnte Flensburg teilnahm. genddes MTV Gifhorn zogbereits überraschte sich mitseinem Ergeb- er mehr Risiko und Tempo gehen. am Mittwoch mit einem klaren Sieg nis sogarselbst ein wenig. Nach 2:34:50 Stunden folgte der in Braunschweigindie zweite Run- Mitteldistanz, das bedeutet 1,9Ki- ziehen,umwieder auf die Strecke Wechsel vomZweirad in die Lauf- de des Bezirkspokalsein. lometer Schwimmen, satte 90 Kilo- zurückzukommen“, berichtete schuhe. Nochmal 20 Kilometer per C-Jugend: BSC Acosta II –MTV Gif- meter auf dem Fahrradund oben- Gruß. Garnicht so einfach. Denn pedes. Für den 34-Jährigen ist das horn 0:5 (0:2). Tore: nicht gemel- drein mit 21,1KilometernLaufen derWellengang warnichtohne in Laufen die Paradedisziplin, kommt det. -

Sorgen Im Einzelhandel
Allgemeine Zeitung · Niedersächsisches Tageblatt · Amtliches Bekanntmachungsorgan H 11310 Isenhagener Kreisblattaz-online.de Samstag/Sonntag, 1,50 € 2./3. August 2014 Wittinger Zeitung Jahrgang 128, Nr. 178 Zeitung für den Gifhorner Nordkreis VW-Vorstand Dr. Macht legt sein Amt nieder Wolfsburg. Dr. Michael 30º C 17º C Macht (53), Konzernvor- Zakis Wetter Seite 3 stand für Pro- duktion bei Volkswagen, RUBRIKEN hat sein Vor- standsman- Kfz-Markt 33-35 dat gestern Immobilien 38 niedergelegt, Stellen 40 teilt der VW- Konzern mit. Dr. Michael Darauf hätten Macht sich der Auf- „Friede ist sichtsrat der Volkswagen AG zerbrechlich“ und Dr. Macht einvernehmlich verständigt. dpa Moskau. Wladimir Putin Bis zur Berufung eines Nach- hat zum 100. Jahrestag des Be- folgers wird Thomas Ulbrich, ginns des Ersten Weltkriegs ge- Vorstand für Produktion der mahnt, dass der Friede in Euro- Marke Volkswagen Pkw, die pa „zerbrechlich“ sei. Ohne den Aufgaben kommissarisch über- blutigen Konflikt in der Ukraine Lautloses Schweben über Rade nehmen. „Michael Macht hat direkt zu erwähnen, sagte Putin das Volkswagen Produktions- in Moskau: „Gewalt erzeugt Ge- Rade. Wie in Reinhard Meys waren acht Rader dem Himmel ganisiert. Mit Ballonpilot Ingo sie auch über ihre Heimat Rade. system weiterentwickelt. Wir walt.“ Politik legendärem Lied „Über den sehr nahe. Dieter von Campen Lorenz ging es auf 300 Meter Mit 9 km/h ging’s in der Luft danken ihm für seine Leistung“, Wolken“ war es nicht. Dennoch hatte für sie eine Ballonfahrt or- Höhe. Und natürlich schwebten vorwärts. Seite 3 sagte der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, Dr. Martin Winterkorn, in einer Stellung- Israelischer Soldat nahme auf den Rücktritt. -

Ausgabe 2021 "Nord"
An sämtliche Haushalte LANDKREIS GIFHORN Abfallbewirtschaftung 2021 Allgemeine Hinweise zur Abfallentsorgung Fortschreibung der Abfuhrtermine Ausgabe - Nord: Stadt Wittingen SG Hankensbüttel SG Boldecker Land SG Brome SG Wesendorf www.gifhorn.de/abfallbewirtschaftung Landkreis Gifhorn Fachbereich Umwelt 9.3 - Abfallbewirtschaftung, Boden– und Immissionsschutz (Außenstelle Cardenap 2 - 4, Gifhorn) Postanschrift: Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn Sprech- und Servicezeiten: Mo. - Fr. 08.30 - 12.00 Uhr, Do. 14.00 - 17.00 Uhr E-Mail: [email protected] und [email protected] Fax: 05371 / 82-788 Abfallberatung ........................................................................................... 05371 / 82-781 Ehrenamtlich tätige Abfallberater/innen ........................ (s. hintere Umschlaginnenseite) Kundenservice Bestellung von Abfallbehältern, Behälterummeldungen und -gebühren, Abgabenbescheide ..... 05371 / 82-796 bis -799 Durchführung der Abfallentsorgung ........................................................ 05371 / 82-782 Glascontainerstandplätze (allgemein) s. a. unter REMONDIS ............... 05371 / 82-782 Ordnungswidrige Abfallentsorgung („Wilder Müll“ in freier Landschaft): Nordkreis (Stadt Wittingen, Samtgemeinden Wesendorf, .......................... 05376 / 8867 Hankensbüttel, Brome, Bold. Land, Gemeinde Sassenburg) oder Fax .....05376 / 8867 Südkreis (Stadt Gifhorn, Samtgemeinden Meinersen, Papenteich und Isenbüttel) ...................................................................... 05371 -

Ausbau Der A39 – Planfeststellungsabschnitt 7
Unterlage 19.5.4 Neubau der A39 Lüneburg – Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n Abschnitt 7, nördl. Ehra (L289) – Weyhausen (B188) Reptilienkartierung 2008 / 2009 / 2010 / 2012 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Wolfenbüttel Planungs- Landschaftsplanung Rekultivierung Gemeinschaft GbR LaReG Grünplanung Dipl. - Ing. Ruth Peschk-Hawtree Prof. Dr. Gunnar Rehfeldt Landschaftsarchitektin Dipl. Biologe Husarenstraße 25 38102 Braunschweig Telefon 0531 333374 Telefax 0531 3902155 Internet www.lareg.de E-Mail [email protected] Neubau der A39 Lüneburg – Wolfsburg Kartierbericht Reptilien PFA 7: Ehra (L 289) – Weyhausen (B 188) Kartierungen: Dipl.-Biol. S. Rehfeldt (2008) Dipl.-Biol. K. Baumann (2009/2010) Dipl.-Biol. N. Wilke-Jäkel (2012) Bericht: Dipl.-Biol. K. Baumann Dipl.-Biol. N. Wilke-Jäkel Zeichnungen: Dipl.-Ing. M. Recknagel A. Werner Braunschweig, Mai 2014 Planungsgemeinschaft LaReG i Neubau der A39 Lüneburg – Wolfsburg Kartierbericht Reptilien PFA 7: Ehra (L 289) – Weyhausen (B 188) Inhaltsverzeichnis 1 Veranlassung ........................................................................................................................ 1 2 Untersuchungsraum ............................................................................................................ 1 3 Methodik ................................................................................................................................ 2 3.1 Kartierungen / Erfassungen ................................................................................................... -

Und Gemeindeliste
Kirchengemeinde Ort Kirchengemeinde Ort Almke Almke Hasenwinkel Uhry Brome-Tülau Altendorf Hattorf Hattorf Brome-Tülau Benitz Hehlingen Hehlingen Brome-Tülau Brome Heiligendorf Barnstorf Brome-Tülau Croya Heiligendorf Heiligendorf Brome-Tülau Kaiserwinkel Heiligendorf Waldhof Brome-Tülau Tülau Jembke Barwedel Brome-Tülau Voitze Jembke Bokensdorf Brome-Tülau Wiswedel Jembke Hoitlingen Darrigsdorf Darrigsdorf Jembke Jembke Darrigsdorf Glüsingen Jembke Tiddische Darrigsdorf Hahnenberg Knesebeck Eutzen Ehmen Ehmen Knesebeck Friedrichsmühle Ehra Boitzenhagen Knesebeck Knesebeck Ehra Ehra Knesebeck Schönewörde Ehra Lessien Knesebeck Transvaal Fallerleben Fallersleben Knesebeck Vorhop Fallerleben Ilkerbruch Knesebeck Weißes Moor Fallerleben Sandkamp Mörse Mörse Groß Oesingen Groß Oesingen Neindorf Neindorf Groß Oesingen Klein Oesingen Ohrdorf Küstorf Groß Oesingen Schmarloh Ohrdorf Ohrdorf Groß Oesingen Texas Ohrdorf Schneflingen Groß Oesingen Zahrenholz Ohrdorf Teschendorf Hankensbüttel Alt-Isenhagen Sprakensehl Behren Hankensbüttel Bottendorf Sprakensehl Blickwedel Hankensbüttel Dedelsdorf Sprakensehl Bokel Hankensbüttel Emmen Sprakensehl Breitenhees Hankensbüttel Hankensbüttel Sprakensehl Hagen Hankensbüttel Langwedel Sprakensehl Sprakensehl Hankensbüttel Lingwedel Steinhorst Auermühle Hankensbüttel Masel Steinhorst Im Reinhorn Hankensbüttel Obernholz Steinhorst Lüsche Hankensbüttel Oerrel Steinhorst Räderloh Hankensbüttel Repke Steinhorst Steinhorst Hankensbüttel Schweimke Sülfeld Sülfeld Hankensbüttel Steimke Wettmershagen Allenbüttel Hankensbüttel -

1986L0465 — En — 13.03.1997 — 003.001 — 1
1986L0465 — EN — 13.03.1997 — 003.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 14 July 1986 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/ 268/EEC (Germany) (86/465/EEC) (OJ L 273, 24.9.1986, p. 1) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 89/586/EEC of 23 October 1989 L 330 1 15.11.1989 ►M2 CommissionDecision91/26/EEC of 18 December 1990 L 16 27 22.1.1991 ►M3 Council Directive 92/92/EEC of 9 November 1992 L 338 1 23.11.1992 ►M4 amended by Commission Decision 93/226/EEC of 22 April 1993 L 99 1 26.4.1993 ►M5 amended by Commission Decision 97/172/EC of 10 February 1997 L 72 1 13.3.1997 ►M6 amended by Commission Decision 95/6/EC of 13 January 1995 L 11 26 17.1.1995 1986L0465 — EN — 13.03.1997 — 003.001 — 2 ▼B COUNCIL DIRECTIVE of 14 July 1986 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/268/EEC (Germany) (86/465/EEC) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, Having regard to Council Directive 75/268/EEC of 28 April 1975 on mountain and hill farming and farming in certain less-favoured areas (1), as last amended by Regulation (EEC) No 797/85 (2), and in particular Article 2 (2) thereof, Having regard to the proposal from the Commission, Having regard to the opinion of the European Parliament (3), Whereas Council Directive 75/270/EEC of 28 April