Verfassungsschutzbericht 2020 2 Freie Hansestadt Bremen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Untersuchungsbericht Zur Machbarkeitsuntersuchung
ABSCHLUSSBERICHT für die GB infraVelo GmbH Ullsteinhaus Mariendorfer Damm 1 12099 Berlin Berlin, Machbarkeitsstudie 24.08.2020 Radschnellverbindung RSV 8 „Nonnendammallee – Falkenseer Chaussee“ © Rambøll ETC Gauff Mobility GmbH Martin-Hoffmann-Str. 18 12435 Berlin in Zusammenarbeit mit EIBS GmbH Rambøll GmbH Petersburger Straße 94 Neue Grünstraße 17-18 10247 Berlin 10179 Berlin PB Consult GmbH Rothenburger Straße 5 90443 Nürnberg Auftraggeber: Finanzierung durch: GB infraVelo GmbH Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Mariendorfer Damm 1 Am Köllnischen Park 3 12099 Berlin 10179 Berlin www.infravelo.de www.berlin.de/sen/uvk Machbarkeitsstudie RSV 8, Trasse Nonnendammallee – Falkenseer Chaussee Seite 2 Inhaltsverzeichnis TABELLENVERZEICHNIS ................................................................................................................. 5 ABBILDUNGSVERZEICHNIS ............................................................................................................ 6 GLOSSAR/ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ........................................................................................... 9 0 ZUSAMMENFASSUNG ......................................................................................................... 10 1 PROJEKTORGANISATION ..................................................................................................... 13 1.1 AUFTRAGGEBER ......................................................................................................................... 13 1.2 AUFTRAGNEHMER ..................................................................................................................... -

Supervision and Ethics
periodical for professional exchange and networking European Journal for Supervision and Coaching Supervision and Ethics Role of ethics in creating supervision a safe place Maca Cicak & Kristina Urbanc How to develop supervisors’ ethical reasoning? Liisa Raudsepp & Helena Ehrenbusch Work clothes of a supervisor Attila Szarka Volume 4 - 2020 - Issue 2 Index Page Sijtze de Roos Autumn 2020 3 Column Gerian Dijkhuizen Hers not mine 5 Articles Maca Cicak & Kristina Urbanc Role of ethics in creating supervision a safe place 6 Jean-Paul Munsch Towards Mastery 14 Liisa Raudsepp & Helena Ehrenbusch How to develop supervisors’ ethical reasoning? 17 Hans Bennink Multiple loyalties of professionals in organizations 21 Daniel Trepsdorf Supervision with ‘far right-wing individuals in a group setting’ 28 Christof Arn Ethics of Consultancy 34 A Practical Overview Attila Szarka Work clothes of a supervisor 38 Ineke Riezebos Playful Professional 42 The use of a visual work form in supervision and coaching Ulrike Mathias-Wiedemann Book review: supervision put to the test 46 Gerian Dijkhuizen Interview Ioseba Guillermo 51 ANSE JOURNAL 2 VOLUME 4 - 2020 - ISSUE 2 Autumn 2020 ■ Sijtze de Roos Trust, it would appear, is no longer self-evident. In the measure their own codes of conduct, ethical guideli- past, so they say, people ‘knew their place’ and more or nes and general moral principles. Its main purpose is to less blindly trusted and followed the leaders of their parti- challenge supervisors and their professional associations cular social group, class or political party. Nowadays trust all over Europe to always act according to moral require- seems to have turned into work. -

Discours Sur La Nouveauté Littéraire Et Artistique Dans Les Pays Germaniques
INNOVATION - REVOLUTION : Discours sur la nouveauté littéraire et artistique dans les pays germaniques Introduction Fanny PLATELLE et Nora VIET Ce volume réunit les contributions issues de la journée d’études « Innovation - Revolution : discours sur la nouveauté littéraire et artistique dans les pays germaniques » / « Innovation - Revolution : literarische und künstlerische Erneuerung im Diskurs », organisée à la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand le 16 juin 2016. Cette journée s’est inscrite dans le projet « Wende & Wandel : dire et penser le changement dans le monde germanique » du groupe interdisciplinaire de travail Germanosphères, projet soutenu par la MSH de Clermont-Ferrand (2015-2016). Après un premier atelier scientifique dédié à la notion d’« heure zéro » (« Stunde null : entre mythe et réalité », le 2 octobre 2015), cette seconde journée a été consacrée aux processus d’innovation et de renouvellement à l’œuvre dans l’histoire littéraire et l’histoire de l’art des pays germaniques, abordés à travers les concepts et discours qu’ils suscitent. « Innovation », « Revolution », « Traditionsbruch », « Avant-Garde » : les mots qui désignent l’innovation littéraire et artistique dans le discours critique des pays germaniques sont porteurs d’une pensée, voire d’un imaginaire de la nouveauté esthétique, nécessairement tributaires du contexte historique, culturel et idéologique dans lequel ils s’inscrivent, mais qui ne se laissent pas toujours réduire à ce contexte. Dans cette perspective, les contributions de ce volume se proposent d’étudier les discours théoriques et critiques sur la nouveauté esthétique, générique, poétique que peuvent représenter la publication d’une œuvre donnée, la traduction d’un auteur étranger, l’émergence d’un courant, l’apparition d’un nouveau genre. -

Frå Avgrunn Til Platå Attføding, Fantasiar Og Begjær I Fascismen
1 Frå avgrunn til platå Attføding, fantasiar og begjær i fascismen From the Abyss to the Plateau Rebirth, Fantasies and Desire in Fascism Haust 2020 Axel Fjeld Universitetet i Bergen Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Masteroppgave i FILO350 Frå avgrunn til platå - attføding, fantasiar og begjær i fascismen - Fjeld 2 Abstract Fascism lingers on, despite our best efforts. The thesis at hand asks why, and how it may be dealt with. More precisely, it questions which subterranean impulses, fixations and fantasies characterise fascism as a human phenomenon, to answer the pressing question of why some people become fascists. Starting from what might be called the mainstream academic consensus on the matter, it goes on to engage with recent historical and philosophical work to examine not simply fascism as a historical event, but the “fascism in our hearts”. Providing insight into contemporary fascist movements and their rhetorical strategies, it also displays the link between certain rhetorical messages and underlying reactionary impulses. It finds that fascism is characterised by certain themes of fantasy, which all lead to a position of misogynist masculinity. Fascism is also characterised by a struggle for control and is driven by a irreducible desire to dominate which is renewed by the material and psychological struggles of life in hierarchical societies. This results in a fixation on a phantasm of ascension from the chaotic, murky and frightening abyss, up to the safety of the clean, orderly and illuminated plateau – a fixation which fuels the daily engagement and activism of the fascist individual. With Klaus Theweleit’s Male Fantasies as main inspiration, chapter one begins with selected contemporary mainstream approaches before going into some depth on the philosophical framework used by Gilles Deleuze and Felix Guattari to explain fascism. -

Coal Tar Creosote
This report contains the collective views of an international group of experts and does not necessarily represent the decisions or the stated policy of the United Nations Environment Programme, the International Labour Organization, or the World Health Organization. Concise International Chemical Assessment Document 62 COAL TAR CREOSOTE Please note that the layout and pagination of this pdf file are not identical to the document being printed First draft prepared by Drs Christine Melber, Janet Kielhorn, and Inge Mangelsdorf, Fraunhofer Institute of Toxicology and Experimental Medicine, Hanover, Germany Published under the joint sponsorship of the United Nations Environment Programme, the International Labour Organization, and the World Health Organization, and produced within the framework of the Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals. World Health Organization Geneva, 2004 The International Programme on Chemical Safety (IPCS), established in 1980, is a joint venture of the United Nations Environment Programme (UNEP), the International Labour Organization (ILO), and the World Health Organization (WHO). The overall objectives of the IPCS are to establish the scientific basis for assessment of the risk to human health and the environment from exposure to chemicals, through international peer review processes, as a prerequisite for the promotion of chemical safety, and to provide technical assistance in strengthening national capacities for the sound management of chemicals. The Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals (IOMC) was established in 1995 by UNEP, ILO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, WHO, the United Nations Industrial Development Organization, the United Nations Institute for Training and Research, and the Organisation for Economic Co-operation and Development (Participating Organizations), following recommendations made by the 1992 UN Conference on Environment and Development to strengthen cooperation and increase coordination in the field of chemical safety. -
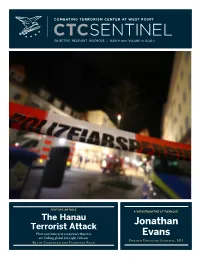
Jonathan Evans, Former Director General, MI5 Raffaello Pantucci EDITORIAL BOARD Colonel Suzanne Nielsen, Ph.D
OBJECTIVE ·· RELEVANT ·· RIGOROUS || JUNE/JULYMARCH 2020 2018 · VOLUME · VOLUME 13, 11,ISSUE ISSUE 3 6 FEATURE ARTICLE A VIEW FROM THE CT FOXHOLE The TheJihadi Hanau Threat LTC(R)Jonathan Bryan Price Terrorist Attack toHow race Indonesia hate and conspiracy theories Evans are fueling global far-right violence Former Director, Former Director General, MI5 Blyth CrawfordKirsten E.and Schulze Florence Keen Combating Terrorism Center FEATURE ARTICLE Editor in Chief 1 The Hanau Terrorist Attack: How Race Hate and Conspiracy Theories Are Fueling Global Far-Right Violence Paul Cruickshank Blyth Crawford and Florence Keen Managing Editor INTERVIEW Kristina Hummel 9 A View from the CT Foxhole: Jonathan Evans, Former Director General, MI5 Raffaello Pantucci EDITORIAL BOARD Colonel Suzanne Nielsen, Ph.D. ANALYSIS Department Head 16 The Pensacola Terrorist Attack: The Enduring Influence of al-Qa`ida and its Dept. of Social Sciences (West Point) Affiliates Colin P. Clarke Brian Dodwell Director, CTC 24 Dollars for Daesh: The Small Financial Footprint of the Islamic State's American Supporters Don Rassler Lorenzo Vidino, Jon Lewis, and Andrew Mines Director of Strategic Initiatives, CTC 30 Addressing the Enemy: Al-Shabaab's PSYOPS Media Warfare Christopher Anzalone CONTACT Combating Terrorism Center Far-right terror is going global, propelled to a significant degree by an on- line ecosystem of extremists posting in English. Since 2018, attackers U.S. Military Academy have targeted synagogues in Pittsburgh, Pennsylvania; the towns of Poway, 607 Cullum Road, Lincoln Hall California, and Halle, Germany; mosques in Christchurch, New Zealand; and a Walmart in El Paso, Texas. In this month’s feature article, Blyth Crawford and Florence Keen examine the February 19, West Point, NY 10996 2020, far-right terrorist attack that targeted shisha bar customers in the German town of Hanau and Phone: (845) 938-8495 led to the death of nine victims. -

ABSCHLUSSBERICHT Für Die
ABSCHLUSSBERICHT für die GB infraVelo GmbH Ullsteinhaus Mariendorfer Damm 1 12099 Berlin Machbarkeitsstudie Berlin, 24.08.2020 Radschnellverbindung RSV 5 „West-Route“ ETC Gauff Mobility GmbH Martin-Hoffmann-Str. 18 12435 Berlin in Zusammenarbeit mit EIBS GmbH Rambøll GmbH Petersburger Straße 94 Neue Grünstraße 17-18 10247 Berlin 10179 Berlin PB Consult GmbH Rothenburger Straße 5 90443 Nürnberg Auftraggeber: Finanzierung durch: GB infraVelo GmbH Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Mariendorfer Damm 1 Am Köllnischen Park 3 12099 Berlin 10179 Berlin www.infravelo.de www.berlin.de/sen/uvk Machbarkeitsstudie RSV 5, West-Route Seite 2 Inhaltsverzeichnis ABBILDUNGSVERZEICHNIS ........................................................................................ 6 TABELLENVERZEICHNIS ............................................................................................. 9 GLOSSAR ................................................................................................................. 10 0 ZUSAMMENFASSUNG ....................................................................................... 11 1 PROJEKTORGANISATION ................................................................................... 14 1.1 AUFTRAGGEBER .................................................................................................................14 1.2 AUFTRAGNEHMER ..............................................................................................................14 1.3 AUFGABENSTELLUNG ..........................................................................................................14 -
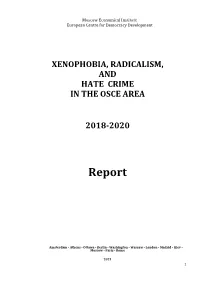
Xenophobia, Radicalism, and Hate Crime in the Osce Area 2018-2020
Moscow Economical Institute European Centre for Democracy Development XENOPHOBIA, RADICALISM, AND HATE CRIME IN THE OSCE AREA 2018-2020 Report Amsterdam - Athens - Ottawa - Berlin - Washington - Warsaw - London - Madrid - Kiev - Moscow - Paris - Rome 2021 1 Editor-in-chief and project manager: Valery Engel, PhD Authors: Dr. Valery Engel, (General Analytics, the Historiography of the Issue), Dr. Jean-Yves Camus (France), Dr. William Allchorne (UK), Dr. Anna Castriota (Italy), Marina Peunova-Connor (USA), Barbara Molas (Canada), Dr. Ali Dizboni (Canada) Dr. Vanja Ljujic (Netherlands), Dr. Pranvera Tika (Greece), Dr. Katarzyna du Wal (Poland), Dr. Dmitri Stratijewski (Germany), Ruslan Bortnyk (Ukraine), Laia Tarragona (Spain), Dr. Semen Charny ( Russia) Xenophobia, Radicalism and Hate Crimes in the OSCE Area. - Riga: 2021. - 161 p. The monograph "Xenophobia, Radicalism and, Hate Crimes in the OSCE Area, 2018-20", prepared by the Moscow Economic Institute with the assistance of the European Center for the Development of Democracy, is a study by leading experts from around the world, based on monitoring and comparative analysis of anti- extremist legislation, law enforcement practice, the level of public tolerance, statistics of hate crimes committed, and activities of radical and extremist organizations from 2018 to 2020 in a number of countries around the world. The geographic scope of the study is designated as the "OSCE area", although we are talking about 10 European countries and 2 North countries including America. Of course, such a set of monitoring countries does not cover all the states that are members of this international organization, however, it allows us to trace general trends in lawmaking, law enforcement practice and other spheres of government and public life that affect the situation with extremism. -

Neue Rechte, Populismus, Islamismus, War on Terror Dieses Werk Ist Lizenziert Unter Der Creative Commons Attribution 4.0 (BY)
Jennifer Schellhöh, Jo Reichertz, Volker M. Heins, Armin Flender (Hg.) Großerzählungen des Extremen X-Texte zu Kultur und Gesellschaft Editorial Das vermeintliche »Ende der Geschichte« hat sich längst vielmehr als ein Ende der Gewissheiten entpuppt. Mehr denn je stellt sich nicht nur die Frage nach der jeweiligen »Generation X«. Jenseits solcher populären Figuren ist auch die Wissenschaft gefordert, ihren Beitrag zu einer anspruchsvollen Zeitdiagnose zu leisten. Die Reihe X-TEXTE widmet sich dieser Aufgabe und bietet ein Fo- rum für ein Denken für und wider die Zeit. Die hier versammelten Essays de- chiffrieren unsere Gegenwart jenseits vereinfachender Formeln und Orakel. Sie verbinden sensible Beobachtungen mit scharfer Analyse und präsentieren beides in einer angenehm lesbaren Form. Jennifer Schellhöh, Jo Reichertz, Volker M. Heins, Armin Flender (Hg.) Großerzählungen des Extremen Neue Rechte, Populismus, Islamismus, War on Terror Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 (BY). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell. (Lizenztext: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) © 2018 Jennifer Schellhöh, Jo Reichertz, Volker M. Heins, Armin Flender (Hg.) Erschienen 2018 im transcript Verlag, Bielefeld Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deut- schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Umschlaggestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar Print-ISBN 978-3-8376-4119-6 PDF-ISBN 978-3-8394-4119-0 EPUB-ISBN 978-3-7328-4119-6 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. -

Rechtsterroristische Gruppen in Deutschland Nach Dem NSU Philippsberg, Robert
www.ssoar.info Rechtsterroristische Gruppen in Deutschland nach dem NSU Philippsberg, Robert Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: Verlag Barbara Budrich Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Philippsberg, R. (2021). Rechtsterroristische Gruppen in Deutschland nach dem NSU. ZRex - Zeitschrift für Rechtsextremismusforschung, 1(1), 147-166. https://doi.org/10.3224/zrex.v1i1.09 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY Lizenz (Namensnennung) zur This document is made available under a CC BY Licence Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden (Attribution). For more Information see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Diese Version ist zitierbar unter / This version is citable under: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-73759-3 Rechtsterroristische Gruppen in Deutschland nach dem NSU RobertPhilippsberg Zusammenfassung: In dem Aufsatz wird der Frage nachgegangen, welche charakteristischen Merkmale rechtsterroristische Gruppen nach dem NSU in Deutschland zwischen 2011 und 2020 aufweisen. Hierzu wurden als Fallbeispiele die rechtsterroristischen Vereinigungen Old School Society, Gruppe Freital,Revolution Chemnitz und die mutmaßlich rechtsterroristische Gruppe S. anhand der Kriterien Entstehung und Entwicklung, Gruppenstruktur, Täter*in- nenprofil, Auswahlder Ziele/Opfer, Gewaltintensität, Kommunikationsstrategie -

DER RABE RALF Februar/März 2013
Die Berliner Umweltzeitung Februar / März 2013 Herausgegeben seit 1990 von der GRÜNEN LIGA Ber lin e.V. - Netzwerk öko logi scher Be we gungen A100 spaltet die Die „braune Spree“ - Anmerkungen zur Geister - Wahnwitz Gefahr durch Vattenfall- Grünen Woche und Bundesautobahn Braunkohle EU-Agrarreform Seite 3 Seite 9 Seite 16/17 Für unser Stadtwerk und unser Netz! Volksbegehren “Neue Energie für Berlin” geht ab 11. Februar in die zweite Stufe as Land Berlin ist zurzeit sich der Berliner Energietisch zum eines Stadtwerkes ein. Dazu wurde im folgende politische Diskussion brachte Schlusslicht bei der Energie- Ziel gesetzt. Er ist ein offenes Bündnis März letzten Jahres das Volksbegehren jedoch keine nennenswerten Ergebnisse Dwende. Der Ausbau erneuer- aus fast 50 lokalen Organisationen, das „Neue Energie für Berlin“ gestartet, hervor. Der Senat lehnte den vom Ener- barer Energien kommt bisher nicht die Berliner Energieversorgung ökolo- welches nun ab dem 11. Februar in die gietisch vorgelegten Gesetzesentwurf voran, die Klimaschutzziele rücken in gischer, sozialer und demokratischer zweite Stufe geht. ab. Lediglich die Koalitionsfraktion weite Ferne und der SPD/CDU Senat gestalten will. Deswegen setzt sich der Im Juli 2012 hat der Energietisch aus SPD und CDU legten im Dezember beschränkt sich auf unverbindliche Energietisch für die Rekommunalisie- die erste Stufe des Volksbegehrens Ankündigungen. Dies zu ändern, hat rung der Stromnetze und die Gründung erfolgreich abgeschlossen. Die darauf- Fortsetzung auf Seite 4 PVSt - DPAG - A 14194 - I (2013) - Ent gelt be zahlt • GRÜNE LIGA Berlin e.V., Prenz lau er Allee 8, 10405 Berlin, Tel. (030) 44 33 91-47/-0, Fax -33 • ISSN 1438-8065 • 24. -

European Union Terrorism Situation and Trend Report 2021 EUROPEAN UNION TERRORISM SITUATION and TREND REPORT 2021
European Union Terrorism Situation and Trend report 2021 EUROPEAN UNION TERRORISM SITUATION AND TREND REPORT 2021 PDF | ISBN 978-92-95220-26-3 | ISSN 2363-0876 | DOI: 10.2813/677724 | QL-AJ-21-001-EN-N © European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, 2021 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. For any use or reproduction of photos or other material that is not under the copyright of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, permission must be sought directly from the copyright holders. Cite this publication: Europol (2021), European Union Terrorism Situation and Trend Report, Publications Office of the European Union, Luxembourg. This publication and more information on Europol are available on the Internet. www.europol.europa.eu Contents 4 Foreword 6 Trends and Executive Summary 10 Introduction 12 Terrorism in Europe in 2020: an overview 42 Jihadist terrorism 78 Right-wing terrorism 92 Left-wing and anarchist terrorism 98 Annexes Foreword TERRORISM Law enforcement authorities in the AND VIOLENT Member States and, together with them, EXTREMISM IN Europol undertakes ardent efforts to ALL FORMS ARE mitigate these threats. SIGNIFICANT I am pleased to present this comprehensive situation report, which details SECURITY the terrorism situation including figures regarding terrorist attacks and arrests in the EU in 2020. The European Union (EU) Terrorism Situation CHALLENGES TO and Trend Report (TE-SAT) 2021 is one of Europol’s key reports and highlights the Agency’s role as a crucial information broker and key THE EU. component of the EU’s internal security framework. During 2020, much of the attention of the public, policy-makers and law enforcement has been captivated by the COVID-19 pandemic and our response to this unprecedented crisis.