Umsetzungskonzept KEM Energie-Regatta
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Der Frühling Ist Da! © 123Rf, Alexander Raths © 123Rf
50 > Unsere Generation WIRApril 2018 Hausruckviertel l Der Frühling ist da! © 123rf, Alexander Raths © 123rf, Pensionistenverband Oberösterreich Themen der Zeit – wir reden mit! FPÖ-Attacken auf den ORF Nach FPÖ-Attacken auf den ORF fordern deutsche Starjournalisten Bundeskanzler Kurz zum Eingreifen auf. Mag. Werner Guttmann, ehem. SP-Vizebürgermeister Großraming und kfm. Direktor der Ennskraftwerke AG. Beinahe jede/r von uns hört und schaut vermutlich täglich Sendungen im ORF. Unser öffentlich rechtlicher Rundfunk Aktuell hat, anders als Privatsender, den Auftrag, neben Unterhaltung auch ein umfassen- des Informations- und Kulturangebot zu bieten. Der ORF hat täglich mehr als 20 Nachrichtensendungen, Dokumentatio- nen, große Kultursendungen, Auslands- korrespondenten von Washington bis Peking, neun Landesstudios, Randsport- © ORF/Thomas Ramstorfer arten, Kinderprogramm usw. Für dieses umfassende öffentlich-recht- Sie alle sind, wie auch in österreichi- liche Angebot von weit über 50 Stunden schen Zeitungen zu lesen war, „bestürzt Schweizer gegen Abschaffung täglich bezahlen wir 80 Cent am Tag, rund darüber, dass Strache Armin Wolf und der Rundfunkgebühren 25 Euro im Monat. Das ist weniger, als ein hunderte Journalistinnen und Journalisten Fast 72 Prozent der Schweizerin- Abonnement mancher Tageszeitung. des ORF als Propagandisten und Produ- nen und Schweizer sagten kürzlich Nicht alle von uns werden mit dem zenten von Falschmeldungen verleumde“. „Nein“ zur Abschaffung der Gebüh- Programm immer zufrieden sein, aber die „Den Versuch des Vizekanzlers der öster- ren fürs Schweizer Fernsehen. Auch massiven Angriffe der FPÖ gefährden die reichischen Regierung, den persönlichen in Österreich gibt es bereits eine Pressefreiheit und es geht offenbar darum, Ruf von Journalisten zu beschädigen und Petition für die Unabhängigkeit des den ORF völlig unter politische Kontrolle zu deren Glaubwürdigkeit zu untergraben, ORF – hier kann man unterzeichnen: bringen. -

Bundesgesetzblatt Für Die Republik Österreich
1 von 5 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2006 Ausgegeben am 3. April 2006 Teil II 139. Verordnung: 10. Änderung der Wildvogel-Geflügelpestverordnung 2006 139. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen zur 10. Änderung der Verordnung über Schutzmaßnahmen wegen Verdachtsfällen von Geflügelpest bei Wildvögeln (10. Änderung der Wildvogel-Geflügelpestverordnung 2006) Gemäß § 1 Abs. 5 und 6 sowie der §§ 2 und 2c des Tierseuchengesetzes RGBl. Nr. 177/1909, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 67/2005, wird verordnet: § 1. Die Anhänge der Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über Schutzmaßnahmen wegen Verdachtsfällen von Geflügelpest bei Wildvögeln (Wildvogel- Geflügelpestverordnung 2006), BGBl. II Nr. 80/2006, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 132/2006, werden durch die Anhänge zu dieser Verordnung ersetzt. § 2. Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. März 2006 in Kraft. Rauch-Kallat Anhang A Schutzzonen Die Schutzzone 1 ist ab 11. März 2006 aufgehoben. Die Schutzzone 2 ist ab 9. März 2006 aufgehoben. Die Schutzzone 3 ist ab 11. März 2006 aufgehoben. Die Schutzzone 4 ist ab 17. März 2006 aufgehoben. Die Schutzzone 5 ist ab 25. März 2006 aufgehoben. Die Schutzzone 6 ist ab 25. März 2006 aufgehoben. Die Schutzzone 7 ist ab 25. März 2006 aufgehoben. Die Schutzzone 8 ist ab 25. März 2006 aufgehoben. Die Schutzzone 9 umfasst ab 10. März 2006: In Oberösterreich: alle Gebiete der Katastralgemeinden Fraunhof und Gattern der Gemeinde Schardenberg, die innerhalb eines 3 km Radius gemessen vom linken Innufer der Staumauer des Kraftwerkes Ingling bei Passau, liegen. www.ris.bka.gv.at BGBl. II - Ausgegeben am 3. -
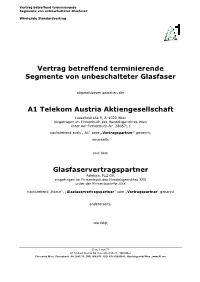
Vertrag Betreffend Terminierende Segmente Von Unbeschalteter Glasfaser
Vertrag betreffend terminierende Segmente von unbeschalteter Glasfaser Wholesale Standardvertrag Vertrag betreffend terminierende Segmente von unbeschalteter Glasfaser abgeschlossen zwischen der A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft Lassallestraße 9, A-1020 Wien eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter der Firmenbuch-Nr. 280571 f nachstehend auch „ A1“ oder „Vertragspartner“ genannt, einerseits und dem Glasfaservertragspartner Adresse, PLZ Ort eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichtes XXX unter der Firmenbuch-Nr.XXX nachstehend „Name“, „Glasfaservertragspartner” oder „Vertragspartner“ genannt andererseits, wie folgt Seite 1 von 71 A1 Telekom Austria AG ; Lassallestraße 9 ; 1020 Wien Firmensitz Wien ; Firmenbuch - Nr. 280571f ; DVR: 0962635 ; UID: ATU 62895905 ; Handelsgericht Wien ; www.A1.net Vertrag betreffend terminierende Segmente von unbeschalteter Glasfaser Version 04.03.2015 Allgemeiner Teil Allgemeiner Teil 1. Grundsätzliches Der vorliegende Rahmenvertrag von A1 stützt sich auf den Bescheid M 1.5/2012-135 der Telekom-Control-Kommission vom 28.07.2014. Der Vertrag richtet sich an Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes und/oder öffentlichen Telekommunikationsdienstes im Sinne von § 3 Z1, Z2, Z3 und Z 21 TKG 2003, die die Bereitstellung ihres öffentlichen Telekommunikationsnetzes und/oder öffentlichen Telekommunikationsdienstes gemäß § 15 TKG 2003 bei der Regulierungsbehörde angezeigt haben oder gemäß § 133 (4) TKG 2003 über eine Bestätigung der Konzessionsurkunde verfügen und die vertragsgegenständlichen -

19. OÖ ORTSBILDMESSE Aspach Pichl Bei Wels Landeskulturdirektion Attersee Am Attersee Pollham Landschaftsbau Des Landes OÖ
AUSSTELLER Aussteller des Landes OÖ. Agrarbezirksbehörde OÖ. Oö. Gemeinden und Dorf- & Stadtentwicklungsvereine Erwachsenenbildung des Landes OÖ. Aigen - Rudolfing Ottnang am Hausruck Geschäftsstelle für Dorf- & Stadtentwicklung Altmünster - Neukirchen Peuerbach Jugendreferat des Landes OÖ. 19. OÖ ORTSBILDMESSE Aspach Pichl bei Wels Landeskulturdirektion Attersee am Attersee Pollham Landschaftsbau des Landes OÖ. Vöcklamarkt/Schmidham Braunau-Ranshofen Prambachkirchen OÖ. Akademie für Umwelt und Natur Diersbach Pregarten OÖ. Energiesparverband Dimbach Puchkirchen am Trattberg 29. August 2010 Dorf an der Pram Reichenthal - Heidenstein Andere Länder und Gemeinden Engelhartszell Rainbach im Mühlkreis Amt der Tiroler Landesregierung Enns Regau Gemeindeentwicklung Salzburg Fraham Reichraming Dorfverein Schönau / Bayern Frankenburg am Hausruck Riedau Ilztal & Dreiburgenland / Perlesreut Geinberg Rüstorf Markt Moosbach / Oberpfalz Grieskirchen Sarleinsbach Gemeinde Mertzig / Luxemburg Hagenberg im Mühlkreis Sigharting Hallstatt Schärding Weitere Aussteller Hargelsberg Schenkenfelden Herzogsdorf Schwanenstadt Agrarium GmbH - Familienparadies Hinterstoder St. Agatha ARGE deutsche Schrift Hochburg-Ach St. Marienkirchen a. d. Polsenz ASKÖ Steyrermühl - Bogenschießen Hofkirchen im Mühlkreis AVE Österreich GmbH St. Georgen im Attergau Bezirksabfallverband Vöcklabruck Hofkirchen/Mkr. - Niederranna St. Oswald bei Freistadt Kirchberg ob der Donau Bezirksrundschau Marketing Linz St. Wolfgang im Salzkammergut Kirchheim im Innkreis Bundesdenkmalamt St. Thomas -

Unterach Am Attersee
[Geben Sie Text ein] Prüfungsbericht der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck über die Einschau in die Gebarung der Gemeinde Unterach am Attersee BHVB-2015-4562/3-HEI Impressum Herausgeber: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 4021 Linz, Bahnhofplatz 1 Redaktion und Graphik: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung Herausgegeben: Linz, im Juli 2015 2 Die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck hat in der Zeit von Anfang Februar bis Ende März 2015 durch eine Prüferin gemäß § 105 Oö. Gemeindeordnung 1990 in Verbindung mit § 1 Oö. Gemeindeprüfungsordnung 2008 eine Einschau in die Gebarung der Gemeinde Unterach am Attersee vorgenommen. Für diese Prüfung wurden 17 Arbeitstage beim Gemeindeamt aufgewendet. Zur Prüfung wurden vor allem die Jahre 2012 bis 2014 sowie der Voranschlag für das Finanzjahr 2015 herangezogen. Um die Haushaltsentwicklung besser analysieren zu können, wurden aber zum Teil auch Vorjahre miteinbezogen. Der Bericht analysiert die Gebarungsabwicklung der Gemeinde und beinhaltet Feststel- lungen in Hinblick auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, der öffentlichen und sozialen Einrichtungen und unterbreitet Vorschläge zur Verbesserung des Haushaltsergebnisses. Die im Bericht kursiv gedruckten Passagen stellen die Empfehlungen der Bezirkshaupt- mannschaft Vöcklabruck und der Direktion Inneres und Kommunales des Amtes der oö. Landesregierung dar und sind als solche von den zuständigen Organen der Gemeinde umzusetzen. Alle monetären Vorschläge für eine nachhaltige Budgetkonsolidierung sind als -
Salzkammergut Wintercard 2020/21 English
WINTER CARD 2020/21 ATTERSEE-ATTERGAU AUSSEERLAND BAD ISCHL DACHSTEIN FUSCHLSEEREGION MONDSEE-IRRSEE TRAUNSEE-ALMTAL WOLFGANGSEE WINTERCARD AT A GLANCE You can find all partner enterprises of the Salzkammergut Card listed according to destinations on the following pages: Benefits with the card: Up to 25% discount on museums, swimming pools/wellness facilities, Overview of partner businesses listed according to topics 4 horse-drawn carriage rides, salt mines, ski rental, ski schools, shopping and other Attergau - Attersee Holiday Region - Salzkammergut 6 - 7 leisure time and sports activities. Ausseerland Holiday Region - Salzkammergut 8 - 12 Available: Bad Ischl - Salzkammergut 12 - 17 Free of charge if you stay at least three nights and issued by all tourist Dachstein Holiday Region - Salzkammergut 17 - 18 information offices and information points of the Salzkammergut. Permanent campers, second-home owners and locals can buy the Card at the regular price of Fuschlsee Holiday Region - Salzkammergut 19 - 20 EUR 4.90. Holiday Region Mondsee-Irrsee - Salzkammergut 20 - 21 Holiday Region Traunsee-Almtal - Salzkammergut 21 - 26 Valid: Period: 01 November 2020 to 30 April 2021 Holiday Region Wolfgangsee - Salzkammergut 26 - 28 Guests can enjoy the advantages offered by the Salzkammergut Winter Card for Salzburg and Salzburg Surroundings 28 - 30 the entire duration of their stay. For locals and owners of second homes, the Card Featured Ski Areas 32 - 38 is valid for 21 days from the issue date. The Card is personalised and non-transferable. The Card is only valid once the back is completed in full. Children under 14 do not need their own card. They can take advantage of the reduced rates when accompanied by an adult with a Winter Card. -

Years of Innovation Annual Report 2012
COPYRIGHT AND PUBLISHED BY Lenzing Aktiengesellschaft LENZING GROUP LENZING 4860 Lenzing, Austria . www.lenzing.com EDITED BY YEARS OF Lenzing Aktiengesellschaft Corporate Communications INNOVATION ANNUAL REPORT 2012 . Angelika Guldt ANNUAL REPORT 2012 LENZING GROUP Phone: +43 (0) 76 72 701-21 27 Fax: +43 (0) 76 72 918-21 27 E-mail: [email protected] Metrum Communications GmbH, Vienna IDEA AND DESIGN BY ElectricArts GmbH PRINTED BY kb-o set Kroiss & Bichler GmbH & CoKG PHOTOGRAPHY BY Lenzing AG Dave Moss manfredlang VISUELLE KOMMUNIKATION GMBH Trumph GmbH & Co. KG Boris Renner Elisabeth Grebe Foto Humer Joachim Haslinger Michael Hägele ElectricArts GmbH Fotostudio Attersee o m a s T o p f YEARS OF INNOVATION OF YEARS Lenzing Aktiengesellschaft . 4860 Lenzing, Austria . Phone: +43 (0) 76 72 701-0 Fax: +43 (0) 76 72 701-38 80 . E-mail: o [email protected] . www.lenzing.com www.facebook.com/LenzingGroup www.lenzing.com Key Data of the Lenzing Group according to IFRS Business Results Financing Structure Net Gearing Sales compared to EBITDA EUR mn 2010 2011 20121 EUR mn 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 in % EUR Mn Sales EBITDA Sales 1,766.3 2,140.0 2,090.4 Cash and cash EBITDA 330.6 480.3 358.7 equivalents 305.6 499.6 528.8 60 2,500 500 EBITDA margin in % 18.7 22.4 17.2 Inventories 222.8 284.6 299.6 EBIT 231.9 364.0 255.0 Receivables 254.9 312.8 365.3 2,000 400 EBIT margin in % 13.1 17.0 12.2 Liabilities 591.8 639.5 604.4 480.3 Net financial debt3 307.2 153.3 346.3 40 EBT 216.9 351.9 246.4 358.71 2 3 1,500 300 Tax rate in % 18.5 24.0 22.1 Net -
Sicher Versorgt Mit Erdgas
Sicher versorgt mit Erdgas erdgas Sicher versorgt Der heimische Erdgasspezialist Energie AG Oberösterreich Power Solutions GmbH setzt auf langfristige Beziehun- gen zu unterschiedlichen Lieferanten, die Förderung aus oö. Erdgasfeldern und die Nutzung heimischer Erdgas-Speicher. Dies hat sich stets bewährt und die Ver- sorgungssicherheit der Erdgas-Kunden gewährleistet. Mit Erdgas immer sicher versorgt Österreich hat als erstes westeuropäisches Land vor rund 60 Jahren einen langfristigen Gasbezugsvertrag mit Russ- land geschlossen. Aufgrund unserer wirtschaftlichen Ver- flechtungen hat sich Russland stets als zuverlässiger Partner erwiesen. Kontinuierliche Lieferungen der russischen Gaz- prom versorgen seit 1968 Österreich und weite Teile Europas. Zusätzliche Sicherheit bringt die Diversifikation der Beschaf- fung durch Verträge mit mehreren Lieferanten, unter ande- rem von Unternehmen mit österreichischer Produktion. Dadurch maximiert sich die Verlässlichkeit der Lieferungen. Außerdem nutzen wir Speicher, die von der RAG und OMV im Salzkammergut und im Wiener Becken betrieben wer- den. Selbst wenn Lieferungen von einem Produzenten ausfallen sollten, ist die Versorgung der von uns versorgten Haushalte und Gewerbebetriebe noch über mehrere Mo- nate gewährleistet. Außerdem ist Österreich federführend bei der Planung zusätzlicher Erdgas-Logistik-Projekte. So ist die europäische Versorgungssicherheit fest in österrei- chischer Hand. Mit diesen Maßnahmen nehmen wir unsere Verpflichtung zur Erfüllung der Versorgungsstandards gemäß EU-Verordnung -

Pfarrblatt Der Pfarre Aurach Am Hongar, Ausgabe 1/07
Amtliche Mitteilung Zugestellt durch Post.at Ausgabe Pfarrblatt 3/19 der Pfarre Aurach am Hongar Ausgabe 3/19 Pfarrblatt Aurach am Hongar Worte des Pfarrers Ich kehre zurück zum ersten „So sehr hast du die Welt geliebt, Punkt: Weihnachten ist das Fest heiliger Vater, dass du deinen der Liebe, genauer: das Fest der eingeborenen Sohn als Retter Liebe Gottes. Den ersten Schritt gesandt hast, nachdem die Fül- macht Gott – er wird Mensch. le der Zeiten gekommen war. Er Nicht weil es so sein musste, oder ist Mensch geworden durch den weil es in der Vorsehung so vor- Heiligen Geist, geboren von der gesehen war, sondern weil Gott Jungfrau Maria. Er hat wie wir als uns Menschen liebt: Weihnach- Mensch gelebt, …“ (4. Hochge- ten ein Liebesakt Gottes! bet). Liebe Pfarrangehörige! Die Geburt Jesu zeigt weiter auf, So feiern wir ein Fest des Glau- dass Gott Vertrauen hat zu uns bens, das Fest der Liebe Gottes Was ist Weihnachten? Menschen. zu uns Menschen. Er vertraut seinen Sohn den Men- Weil Gott uns zuerst beschenkt Fest der Liebe schen an: einem Bauhandwerker hat, beschenken auch wir uns an Fest der Freude und seiner jungen Verlobten. Es diesem Fest der Liebe. Fest des Schenkens geht zwar zunächst ziemlich tur- Fest der Familie bulent zu (Jungfrauenzeugung, Ich wünsche allen ein gesegnetes adventlich/weihnachtliche Musik Geburt auf der Reise in einem und friedvolles Weihnachtsfest. Überforderung Stall, bald darauf die Flucht nach Weihnachtsstress Ägypten, …) – die Engel Gottes Stimmung, haben viel zu tun – dennoch: das Johann Ortner, Pfarrprovisor Glühwein, Vertrauen Gottes in die Men- (Kinder)mette schen ist da! Christbaum, Krippe, …… Die Kirche formuliert dies alles in einem Gebet: Bestattung Hauser - neue Generation und Aurach am Hon- gar übernommen. -

Frohe Ostern Und Ein Baldiges Ende Der Pandemie Wünschen Euch Die ÖVP Berg Und Bürgermeister Ernst Pachler 1 Berger Gemeindeblatt – März 2021
www.berg-attergau.ooevp.at April 2021 Das Ei als Symbol der Auferstehung und des Lebens Frohe Ostern und ein baldiges Ende der Pandemie wünschen Euch die ÖVP Berg und Bürgermeister Ernst Pachler 1 Berger Gemeindeblatt – März 2021 Chronik Wir gratulieren Johann Nini aus Pössing zum 80. Geburtstag und Paul Haas aus Eggenberg zum 85. Geburtstag. Die Wünsche überbrachten die Gemeindeführung mit Bürgermeister Ernst Pachler. Die Gemeindevertretung überbrachte auch die Gratulationswünsche zum 85. Geburtstag den beiden Frauen Franziska Staufer in Thanham und Maria König in Jedlham. In beiden Fällen gratulierte auch der Bauernbundobmann Christian Danter. Berger Gemeindeblatt – April 2021 2 Liebe Bergerinnen und Berger! Leider hat uns die Pandemie noch voll im Griff, niemand hätte vor einem Jahr noch gedacht, dass das Virus COVID 19 uns so lange beschäftigt, das jeden Einzelnen von uns vor eine große Herausforderung stellt. Ja, ich kann nachvollziehen, dass es uns schon schwer fällt an die Gesetzlichen Bestimmungen zu halten, aber halten wir durch, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Nach den Tagen des doch recht langen Winters, freuen wir uns auf die wärmenden Sonnenstrahlen und die neu erwachende Natur. Danke an all jene, die die Schneestangen wieder einsammeln und für den nächsten Winter lagern. Da der Buchberg für Wanderer ein beliebtes Ausflugsziel wurde, wird an der Zufahrt der Familie Resch in Berg ein neuer Parkplatz errichtet, danke an die Familie Resch für die zur Verfügung gestellte Fläche. Am Mittwoch, 24. März fand eine GR-Sitzung statt, bei der folgende Punkte behandelt wurden. Prüfung und Erledigung des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2020 Auftragsvergaben für die Generalsanierung des Gemeindeamtsgebäudes Ankauf eines Kleinlöschfahrzeuges KLF-A für die Freiwillige Feuerwehr Berg mit ca. -

Physiotherapeutinnen Ohne Vertrag 2021
HINWEIS: Diese Listen finden Sie auch auf unserer Homepage www.oegk.at (Vertragspartner-Service-Therapeutensuche) PhysiotherapeutInnen ohne Vertrag 2021 Wir erlauben uns Sie darauf hinzuweisen, dass Wahltherapeuten nicht verpflichtet sind uns Änderungen mitzuteilen und die Daten daher nicht immer den letzten Stand entsprechen. BRAUNAU Name Straße Ort TelefonNr. 2. TelefonNr. E-Mail Zusatzausbildungen HB weitere Informationen AUER Harald Braunauerstr. 17 4962 Mining 0664/73069927 [email protected] HB AUGUSTIN Barbara Hofstätterstr. 7 5274 Burgkirchen 0699/11876315 [email protected] MLD HB BARTH Christian Weilhartstraße 40 5121 Ostermiething 06278/7117 0179/1204601 [email protected] MLD BARTOSCH-DICK Ursula Auerbach 18 5222 Auerbach 07747/20030 Erwachsenenbobath HB BAUCHINGER Jürgen Salzburgerstr. 120 5280 Braunau 0676/4622327 [email protected] MLD nein BAUER Christian Leithen 12 4933 Wildenau 0680/3256602 [email protected] HB BEINHUNDNER Silvia Pischelsdorf 56 5233 Pischelsdorf 07742/7075 0650/6680212 [email protected] HB BREITENBERGER Christina Davidstraße 17 5145 Neukirchen 0650/9208214 [email protected] Erwachsenenbobath HB BURGSTALLER Christoph Straussweg 7 5211 Friedburg 0660/3160350 [email protected] HB CHRISTL Birgit Dr. Finsterer Weg 6/2 5252 Aspach 0664/9509960 [email protected] Erwachsenenbobath HB siehe auch Ried/I. DAXER Johannes Rieder Hauptstrasse 42 5212 Schneegattern 0677/63156023 [email protected] MLD, Bindegewebsmass. HB DEMM Tanja Mitterweg 1 5230 Mattighofen 0664/2119110 [email protected] Kinderbobath HB siehe auch Linz Stadt und in Neudorf 22 5231 Schalchen DENK Wiebke Mittererb 5 5211 Friedburg 07746/2795 MLD DENK Gertraud Aham 2 4963 St. Peter/Hart 07722/62666 DENK Daniela Kerschham 26 5221 Lochen 0680/2353433 [email protected] MLD HB siehe auch Ried/I. -

Vöcklabruck 58.085 Stk
Vöcklabruck 18.07.2018 / KW 29 / www.tips.at Tanzjugend Auch die jungen Tänzer des Steinbacher Gebirgstrachten- und Erhaltungsvereins D’Schobastoana wirkten beim Open-Air-Konzert im Rahmen des Gustav-Mahler-Festivals in Steinbach/A. mit. Seite 3 / Foto: M. Lauringer 58.085 Stk. | OÖ 674.842 Stk. | Gesamt 1.021.906 Stk. |Neuer Redaktion +43 (0)76 72 / 785 06 Stadtteil in Schwanenstadt Auf dem Areal der ehemaligen Joka-Fabrik entsteht ein neues Rollwandertag Kooperationspläne Stadtviertel – der Rainerpark. ORG half bei Wandertag des HTL Vöcklabruck und FACC Kürzlich erfolgte die Gleichen- Klara-Heims Vöcklabruck. >> Seite 4 arbeiten zusammen. >> Seite 16 FANTREFFEN feier beim künftigen Gesund- Eintritt frei Österreichische Post AG | RM 02A034590K | 4010 Linz age |Vöcklabruck Aufl Fuzo-Jubiläum Attersee-Grand-Prix heits- und Lifestylezentrum. Die 30 Jahre Fuzo in St. Georgen mit Segler hatten mit Wetterkapriolen Mittwoch, ehemalige Federnfabrik wurde Oldtimerparade gefeiert. >> Seite 8 zu kämpfen. >> Seite 37 25. JuLi bereits 2016 erfolgreich zu Büros 2018 und Wohnungen umgebaut. 2019 Gemeindestrategie Marktfest-Tipp soll mit dem Bau des Senioren- Gampern mit neuem kommunalen Auf Frankenburgs Straßen und heims begonnen werden. Seite 2 Management. >> Seite 10 Plätzen geht es rund. >> Seite 41 Landgasthaus Doppelmühle 4892 Fornach, Emming 13, 07682/5111 2 Regionales Land & Leute Vöcklabruck 29. Woche 2018 RaIneRPaRK Neuer Stadtteil in Schwanenstadt mit Fokus auf Gesundheit und Lifestyle SCHWanenStadt. In Schwa- in Szene gesetzt werden sollen. nenstadt entsteht ein neuer Thöni: „Wir setzen auf Video Stadtteil und in diesem befi ndet und Talk zu interessanten und sich ein absolutes Leuchtturm- aktuellen Themen mit großer projekt – das Gesundheits- und Reichweite.