CILIP 101-102.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 44. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Juni 2014 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4 Entschließungsantrag der Abgeordneten Caren Lay, Eva Bulling-Schröter, Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts - Drucksachen 18/1304, 18/1573, 18/1891 und 18/1901 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 575 Nicht abgegebene Stimmen: 56 Ja-Stimmen: 109 Nein-Stimmen: 465 Enthaltungen: 1 Ungültige: 0 Berlin, den 27.06.2014 Beginn: 10:58 Ende: 11:01 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Julia Bartz X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -

Migration, Integration, Asyl in Deutschland 2019
Migration, Integration, Asyl in Deutschland 2019 Politische und Rechtliche Entwicklungen Jährlicher Bericht der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) Forschung Kofinanziert durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union Migration, Integration, Asyl in Deutschland 2019 Politische und Rechtliche Entwicklungen Jährlicher Bericht der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2020 Das Europäische Migrationsnetzwerk 5 Das Europäische Migrationsnetzwerk Das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) wurde Im Rahmen des EMN wird in der Regel keine Primär- im Jahr 2003 von der Europäischen Kommission im forschung betrieben, sondern es werden bereits Auftrag des Europäischen Rates eingerichtet, um dem vorhandene Daten und Informationen aufbereitet Bedarf eines regelmäßigen Austausches von verläss- und analysiert; nur bei Bedarf werden diese durch lichen Informationen im Migrations- und Asylbereich eigenständige Erhebung von Daten und Informationen auf europäischer Ebene nachzukommen. Seit 2008 ergänzt. bildet die Ratsentscheidung 2008/381/EG die dauer- hafte Rechtsgrundlage des EMN, und es wurden natio- EMN-Studien werden nach einheitlichen Spezifika- nale Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten der Euro- tionen erstellt, um innerhalb der Europäischen Union päischen Union (mit Ausnahme Dänemarks, welches und Norwegens vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Beobachterstatus hat) und in Norwegen geschaffen. Um -
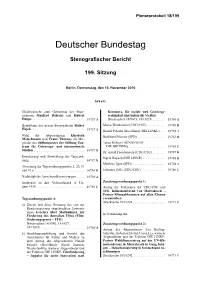
Plenarprotokoll 18/199
Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -

Rechtsterrorismus
2019 06 WISSEN SCHAFFT DEMOKRATIE SCHRIFTENREIHE DES INSTITUTS FÜR DEMOKRATIE UND ZIVILGESELLSCHAFT 1 TEIL I EINFÜHRUNG Katharina König-Preuss Matthias Quent, Samuel Salzborn Vorwort & Axel Salheiser 6 10 Einleitung Samuel Salzborn & Matthias Quent Warum wird rechtsextremer 18 Terror immer wieder unterschätzt? Empirische und theoretische Defizite statischer Perspektiven TEIL II GESCHICHTE UND KONTINUITÄT DES RECHTSTERRORISMUS IN DEUTSCHLAND Barbara Manthe Lukas Geck Ziele des westdeutschen Verdrängte Vergangenheit: Verfas- 30 Rechtsterrorismus vor 1990 40 sungsschutz und rechter Terror in den 1970er und 1980er Jahren in der BRD Isabella Greif & Fiona Schmidt Anja Thiele Vom Oktoberfestattentat bis zum 60 Antizionistische Allianzen: 50 Nationalsozialistischen Untergrund – das MfS und der westdeutsche Kontinuitäten in der Strafverfolgung Rechtsterrorismus von Rechtsterrorismus Sebastian Wehrhahn & Martina Renner Gabriele Fischer „Ermordet von Händen von „Wir sind doch so ein friedliches 72 Bösewichten“: der Mord an Shlomo 82 Dorf“ – Dynamiken der Entpoliti- Lewin und Frida Poeschke sierung rechtsextremer Gewaltver- brechen am Beispiel eines Mordes in Baden-Württemberg 1992 Mitat Özdemir & Matthias Quent „Sie denken, sie können in das Land 92 Deutschland nicht so viel Hoffnung setzen“ – Mitat Özdemir im Interview mit Matthias Quent TEIL III RECHTSTERRORISMUS: IDEOLOGIEN, STRATEGIEN UND NEUERE ENTWICKLUNGEN Jan Schedler Eike Sanders Rechtsterrorismus und rechte Normen im Ausnahmezustand. 104 Gewalt: Versuch einer Abgrenzung 118 Geschlechtlich -

Collusion Or Homegrown Collaboration?
Collusion or Homegrown Collaboration? Connections between German Far Right and Russia Marlene Laruelle Ellen Rivera April, 2019 TABLE OF CONTENTS Foreword ........................................................................................................................................ 3 Authors’ Bios .............................................................................................................................. 3 Executive Summary ....................................................................................................................... 4 Introduction ................................................................................................................................... 6 The AfD Ecosystem: Russia’s Pillar of Influence ........................................................................... 9 Russian Media Support for the AfD ........................................................................................ 12 Canvassing the Russian-German Minority ............................................................................. 15 Visits to Crimea and Donbas ................................................................................................... 16 The Echo Chambers Ecosystem: Peripherical Groups and Individuals....................................... 20 German Centre for Eurasian Studies ....................................................................................... 20 Analytical Media Eurasian Studies (AMES) ............................................................................ -

Migration, Integration, Asylum
www.ssoar.info Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2018 Grote, Janne; Lechner, Claudia; Graf, Johannes; Schührer, Susanne; Worbs, Susanne; Konar, Özlem; Kuntscher, Anja; Chwastek, Sandy Veröffentlichungsversion / Published Version Forschungsbericht / research report Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Grote, J., Lechner, C., Graf, J., Schührer, S., Worbs, S., Konar, Ö., ... Chwastek, S. (2019). Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2018. (Annual Policy Report / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl (FZ)). Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl (FZ); Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Nationale Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN). https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168- ssoar-68295-9 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. -

Plenarprotokoll 18/183
Plenarprotokoll 18/183 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 183. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 7. Juli 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Ab- Tagesordnungspunkt 5: geordneten Michael Schlecht und – Zweite und dritte Beratung des von der Gabriele Schmidt (Ühlingen) ........... 17977 A Bundesregierung eingebrachten Entwurfs Begrüßung des neuen Abgeordneten eines … Gesetzes zur Änderung des Karl-Heinz Wange. 17977 B Strafgesetzbuches – Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestim- Wahl des Abgeordneten Sören Bartol als mung stellvertretendes Mitglied des Vermittlungs- Drucksachen 18/8210, 18/8626, 18/8767 ausschusses. 17977 B Nr. 3, 18/9097 ..................... 17998 D Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- – Zweite und dritte Beratung des von nung. 17977 B den Abgeordneten Halina Wawzyniak, Absetzung der Tagesordnungspunkte 23 und Cornelia Möhring, Frank Tempel, weiteren 35. 17979 A Abgeordneten und der Fraktion DIE LIN- KE eingebrachten Entwurfs eines ... Straf- Begrüßung des Präsidenten der Nationalver- rechtsänderungsgesetzes zur Änderung sammlung der Islamischen Republik Pakistan, des Sexualstrafrechts (… StrÄndG) Herrn Sardar Ayaz Sadiq .............. 17979 B Drucksachen 18/7719, 18/9097 ........ 17998 D – Zweite und dritte Beratung des von den Tagesordnungspunkt 4: Abgeordneten Katja Keul, Ulle Schauws, Renate Künast, weiteren Abgeordneten und Abgabe einer Regierungserklärung durch die der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bundeskanzlerin: NATO-Gipfel am 8./9. Juli eingebrachten Entwurfs eines … Gesetzes 2016 in Warschau zur Änderung des Strafgesetzbuches zur Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin ...... 17979 C Verbesserung des Schutzes vor sexueller Dr. Sahra Wagenknecht (DIE LINKE) ..... 17983 C Misshandlung und Vergewaltigung Drucksachen 18/5384, 18/9097 ........ 17999 A Thomas Oppermann (SPD) .............. 17985 D Dr. Eva Högl (SPD) ................... 17999 A Dr. Anton Hofreiter (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) ..................... 17988 D Cornelia Möhring (DIE LINKE) ........ -

Plenarprotokoll 19/167
Plenarprotokoll 19/167 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 167. Sitzung Berlin, Freitag, den 19. Juni 2020 Inhalt: Tagesordnungspunkt 26: Zusatzpunkt 25: a) Erste Beratung des von den Fraktionen der Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD eingebrachten Ent- CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurfs wurfs eines Zweiten Gesetzes zur Umset- eines Gesetzes über begleitende Maßnah- zung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur men zur Umsetzung des Konjunktur- und Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Krisenbewältigungspakets Corona-Steuerhilfegesetz) Drucksache 19/20057 . 20873 D Drucksache 19/20058 . 20873 B in Verbindung mit b) Erste Beratung des von der Bundesregie- rung eingebrachten Entwurfs eines Zwei- ten Gesetzes über die Feststellung eines Zusatzpunkt 26: Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und für das Haushaltsjahr 2020 (Zweites SPD: Beschluss des Bundestages gemäß Ar- Nachtragshaushaltsgesetz 2020) tikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grund- Drucksache 19/20000 . 20873 B gesetzes Drucksache 19/20128 . 20874 A c) Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Marc Bernhard, Jürgen Braun, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD: in Verbindung mit Arbeitnehmer, Kleinunternehmer, Frei- berufler, Landwirte und Solo-Selbstän- Zusatzpunkt 27: dige aus der Corona-Steuerfalle befreien Antrag der Abgeordneten Dr. Dirk Spaniel, und gleichzeitig Bürokratie abbauen Wolfgang Wiehle, Leif-Erik Holm, weiterer Drucksache 19/20071 . 20873 C Abgeordneter und der Fraktion der AfD: d) Antrag der Abgeordneten Caren Lay, Deutscher Automobilindustrie zeitnah hel- Simone Barrientos, Dr. Gesine Lötzsch, fen, Bahnrettung statt Konzernrettung, Be- weiterer Abgeordneter und der Fraktion richte des Bundesrechnungshofs auch in DIE LINKE: Clubs und Festivals über der Krise beachten und umsetzen die Corona-Krise retten Drucksache 19/20072 . -

Protokoll 108 I.Pdf
Stenografisches Protokoll 108 I 18. Wahlperiode 1. Untersuchungsausschuss nach Artikel 44 des Grundgesetzes Nur zur dienstlichen Verwendung Stenografisches Protokoll der 108. Sitzung - endgültige Fassung* - 1. Untersuchungsausschuss Berlin, den 8. September 2016, 11.30 Uhr Paul-Löbe-Haus, Europasaal (4.900) 10557 Berlin, Konrad-Adenauer-Str. 1 Vorsitz: Prof. Dr. Patrick Sensburg, MdB Tagesordnung - Öffentliche Beweisaufnahme Tagesordnungspunkt Öffentliche Anhörung von Sachverständigen - Timothy H. Edgar, Watson Institute - Ashley Gorski, ACLU, National Security Project - Dr. Morton H. Halperin, Open Society Foundations - Dr. Christopher Soghoian, ACLU, Principal Technologist - Amie Stepanovich, Access Now, U.S. Policy Manager _________ * Hinweis: Die Korrekturen und Anmerkungen der Sachverständigen Amie Stepanovich sind im Protokoll eingefügt. (siehe Anlage 1) Die Sachverständigen Edgar, Gorski, Halperin und Soghoin haben keine Korrekturen übermittelt. 18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst/Sprachendienst Seite 1 von 133 Stenografisches Protokoll 108 I 1. Untersuchungsausschuss Nur zur dienstlichen Verwendung Mitglieder des Ausschusses Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder CDU/CSU Sensburg, Prof. Dr. Patrick Marschall, Matern von Lindholz, Andrea Ostermann, Tim, Dr. Schipanski, Tankred Wendt, Marian Warken, Nina SPD Flisek, Christian Zimmermann, Jens, Dr. Mittag, Susanne DIE LINKE. Renner, Martina Hahn, André, Dr. BÜNDNIS 90/DIE Notz, Dr. Konstantin von Ströbele, Hans-Christian GRÜNEN Fraktionsmitarbeiter CDU/CSU Feser, Andreas, Dr. Bredow, Lippold von Fischer, Sebastian D. Kordon, David Puglisi, Livia Schrot, Jacob Allers, Fried-Heye SPD Heyer,Christian Ahlefeldt, Johannes von Dähne, Dr. Harald Etzkorn, Irene Hanke, Christian-Diego Haupt, Philip Kilimann, Cecilia Weiß, Benjamin DIE LINKE. Halbroth, Anneke BÜNDNIS 90/DIE Kant, Martina GRÜNEN Leopold, Nils Pohl, Jörn 18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst/Sprachendienst Seite 2 von 133 Stenografisches Protokoll 108 I 1. -
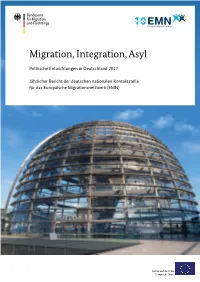
Migration, Integration, Asyl
J A H R E Europäisches Migrationsnetzwerk Migration, Integration, Asyl Politische Entwicklungen in Deutschland 2017 Jährlicher Bericht der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) Kofinanziert durch die Europäische Union Migration, Integration, Asyl Politische Entwicklungen in Deutschland 2017 Jährlicher Bericht der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2018 Zusammenfassung 5 Zusammenfassung Der vorliegende Politikbericht 2017 bietet einen Rückkehrmaßnahmen, die Einstufung der Magh‑ Überblick über die wichtigsten politischen Dis‑ reb‑Staaten als sichere Herkunftsstaaten sowie die kussionen sowie politischen, legislativen und in‑ Altersfeststellung bei unbegleiteten Minderjährigen stitutionellen Entwicklungen des Jahres 2017 im (zu den rechtlichen Änderungen siehe die Infobox Migrations‑, Integrations‑ und Asylbereich in am Ende der Zusammenfassung). Deutschland. Er beleuchtet Veränderungen in der allgemeinen Struktur des politischen Systems, z. B. Die Erwerbsmigration und sonstige legale Zuwande‑ durch Wahlen und institutionelle Neugründun‑ rung stand unter dem Vorzeichen einer sich ins‑ gen und Weiterentwicklungen. Daneben werden gesamt positiv entwickelnden Arbeitsmarktlage in die Themenfelder legale Migration, internationa‑ Deutschland, die sowohl einen deutlichen Anstieg ler Schutz und Asyl, unbegleitete Minderjährige der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung als und weitere besonders Schutzbedürftige, Integra‑ -

Annual Report 2006|2007
Rosa Luxemburg Foundation ANNUAL REPORT 2006|2007 US_GB_engl.indd 1 12.02.2008 16:26:55 Uhr Rosa Luxemburg Next to Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg was the most important representative of left-wing socialist, antimilitaristic, and internationalist positions in the German Social Democratic Party (SPD) before 1918. She was a passionate and convincing critic of capitalism as well as anti-democratic and dicta- torial tendencies within the Bolsheviki. She confronted the compelling logic of economical laws and political strategies with the utopia of a new world. According to Luxemburg, this new world needed to be created in spite of widespread despair, deprivation of rights, cowardliness and the corruption of power. Born on March 5th, 1871, Rosa Luxemburg, a Polish Jew and participant in the Russian Revolution of 1905, was a co-founder of the Social Democratic Party in the Kingdom of Poland and Lithuania. Rosa Luxemburg was a leading theorist of the German SPD’s left wing. She had a crucial role in the formation of the Spartacus League, the Independent Social-Democratic Party (USPD), and the German Communist Party (KPD) during World War I and the November Revolution. Her fate cannot be separated from the splitting in the German labor movement. Irreconcilable differences developed between the movement‘s different currents, leading to serious consequences. On January 15th, 1919, Rosa Luxemburg was murdered by the same circles of the militarist Volunteer Corps that later openly supported the National Socialists’ seizure of power. Impressively, Rosa Luxemburg combined political commitment, scientific analysis, and the quest for empowerment as a woman. She saw herself as being in conflict, fighting both on a scientific and political level and her everyday life was always essential to her. -

Islamist Terrorism in Germany: Threats, Responses, and the Need for a Strategy
66 AICGSPOLICYREPORT ISLAMIST TERRORISM IN GERMANY: THREATS, RESPONSES, AND THE NEED FOR A STRATEGY Guido Steinberg AMERICAN INSTITUTE FOR CONTEMPORARY GERMAN STUDIES THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY TABLE OF CONTENTS Foreword 3 About the Author 5 The American Institute for Contemporary German Studies strengthens the German-American rela- tionship in an evolving Europe and changing world. Executive Summary 7 The Institute produces objective and original analyses of developments and trends in Germany, Europe, and the United States; creates new Introduction 9 transatlantic networks; and facilitates dialogue among the business, political, and academic communities to manage differences and define and Nature and Scope of Threat 11 promote common interests. ©2017 by the American Institute for Contemporary German Studies Government Responses 18 ISBN 978-1-933942-61-2 Domestic Security and the United States 22 ADDITIONAL COPIES: Additional Copies of this Policy Report are available for $10.00 to cover postage and handling from Elements of a Strategy 25 the American Institute for Contemporary German Studies, 1755 Massachusetts Avenue, NW, Suite 700, Washington, DC 20036. Tel: 202/332-9312, Notes 28 Fax 202/265-9531, E-mail: [email protected] Please consult our website for a list of online publications: http://www.aicgs.org The views expressed in this publication are those of the author(s) alone. They do not necessarily reflect the views of the American Institute for Contemporary German Studies. Support for this publication was generously provided by ISLAMIST TERRORISM IN GERMANY FOREWORD One year after Germany’s largest jihadist terrorist attack, and only two years after Angela Merkel’s deci- sion to open the country’s borders to nearly a million refugees and asylum-seekers, German policymakers are still struggling with how to maintain security and privacy within a federal system.