Und Forstwirtschaft Seite 22
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jahrgang Hannover, Den 20. 5. 2009 Nummer 20
5324 59. (64.) Jahrgang Hannover, den 20. 5. 2009 Nummer 20 I N H A L T A. Staatskanzlei Bek. 29. 4. 2009, Aufhebung der evangelisch-lutherischen Kapellengemeinden Dohnsen, Linse und Tuchtfeld in der B. Ministerium für Inneres, Sport und Integration Evangelisch-lutherischen St.-Petri-Kirchengemeinde Halle und Umbenennung der Kirchengemeinde (Kirchenkreis Bek. 4. 5. 2009, Verleihung der Bezeichnung „Hansestadt“ Holzminden-Bodenwerder) . 487 an die Stadt Stade . 484 Bek. 29. 4. 2009, Zusammenlegung der evangelisch-lutheri- Bek. 4. 5. 2009, Anerkennung der Förderstiftung MHH schen Kirchengemeinden Fredelsloh, Großenrode und PLUS . 484 Moringen sowie der evangelisch-lutherischen Kapellenge- Bek. 4. 5. 2009, Anerkennung der Nina.Dieckmann-Stif- meinden Espol, Lutterbeck, Nienhagen, Oldenrode und tung . 484 Schnedinghausen (Kirchenkreis Leine-Solling) . 487 Bek. 7. 5. 2009, Anerkennung der Stiftung Gut Adolphshof 484 Bek. 29. 4. 2009, Zusammenlegung der evangelisch-lutheri- schen Kirchengemeinden Fürstenberg, Derental und Mein- C. Finanzministerium brexen (Kirchenkreis Holzminden-Bodenwerder) . 488 Bek. 29. 4. 2009, Zusammenlegung der evangelisch-lutheri- schen Kirchengemeinden Hehlen und Hohe (Kirchenkreis D. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit Holzminden-Bodenwerder) . 489 Beschl. 5. 5. 2009, Zusätzliches Investitionsprogramm für Bek. 29. 4. 2009, Aufhebung der Evangelisch-lutherischen Krankenhausbaumaßnahmen im Rahmen der „Initiative Kapellengemeinde Lichtenhagen in der Evangelisch-luthe- Niedersachsen“ . 484 rischen Liebfrauen-Kirchengemeinde Ottenstein und Um- benennung der Kirchengemeinde (Kirchenkreis Holzmin- E. Ministerium für Wissenschaft und Kultur den-Bodenwerder) . 489 Bek. 29. 4. 2009, Aufhebung der Evangelisch-lutherischen F. Kultusministerium Kapellengemeinde Mühlenberg in der Evangelisch-lutheri- schen St.-Pauli-Kirchengemeinde Holzminden (Kirchen- kreis Holzminden-Bodenwerder) . 489 G. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Bek. 29. 4. 2009, Zusammenlegung der evangelisch-luthe- Erl. -

16/19/KT Bekanntmachung
Amtsblatt für den Landkreis Northeim Jahrgang 2019 Northeim, den 21.06.2019 Nr. 25 Inhalt: A. Amtliche Bekanntmachungen des Landkreises Bekanntmachung der Sitzung des Kreistages am 28.06.2019 Verordnung über das Naturschutzgebiet „Moore und Wälder im Hochsolling, Hellental“ (HA 149) in den Landkreisen Holzminden und Northeim vom 18.03.2019 B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden ./. C. Amtliche Bekanntmachung anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts Abwasserverband Espolde Haushaltssatzung 2019 _____________________________________________________________________ Herausgeber: Landkreis Northeim, Medenheimer Str. 6 –8, 37154 Northeim Erscheint grundsätzlich jeden Freitag (außer feiertags), Redaktionsschluss ist jeweils donnerstags 16.00 Uhr Auskunft, Einsichtnahme und Einzelexemplare: Referat 2 – Personal und Finanzen Tel. 05551-708-366, E-Mail: [email protected]. Das Amtsblatt kann auf der Internetseite www.landkreis-northeim.de kostenlos eingesehen werden. Amtsblatt des Landkreises Northeim Nr. 25 vom 21.06.2019 Landkreis Northeim Die Landrätin Öffentliche Bekanntmachung Es findet eine Sitzung des Kreistages am Freitag, 28.06.2019 um 15:00 Uhr, im Sitzungssaal, Medenheimer Straße 6/8, 37154 Northeim statt. Tagesordnung: Drs. Nr. Titel 1 Eröffnung der Sitzung 2 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit 3 Feststellung der Tagesordnung 0845/19 4 Feststellung der Voraussetzungen für Sitzverluste im Kreistag gemäß § 52 NKomVG 0846/19 5 Einführung und Verpflichtung des Kreistagsabgeordneten Claus Stumpe und der Kreistagsabgeordneten Elisabeth Behrens 0847/19 6 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Kreistages am 24.05.2019 7 Bericht über wichtige Beschlüsse des Kreisausschusses und über andere wichtige Angelegenheiten 8 Einwohnerfragestunde 727/19 9 Neuwahl des Kreisbrandmeisters 732/19 10 Ernennung des ausscheidenden Kreisbrandmeisters Bernd Kühle zum Ehrenkreisbrandmeister 0841/19 11 A. -

Geologischen Karte
{was 5%„47 ._ „_v _..__. ‚äg— I l l J Erläuterungen ll' Geologischen Karte V011 Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 127. wemmummg—.-. Blatt Lnuenheru. .. __—._ Gradabteilung 55, N0. 15. pw__.„._.._.__ ‚- w - BERLIN. Im Vertrieb bei der Königl. Preuß. Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, l Berlin N 4, Invalidenstraße 44. l l l I 1906. d g’ä' ‘xKaaaaaaaaaaaaaaaa König]. Universitäts- Bibliothek zu Göttingen. Geschenk ä dess.Kgl Ministeriums der geistlichen, Unterrichts— und Med. Ü] m zu Ber iAngelegenheiten aaaaaaäi m 194;..... l _LaaaaaaaaaaaaaaaaaLiga EIBIJOTHEGA in” MMUAUEMIAE Blatt Lauenbe‘rg‘. 52 Gradabteilung 55 (Breitem Länge 27° 128 °), Blatt N0. 15. 51° Geognostisch bearbeitet durch A. von Koenen, 0. Grupe und M. Schmidt 1898—1902. Erläutert durch A. VON KOENEN. ‚.._ _ 0.......“ Das Blatt Lauenberg enthält noch den südlichsten Teil des Einbeck-Markoldendorfer Beckens, welches im Süden begrenzt wird von den Bergrücken der Forst Grubenhagen mit der Ahls- burg und dem Ellenser Walde mit "seinen Ausläufern. Südlich von jener liegt das nördliche Ende der Weper, welche sich von hier nach Süden bis Hardegsen und Fehrlingsen erstreckt und von der Ahlsburg nur durch flache Einsenkungen und. die Berg- rücken nordöstlich von Fredelsloh getrennt wird. Den größeren Rest des Blattes nimmt der östliche Teil des‘Solling ein, ein aus— gedehntes Waldgebirge mit mehr oder minder ebenen Hoch— flächen, welche durch zahlreiche tiefe Täler und Schluchten un— regelmäßig zerschnitten Werden und im Südwesten sich bis zu 49] m erheben, Während die Ahlsburg auf dem Blatt nur 411 m erreicht, und die Weper nur 369 m. -

Staffeleinteilungen Und –Zuständigkeiten Saison 2019/2020
Staffeleinteilungen und –zuständigkeiten Saison 2019/2020 Jugendausschuss Die A-Jugend spielt mit 8 Mannschaften und die B-Jugend mit 10 Teams eine „normale“ Runde mit Hin- und Rückspielen. (Zusatz-Anmerkung hierzu: Auf dem Jugendfußballtag wurde noch eine dreifache Runde für die A-Jugend angekündigt. Seinerzeit waren es aber „nur“ 7 Teams. Durch eine Abmeldung einer B und gleichzeitiger Nachmeldung einer A-Jugend eines Vereins sind es nunmehr 8 A-Jugendmannschaften, was an sich erfreulich ist. Gleichzeitig ist dadurch aber keine Mannschaft an einem Spieltag spielfrei. Hierdurch waren diverse Spielfreiwünsche der Vereine so nicht mehr umsetzbar. Neben den an sich bei einer dreifachen Runde vorgesehenen drei Spieltagen in der Woche hätte es vermutlich noch mehr Verlegungen geben müssen. Weiterhin hätte auch das Wetter mitspielen müssen. Um dieser Terminenge zu entgehen und etwas mehr Luft für alle Teams und Terminwünsche zu haben, wird auch in der A-Jugend nur eine „normale“ Serie mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Statt vormals 18 Spielen pro Team sind es jetzt dadurch 14 Spiele zzgl. dem Pokal. In der B-Jugend bleibt es bei der Runde mit Hin- und Rückspielen.) In den Altersklassen der C-, D-, E- und F-Jugend werden für die Rückrunde neue Staffelleinteilungen vorgenommen, wobei sich die Einteilungen für die Kreisliga/-klasse bei der D- und E-Jugend entsprechend der Herbststaffeln 2019 und der gültigen Ausschreibung ergeben wird. Auch in der F-Jugend wird eine Neueinteilung erfolgen, bei der G-Jugend findet erneut ein reiner Turnierspielbetrieb statt. Weitere Informationen zur G-Jugend werden noch gesondert mitgeteilt. Für einen „besseren“ Überblick werden nachstehend die Einteilungen der C-, D-, E- und F-Jugend auf einen Blick dargestellt. -
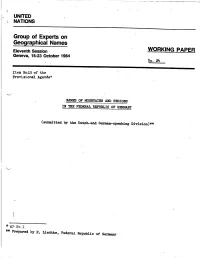
Group of Experts on Geographical Names Z Te^ WORKING PAPER
UNITED NATIONS Group of Experts on Geographical Names ZElevent Teh Sessio^ n WORKING PAPER Geneva, 15-23 October 1984 No. 2U Item NoJ.5 of the Provisional Agenda* . NAMES OF MQUITTAINS AND REGIONS IH THE FEDERAL REPUBLIC OP GERMAHY (submitted by the Butciv-and German-speaking Division)** •* W? Ifo. I ** Prepared by H. Liedtke, Federal Republic of Germany - 2 - GEOGRAPHICAL NAMES IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ACCORDING TO THE OFFICIAL GENERAL MAP (UBERSICHTSKARTE) 1:500,000, WORLD MAP SERIE 1404. Compiled by the Permanent Committee on Geographical -Names in the Federal Republic of Germany and prepared for publication by its chairman Prof. Dr. Herbert Liedtke, Geography Department, Ruhr-University, Bochum. Frankfurt am Main May 1984 Adresses; Standiger AusschuB fur Geographische Namen (Permanent Committee on Geographical Names) Institut fiir Angewandte Geodasie Richard-StrauB-Allee 11 D 6000 Frankfurt am Main Prof. Dr. H. Liedtke Ruhr-Universitac Bochum Geographisches Institut Postfach 102148 D 4630 Bochum HOW TO USE THE LIST OF GEOGRAPHICAL NAMES Alphabetical order; A a, A a H h Q o, 6 o U u, U ii B b I i Pp V v Co" J j Q q W w Dd Kk R r • X x Ee LI S s Y y F f . Mm T t Z z G g N n Annotation: A a, Q a £ U ii are handled as a, o & u. 3 can be handled as ss. Examples;_ Breisgau; Underlined names are printed in the Ubersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:500 000. Abteiland: Names not underlined are not printed in the above-mentioned map but are hereby recommended for consideration in a new edition. -

Fachbeitrag Zur Aktualisierung Ausgewählter LRP-Schutzgüter
Fachbeitrag zur Aktualisierung ausgewählter LRP-Schutzgüter – Landkreis Northeim – Teilbericht Landschaftsbewertung Stand 30.06.2020 Auftragnehmer: Planungsgruppe Umwelt Stiftstraße 12, D-30159 Hannover Tel.: 0511/ 51 94 97 80 Fax: 0511/ 51 94 97 83 e-mail: [email protected] Bearbeitung: Dipl. Ing. Holger Runge M. Sc. Janna-Edna Bartels Auftraggeber: Landkreis Northeim Fachbereich 44 – Regionalplanung und Umweltschutz Medenheimer Straße 6/8 | 37154 Northeim Tel.: 05551 708-193 Tatiana Fahlbusch PLANUNGSGRUPPE UMWELT Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung und Anlass ................................................................................ 5 2 Untersuchungsgebiet ................................................................................. 6 3 Landschaftsbewertung .............................................................................. 8 3.1 Rechtliche Grundlagen ................................................................................. 8 3.2 Methodisches Vorgehen - Erfassung ............................................................ 9 3.2.1 Landschaftstypen ......................................................................................... 9 3.2.2 Erlebniswirksame Einzelelemente .............................................................. 12 3.2.3 Beeinträchtigungen .................................................................................... 12 3.3 Methodisches Vorgehen - Bewertung ......................................................... 12 3.3.1 Bewertung der Landschaftstypen .............................................................. -

37181 Hardegsen
Stadt Hardegsen · Das Tor zum Solling Tor · Das Stadt Hardegsen be Bürgerinnen und Bürger! Herzlich willkommen Neubürgerin oder Neubürger in im staatlich anerkannten Luftkurort erer Stadt begrüße ich Sie herzlich d wünsche Ihnen ein schnelles Ein- en in die örtliche Gemeinschaft. Hardegsen Erleichterung und zum Eingewöh- dem Tor zum Solling in Ihrer neuen Umgebung haben mit den Ortschaften für Sie diese Informationsschrift als entierungshilfe zusammengestellt. Asche, Ellierode, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ertinghausen, Espol, Verwaltung stehen Ihnen gern zur Gladebeck, Hettensen, fügung, wenn Sie weitere Auskünf- Hevensen, Lichtenborn, nd Hilfen benötigen. Lutterhausen, Trögen Üssinghausen wünsche, daß Hardegsen für Sie h mehr als nur ein Wohnort wird! freundlichem Gruß ts germeister 1 Damit endete für Hardegsen die Zeit des Zur Lage und Geschichte blühenden Handwerks. Die folgenden Jahrhun- derte brachten einen wirtschaftlichen Nieder- der Stadt Hardegsen gang der Stadt, der erst Ende des vorigen Jahr- hunderts gestoppt werden konnte. In den Jahren 1875 – 1878 bekam Hardegsen durch den Bau Am Südostrand des Sollings liegt Hardegsen in andere Bezeichnung für den Palas, das Haupt- der Bahnstrecke Northeim – Ottbergen einem Talkessel, umgeben von bewaldeten wohnhaus der Burg. Anschluß an die „Neuzeit“. Das 1897 zunächst Höhenzügen. Südlich erstreckt sich der Gla- Fast 200 Jahre war die Burg Sommerresidenz als Kalkwerk gegründete Zementwerk gehört deberg (278 m), im Osten verwehrt der 266 m der Welfenherzöge. heute zur Nordcement AG mit Firmensitz in hohe Galgenberg den Blick in die Ferne, im Die St. Mauritiuskirche ist im Jahre 1423 auf Hannover. Leider schließt es 1997 die Tore. Norden begrenzt der Höhenzug der Weper das Initiative der Herzogin Margarete vollendet Weitere Betriebe – vor allem in der Holz- und Tal, während in westlicher Richtung die Ausläu- worden. -

Erhalt Der Biodiversität Von Kormophyten in Niedersachsen Und Bremen: Datengrundlagen, Prioritätensetzung Und Artenschutzmaßnahmen
Erhalt der Biodiversität von Kormophyten in Niedersachsen und Bremen: Datengrundlagen, Prioritätensetzung und Artenschutzmaßnahmen Von der Fakultät für Architektur und Landschaft der Universität Hannover zur Erlangung des Grades eines Doktors der Ingenieurwissenschaften Dr.-Ing. genehmigte kumulative Dissertation von Dipl.-Biol. Eckhard Garve geboren am 8.12.1954 in Celle 2005 Referent: Prof. Dr. Rüdiger Prasse Korreferent: Prof. Dr. Michael Reich Tag der Promotion: 06.12.2005 Erhalt der Biodiversität von Kormophyten in Niedersachsen und Bremen Seite 3 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................ 6 Tabellenverzeichnis ............................................................................................................. 7 Zusammenfassung .............................................................................................................. 9 Summary ............................................................................................................................ 12 Kapitel 1 – Einleitung ........................................................................................................ 15 1.1 Grundlagen, Ziele und Fragestellung................................................................... 15 1.2 Entwicklung der floristischen Erforschung ........................................................... 18 Kapitel 2 – Methodik ......................................................................................................... -

Datenblätter Wildkatzenwege Northeim V2
Dörfer 2018: Wildkatzenwege im Landkreis Northeim. Im Auftrag der Kreisgruppe Northeim des 1 Datenblätter Die folgenden Datenblätter enthalten zu jedem Korridor: • eine stichwortartige Beschreibung des Korridors, • eine Tabelle der Bewertungsparameter, • eine Kurzbeschreibung wichtiger Maßnahmen, • eine Übersichtskarte* mit Suchraum, • einen Luftbildausschnitt mit Markierung der wichtigen bereits vorhandenen Vernetzungselemente. Die Bewertungsparameter sind im Kapitel 2.4 erläutert. Eine Zusammenfassung sämtlicher Daten aller Korridore finden sich in Tabelle 3 des Gutachtens. Dort findet sich auch eine Legende zu den nachfolgenden Tabellen. Hilfreich für das Verständnis der Vernetzung sind die Abb. 3 (Wälder, Straßen, landwirtschaftliche Räume und Siedlungen mit Nummerierung der Räume), Abb. 8 (Wildkatzenwege des BUND) und Abb. 10 (Lage der Korridore). Die Räume der Abb. 3 werden in der Beschreibung nur dann erwähnt, wenn der beschriebene Korridor mindestens zwei Räume miteinander verbindet, die BUND-Wildkatzenwege nur dann, wenn er Teil eines solchen Weges ist. Der „Suchraum“ umfasst den Raum, in dem bereits vernetzende Elemente vorhanden sind oder der von seiner Lage her am günstigsten für deren Anlage ist. Die Nummerierung der Korridore erfolgte willkürlich nach der Reihenfolge der Bearbeitung. Zum Auffinden der Korridore in Karten oder Internetkarten sind außerdem Koordinaten aus dem zentralen Bereich des jeweiligen Korridors angegeben. Sie beziehen sich auf das Referenzsystem WGS84 und können z.B. in die Suchfelder von Google-Maps oder Google Earth eingegeben werden. Sie sind nicht verwendbar für die alten topografischen Karten, die sich auf das Potsdam-Datum beziehen. Diverse kostenlose Koordinaten- Umrechnungssysteme finden sich im Internet. *Kartengrundlage: TOP50 des LGLN, Karten 1: 50.000, bei ausgedehnten Korridoren 1:200.000 Sämtliche Luftaufnahmen wurden erstellt und digital bearbeitet von Dörfer 2018: Wildkatzenwege im Landkreis Northeim. -

L 11 Journal Officiel
ISSN 1977-0693 Journal officiel L 11 de l’Union européenne e 55 année Édition de langue française Législation 13 janvier 2012 Sommaire II Actes non législatifs DÉCISIONS 2012/13/UE: ★ Décision d’exécution de la Commission du 18 novembre 2011 arrêtant une cinquième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique [notifiée sous le numéro C(2011) 8203] . 1 2012/14/UE: ★ Décision d’exécution de la Commission du 18 novembre 2011 arrêtant une cinquième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique continentale [notifiée sous le numéro C(2011) 8278] . 105 Prix: 10 EUR Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. FR 13.1.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 11/1 II (Actes non législatifs) DÉCISIONS DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 18 novembre 2011 arrêtant une cinquième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique [notifiée sous le numéro C(2011) 8203] (2012/13/UE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, 92/43/CEE ont été arrêtées respectivement par les déci sions de la Commission 2004/813/CE ( 2 ), 2008/23/CE ( 3 ), 2009/96/CE ( 4), 2010/43/UE ( 5) et 2011/63/UE ( 6). Conformément à l’article 4, paragraphe vu le traité sur le fonctionnement -

Stadt Moringen Unter Der Internet-Adresse: Heike Müller-O�E Bürgermeisterin
Stadt Moringen Behrensen Moringen Thüdinghausen Blankenhagen Oldenrode Fredelsloh Nienhagen Großenrode Lutterbeck BÜRGERBROSCHÜRE Grußwort Herzlich Willkommen in Moringen Liebe Mitbürgerinnen, Mitbürger und Gäste, Sie halten die neue Informaonsbroschüre für Moringen in den Händen. Ob als Nachschlagewerk, als Ratgeber oder einfach als interessante Lektüre, die Bürger- broschüre wird Ihnen bei vielen Fragen rund um das Leben in Moringen ein nützli- cher Helfer sein. Besonders alle neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie unse- re Gäste möchten wir mit dieser Broschüre herzlich willkommen heißen und neu- gierig machen unsere Stadt und alle acht Ortschaen kennen zu lernen. Sie finden wichge und nützliche Informaonen über unser Angebot an Kinderta- gesstäen, Schulen, kirchlichen und kulturellen Einrichtungen. Außerdem enthält die Broschüre Angaben zur Gesundheitsversorgung, zu Vereinen sowie ein Unter- kuns- und Gaststäenverzeichnis. Finden Sie darüber hinaus auf den folgenden Seiten für jedes Anliegen die richge Ansprechpartnerin oder den richgen Ansprechpartner in der Stadtverwal- tung und die Mitglieder der polischen Gremien. Mein besonderer Dank gilt allen Inse- renten, die den Druck dieser Publikaon ermöglicht haben. Sollten Sie weitere Fragen oder beson- dere Anliegen haben, stehen die Mitar- beiterinnen und Mitarbeiter der Stadt- verwaltung oder ich selbst Ihnen gern mit Auskünen und Hilfen zur Seite. Herzliche Grüße aus dem Rathaus Weitere aktuelle Informaonen finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Moringen unter der Internet-Adresse: -

20/19/KT Bekanntmachung
Amtsblatt für den Landkreis Northeim Jahrgang 2020 Northeim, den 19.02.2020 Nr. 7 Inhalt: A. Amtliche Bekanntmachungen des Landkreises Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Kreistages am 28.02.2020 Feststellung gemäß § 6 Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeits- prüfung (NUVPG) – Gewässerrenaturierung der Ilme unterhalb des ehemaligen Kultur- staus bis zur Mündung in die Leine; § 5 NUVPG (allgemeine Vorprüfung des Einzel- falls) B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden ./. C. Amtliche Bekanntmachung anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ./. _____________________________________________________________________ Herausgeber: Landkreis Northeim, Medenheimer Str. 6 –8, 37154 Northeim Erscheint grundsätzlich jeden Mittwoch (außer feiertags), Redaktionsschluss ist jeweils dienstags 16.00 Uhr Auskunft, Einsichtnahme und Einzelexemplare: Frau Keufner, Personalratsassistenz, Tel. 05551-708-238, E-Mail: [email protected]. Das Amtsblatt kann auf der Internetseite www.landkreis-northeim.de kostenlos eingesehen werden. Amtsblatt des Landkreises Northeim Nr. 7 vom 19.02.2020 Landkreis Northeim Die Landrätin Öffentliche Bekanntmachung Es findet eine Sitzung des Kreistages am Freitag, 28.02.2020 um 15:00 Uhr, in der Aula der KGS Moringen - Außenstelle Nörten-Hardenberg, An der Bünte 2, 37176 Nörten-Hardenberg statt. Tagesordnung: Drs. Nr. Titel 1 Eröffnung der Sitzung 2 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit 3 Feststellung der Tagesordnung