Geologischen Karte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Geogenic Organic Carbon in Terrestrial Sediments and Its Contribution to Total Soil Carbon
SOIL, 7, 347–362, 2021 https://doi.org/10.5194/soil-7-347-2021 © Author(s) 2021. This work is distributed under SOIL the Creative Commons Attribution 4.0 License. Geogenic organic carbon in terrestrial sediments and its contribution to total soil carbon Fabian Kalks1, Gabriel Noren2, Carsten W. Mueller3,4, Mirjam Helfrich1, Janet Rethemeyer2, and Axel Don1 1Thünen Institute of Climate-Smart Agriculture, Bundesallee 65, 38116 Braunschweig, Germany 2Institute of Geology and Mineralogy, University of Cologne, Institute of Geology and Mineralogy, Zülpicher Str. 49b, 50674 Cologne, Germany 3Chair of Soil Science, School of Life Sciences, Technical University of Munich, Emil-Ramann-Strasse 2, 85354 Freising-Weihenstephan, Germany 4Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Øster Voldgade 10, 1350 Copenhagen K, Denmark Correspondence: Fabian Kalks ([email protected]) Received: 19 May 2020 – Discussion started: 5 June 2020 Revised: 18 May 2021 – Accepted: 27 May 2021 – Published: 6 July 2021 Abstract. Geogenic organic carbon (GOC) from sedimentary rocks is an overlooked fraction in soils that has not yet been quantified but influences the composition, age, and stability of total organic carbon (OC) in soils. In this context, GOC is the OC in bedrock deposited during sedimentation. The contribution of GOC to total soil OC may vary, depending on the type of bedrock. However, no studies have been carried out to investigate the contribution of GOC derived from different terrestrial sedimentary rocks to soil OC contents. In order to fill this knowledge gap, 10 m long sediment cores from three sites recovered from Pleistocene loess, Miocene sand, and Triassic Red Sandstone were analysed at 1 m depth intervals, and the amount of GOC was calculated based on 14C measurements. -

3.2 Maßnahmenkatalog Gewässer Ilme
UMSETZUNG DER EG-WRRL IM BEARBEITUNGSGEBIET 18 LEINE/ILME Zwischenbericht Phase III A Seite 39 3.2 Maßnahmenkatalog Gewässer Ilme 3.2.1 Entwicklungsziele • Umsetzung der Ziele der FFH-Richtlinie für das FFH-Gebiet 128 „Ilme“ für den Ge- wässerlauf und die wasserabhängigen Lebensräume in der Aue. • Umsetzung der Ziele des Fließgewässerschutzsystems des Landes Niedersach- sen. Die Ilme ist in diesem System Hauptgewässer 1. Priorität (RASPER et al. 1991) • Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an insgesamt 13 Wehranlagen und Sohlabstürzen vom Quellbereich bis in den Abschnitt Einbeck durch Bau von Fisch- pässen, Umgehungsgewässern oder rauen Sohlgleiten um Wanderungen der Interstitial-, Makrobenthos- und Fischfauna wieder zu ermöglichen. Mit diesen Maßnahmen sind möglichst auch die Rückstaubereiche aufzuheben. • Verbesserung der Durchgängigkeit an Querbauwerken (Brücken) mit betonierten und/oder gepflasterten Sohlen. • Strukturelle Verbesserungen an ausgebauten und begradigten Abschnitten mit der Zielerreichung der Gewässerstrukturgüteklasse 3. Das gilt insbesondere für den Unterlauf ab Einbeck, wo mindestens die GKl 4 erreicht werden sollte. • Sohlanhebungen in Abschnitten, die durch Tiefenerosion stark in das umgebende Gelände eingeschnitten sind, z. B. Unterlauf ab Einbeck, mit dem Ziel, die Grund- wasserstände in der Aue anzuheben. Der Hochwasserschutz der Stadt Einbeck ist zu beachten. • Weitgehender Ersatz der im Oberlauf an den Bach angrenzenden Fichten durch standortheimische Baumarten. • Langfristiger Ersatz der monotonen Fichtenforsten im Einzugsgebiet der Ilme und ihrer Seitenbäche im Bereich des Solling durch Laub-Nadelholz-Mischbestände oder reine Laubwaldbestände. • Anlagen von Gewässerrandstreifen mit Gehölzen, Gras- und Hochstaudenfluren oder als Extensivgrünland zur Reduktion des Stoffeintrags, Zulassung der eigendy- namischen Entwicklung, als Vernetzungselement von Lebensräumen in der Land- schaft und zur Schaffung neuen Lebensraums für Flora und Fauna. -

Jahrgang Hannover, Den 20. 5. 2009 Nummer 20
5324 59. (64.) Jahrgang Hannover, den 20. 5. 2009 Nummer 20 I N H A L T A. Staatskanzlei Bek. 29. 4. 2009, Aufhebung der evangelisch-lutherischen Kapellengemeinden Dohnsen, Linse und Tuchtfeld in der B. Ministerium für Inneres, Sport und Integration Evangelisch-lutherischen St.-Petri-Kirchengemeinde Halle und Umbenennung der Kirchengemeinde (Kirchenkreis Bek. 4. 5. 2009, Verleihung der Bezeichnung „Hansestadt“ Holzminden-Bodenwerder) . 487 an die Stadt Stade . 484 Bek. 29. 4. 2009, Zusammenlegung der evangelisch-lutheri- Bek. 4. 5. 2009, Anerkennung der Förderstiftung MHH schen Kirchengemeinden Fredelsloh, Großenrode und PLUS . 484 Moringen sowie der evangelisch-lutherischen Kapellenge- Bek. 4. 5. 2009, Anerkennung der Nina.Dieckmann-Stif- meinden Espol, Lutterbeck, Nienhagen, Oldenrode und tung . 484 Schnedinghausen (Kirchenkreis Leine-Solling) . 487 Bek. 7. 5. 2009, Anerkennung der Stiftung Gut Adolphshof 484 Bek. 29. 4. 2009, Zusammenlegung der evangelisch-lutheri- schen Kirchengemeinden Fürstenberg, Derental und Mein- C. Finanzministerium brexen (Kirchenkreis Holzminden-Bodenwerder) . 488 Bek. 29. 4. 2009, Zusammenlegung der evangelisch-lutheri- schen Kirchengemeinden Hehlen und Hohe (Kirchenkreis D. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit Holzminden-Bodenwerder) . 489 Beschl. 5. 5. 2009, Zusätzliches Investitionsprogramm für Bek. 29. 4. 2009, Aufhebung der Evangelisch-lutherischen Krankenhausbaumaßnahmen im Rahmen der „Initiative Kapellengemeinde Lichtenhagen in der Evangelisch-luthe- Niedersachsen“ . 484 rischen Liebfrauen-Kirchengemeinde Ottenstein und Um- benennung der Kirchengemeinde (Kirchenkreis Holzmin- E. Ministerium für Wissenschaft und Kultur den-Bodenwerder) . 489 Bek. 29. 4. 2009, Aufhebung der Evangelisch-lutherischen F. Kultusministerium Kapellengemeinde Mühlenberg in der Evangelisch-lutheri- schen St.-Pauli-Kirchengemeinde Holzminden (Kirchen- kreis Holzminden-Bodenwerder) . 489 G. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Bek. 29. 4. 2009, Zusammenlegung der evangelisch-luthe- Erl. -

Bauen Und Umwelt Des Landkreises Northeim Vorstellen Zu Dürfen
Landkreis Northeim Bauen und Umwelt im und Umwelt Bauen www.landkreis-northeim.de Eine Informationsbroschüre für Bauinteressierte Kreisabfallwirtschaft Eigenbetrieb des Landkreises Northeim • kompetente und kostenlose Abfallberatung Telefon: 0 55 51 / 7 08 - 1 60/1 62/1 63 • Restabfallentsorgung über Behälter (Behältergrößen 40 l, 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 770 l und 1.100 l) • Bioabfallentsorgung über Behälter (Behältergrößen 80 l, 120 l und 240 l, auch saisonal begrenzt erhältlich) • kostenlose Papierentsorgung über Behälter (Behältergrößen 120 l, 240 l und 1.100 l) • kostenlose Entsorgung von Sperrmüll und Elektro-Altgeräten bei Haushalten (Anmeldung über die Abrufkarte oder Selbstanlieferung auf den Deponien) • kostenlose Schadstoffentsorgung für Haushalte über das Schadstoffmobil, für Gewerbebetriebe durch kostenpflichtige Selbstanlieferung • Bauabfallentsorgung auf den vier zentral gelegenen Deponien (Hausmülldeponie Blankenhagen bei Moringen sowie die Bauabfalldeponien Einbeck, Katlenburg-Brandisbreite und Uslar-Verliehausen) • Containerdienst zum Festpreis für Altholz, Baum- und Strauchschnitt, Bauschutt, Boden, Restabfall (z. B. für Haushaltsauflösungen) Bauschutt Restabfall (Haushaltsauflösung) Kreisabfallwirtschaft Northeim • Eigenbetrieb des Landkreises Northeim Matthias-Grünewald-Straße 22 • 37154 Northeim Telefon: 0 55 51 / 7 08 - 1 60/1 62/1 63 • Telefax: 0 55 51 / 7 08 - 6 11 E-Mail: [email protected] • Web: www.landkreis-northeim.de GRUSSWORT Liebe Leserin, lieber Leser, ich freue mich Ihnen mit der Broschüre den Fachbereich Bauen und Umwelt des Landkreises Northeim vorstellen zu dürfen. Der Fachbereich Bauen und Umwelt nimmt die Aufgaben der unteren Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde sowie der unteren Natur-, Wasser-, Abfall- und Bodenschutzbehörde wahr. Außerdem ist der Fachbereich verantwortlich für den vorbeugenden Brandschutz, die Kreisstraßen, die Raumordnung und die Regionalplanung sowie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. -

16/19/KT Bekanntmachung
Amtsblatt für den Landkreis Northeim Jahrgang 2019 Northeim, den 21.06.2019 Nr. 25 Inhalt: A. Amtliche Bekanntmachungen des Landkreises Bekanntmachung der Sitzung des Kreistages am 28.06.2019 Verordnung über das Naturschutzgebiet „Moore und Wälder im Hochsolling, Hellental“ (HA 149) in den Landkreisen Holzminden und Northeim vom 18.03.2019 B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden ./. C. Amtliche Bekanntmachung anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts Abwasserverband Espolde Haushaltssatzung 2019 _____________________________________________________________________ Herausgeber: Landkreis Northeim, Medenheimer Str. 6 –8, 37154 Northeim Erscheint grundsätzlich jeden Freitag (außer feiertags), Redaktionsschluss ist jeweils donnerstags 16.00 Uhr Auskunft, Einsichtnahme und Einzelexemplare: Referat 2 – Personal und Finanzen Tel. 05551-708-366, E-Mail: [email protected]. Das Amtsblatt kann auf der Internetseite www.landkreis-northeim.de kostenlos eingesehen werden. Amtsblatt des Landkreises Northeim Nr. 25 vom 21.06.2019 Landkreis Northeim Die Landrätin Öffentliche Bekanntmachung Es findet eine Sitzung des Kreistages am Freitag, 28.06.2019 um 15:00 Uhr, im Sitzungssaal, Medenheimer Straße 6/8, 37154 Northeim statt. Tagesordnung: Drs. Nr. Titel 1 Eröffnung der Sitzung 2 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit 3 Feststellung der Tagesordnung 0845/19 4 Feststellung der Voraussetzungen für Sitzverluste im Kreistag gemäß § 52 NKomVG 0846/19 5 Einführung und Verpflichtung des Kreistagsabgeordneten Claus Stumpe und der Kreistagsabgeordneten Elisabeth Behrens 0847/19 6 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Kreistages am 24.05.2019 7 Bericht über wichtige Beschlüsse des Kreisausschusses und über andere wichtige Angelegenheiten 8 Einwohnerfragestunde 727/19 9 Neuwahl des Kreisbrandmeisters 732/19 10 Ernennung des ausscheidenden Kreisbrandmeisters Bernd Kühle zum Ehrenkreisbrandmeister 0841/19 11 A. -

Staffeleinteilungen Und –Zuständigkeiten Saison 2019/2020
Staffeleinteilungen und –zuständigkeiten Saison 2019/2020 Jugendausschuss Die A-Jugend spielt mit 8 Mannschaften und die B-Jugend mit 10 Teams eine „normale“ Runde mit Hin- und Rückspielen. (Zusatz-Anmerkung hierzu: Auf dem Jugendfußballtag wurde noch eine dreifache Runde für die A-Jugend angekündigt. Seinerzeit waren es aber „nur“ 7 Teams. Durch eine Abmeldung einer B und gleichzeitiger Nachmeldung einer A-Jugend eines Vereins sind es nunmehr 8 A-Jugendmannschaften, was an sich erfreulich ist. Gleichzeitig ist dadurch aber keine Mannschaft an einem Spieltag spielfrei. Hierdurch waren diverse Spielfreiwünsche der Vereine so nicht mehr umsetzbar. Neben den an sich bei einer dreifachen Runde vorgesehenen drei Spieltagen in der Woche hätte es vermutlich noch mehr Verlegungen geben müssen. Weiterhin hätte auch das Wetter mitspielen müssen. Um dieser Terminenge zu entgehen und etwas mehr Luft für alle Teams und Terminwünsche zu haben, wird auch in der A-Jugend nur eine „normale“ Serie mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Statt vormals 18 Spielen pro Team sind es jetzt dadurch 14 Spiele zzgl. dem Pokal. In der B-Jugend bleibt es bei der Runde mit Hin- und Rückspielen.) In den Altersklassen der C-, D-, E- und F-Jugend werden für die Rückrunde neue Staffelleinteilungen vorgenommen, wobei sich die Einteilungen für die Kreisliga/-klasse bei der D- und E-Jugend entsprechend der Herbststaffeln 2019 und der gültigen Ausschreibung ergeben wird. Auch in der F-Jugend wird eine Neueinteilung erfolgen, bei der G-Jugend findet erneut ein reiner Turnierspielbetrieb statt. Weitere Informationen zur G-Jugend werden noch gesondert mitgeteilt. Für einen „besseren“ Überblick werden nachstehend die Einteilungen der C-, D-, E- und F-Jugend auf einen Blick dargestellt. -

Einbeck-Markoldendorfer Becken, Ldkr. Northeim
Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte Band Seite Stuttgart 2003 NNU 72 9-14 Konrad Theiss Verlag Bemerkungen zu Herkunft und Bearbeitung eines Werkstoffes für Dechsel im Einbeck-Markoldendorfer Becken, Ldkr. Northeim. Von Ursula Werben Mit 3 Abbildungen Zusammenfassung: Im Einbeck-Markoldendorfer Becken ist im frühen Neolithikum ein epimetamorph überprägter Gabbronorit zur Herstellung von Dechseln benutzt worden. Es hat den Anschein, dass Rohmaterial des Gesteins in Form von Geschieben auf den Siedlungen bearbeitet worden ist (vgl. Beitrag Lessig in diesem Band). Ein bereits 1989 als Oberflächenfund auf einer Sied lung der Linienbandkeramik (LBK) in der Gemarkung Hullersen (FStNr. 3), Stadt Einbeck, Ldkr. Northeim, geborgenes Rohstück aus Felsgestein zeigte beachtens wert deutliche Sägespuren, die nähere Untersuchungen verdienten (vgl. Beitrag Lessig in diesem Band). Darüber hinaus zeigte das Gestein Merkmale, die auch bei makroskopischer Betrachtung eine eindeutige Unterscheidung von anderen Felsgesteinen ermöglich ten. Eine Begutachtung der im Einbeck-Markolden- dorfer Becken während des Neolithikums für Geräte aus Felsgestein benutzen Werkstoffe zeigte, dass das in diesem Aufsatz behandelte Gestein in erster Linie für Dechsel benutzt worden ist. Ein zweites Rohstück des Abb. 1 Dassensen FStNr. 1, Stadt Einbeck, Ldkr. Northeim gleichen Materials, vermutlich Rest- oder Abfallstück, Dechsel aus Gabbronorit. Fundkatalog 1,3. stammt von der Siedlung der LBK Dassensen-Unter dorf (Dassensen FStNr. 1), Stadt Einbeck, Ldkr. Nort heim. Das Felsgestein besteht aus grauem bis oliv-grauem, feinkörnigem Material mit mm-großen, dicht aber unregelmäßig gestreuten, schwarzen, körnerartigen Flecken. Diese gut sichtbaren Einschlüsse sind rund lich bis achteckig (vgl. Abb. 1-3). Eine Reihe von Dechseln ist, oft nur stellenweise, mit einer bräun lichen, rostartigen Patina überzogen (vgl. -
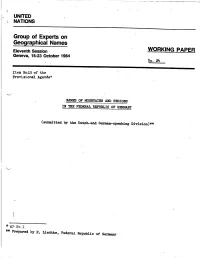
Group of Experts on Geographical Names Z Te^ WORKING PAPER
UNITED NATIONS Group of Experts on Geographical Names ZElevent Teh Sessio^ n WORKING PAPER Geneva, 15-23 October 1984 No. 2U Item NoJ.5 of the Provisional Agenda* . NAMES OF MQUITTAINS AND REGIONS IH THE FEDERAL REPUBLIC OP GERMAHY (submitted by the Butciv-and German-speaking Division)** •* W? Ifo. I ** Prepared by H. Liedtke, Federal Republic of Germany - 2 - GEOGRAPHICAL NAMES IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ACCORDING TO THE OFFICIAL GENERAL MAP (UBERSICHTSKARTE) 1:500,000, WORLD MAP SERIE 1404. Compiled by the Permanent Committee on Geographical -Names in the Federal Republic of Germany and prepared for publication by its chairman Prof. Dr. Herbert Liedtke, Geography Department, Ruhr-University, Bochum. Frankfurt am Main May 1984 Adresses; Standiger AusschuB fur Geographische Namen (Permanent Committee on Geographical Names) Institut fiir Angewandte Geodasie Richard-StrauB-Allee 11 D 6000 Frankfurt am Main Prof. Dr. H. Liedtke Ruhr-Universitac Bochum Geographisches Institut Postfach 102148 D 4630 Bochum HOW TO USE THE LIST OF GEOGRAPHICAL NAMES Alphabetical order; A a, A a H h Q o, 6 o U u, U ii B b I i Pp V v Co" J j Q q W w Dd Kk R r • X x Ee LI S s Y y F f . Mm T t Z z G g N n Annotation: A a, Q a £ U ii are handled as a, o & u. 3 can be handled as ss. Examples;_ Breisgau; Underlined names are printed in the Ubersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:500 000. Abteiland: Names not underlined are not printed in the above-mentioned map but are hereby recommended for consideration in a new edition. -

Und Forstwirtschaft Seite 22
HARDEGSEN ERKUNDUNGSPUNKTE Die Natur der Kultur – die Kultur der Natur 1 Herzlich willkommen bei den Naturerkundungspunkten Hardegsen. Die Natur der Kultur – die Kultur der Natur Hiermit laden wir Sie ein, in dem Bereich von Hardegsen, der zum Naturpark Solling- Vogler gehört, auf Entdeckungsreise zu gehen und die Schönheit unserer Natur- und Kulturlandschaft zu erkunden. Sie können die einzelnen Punkte selbst aufspüren mit Hilfe der Übersichtskarte (S. 4-5) oder der angegebenen GPS-Koordinaten. Als umfassendes Informationsme- dium steht Ihnen neben dieser Broschüre eine Website mit ausführlichen Texten, Bildern und Audio-Dateien zur Verfügung. Die Website fi nden Sie unter: www.erkundungspunkte-hardegsen.de . Dort können Sie sich diese Broschüre auch downloaden. Eine gedruckte Version erhalten Sie im Bürgerbüro der Stadt Hardegsen (Vor dem Tore 1). Impressum: Institut für allgemeine und angewandte Ökologie e.V. Bahnhofstr. 31 · 37181 Hardegsen Tel.: 05505/760 · Fax: 05505/3054 [email protected] · www.oeko-institut-hardegsen.de Mit Unterstützung von: 2 HARDEGSEN ERKUNDUNGSPUNKTE Die Natur der Kultur – die Kultur der Natur Übersichtskarte Seite 4/5 Geologie Seite 6 Karlsquelle Seite 9 Kobbeke Seite 12 Volksfelde Seite 16 Wüstung Withighusen Seite 18 Alte Uslarer Straße Seite 20 Wald- und Forstwirtschaft Seite 22 Waldrand und Waldmantel Seite 26 Totholz Seite 30 Raine und Säume Seite 34 Obstbaumreihen Seite 38 3 Kartengrundlage: Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen © 2018 4 Übersicht der Stationen 5 Geologie GPS-Koordinaten: 51° 40‘ 11,4“ N • 9° 48‘ 55,6“ O Die Region im Bereich um Hardegsen gehört geo- Blick vom graphisch zum Weser- Rand des Leine-Bergland. -
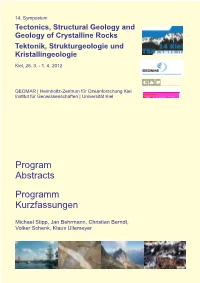
Program Abstracts Programm Kurzfassungen
14.Symposium Tectonics,StructuralGeologyand GeologyofCrystallineRocks Tektonik,Strukturgeologieund Kristallingeologie Kiel,26.3.-1.4.2012 GEOMAR|Helmholtz-ZentrumfürOzeanforschungKiel InstitutfürGeowissenschaften|UniversitätKiel Program Abstracts Programm Kurzfassungen MichaelStipp,JanBehrmann,ChristianBerndt, VolkerSchenk,KlausUllemeyer Contents PREFACE.............................................................................................................................3 PROGRAM ..........................................................................................................................5 Workshops Symposium Field trip POSTER CONTRIBUTIONS............................................................................................13 ABSTRACTS.....................................................................................................................19 MAILING LIST ...............................................................................................................113 2 Preface The 14 th Symposium on Tectonics, Structural Geology and Geology of Crystalline Rocks (TSK14) is the first TSK meeting to be held on the coast. Northern Germany is void of metamorphic and structural geology outcrops and study of their processes requires going underground into salt mines or driving as far as the Harz Mountains. This is precisely what we will do for the field trip. Nevertheless, marine research is much closer to the TSK topics than might be expected. The plate tectonics revolution in the end of the 60s of last century -

Neuzeitliche Landschaftsentwicklung Im Südsolling Die Dorfwüstung Winnefeld
Mittelalterlich–neuzeitliche Landschaftsentwicklung im Südsolling Die Dorfwüstung Winnefeld Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vorgelegt von Arno Beyer Kiel 2008 Referent: Prof. Dr. Hans-Rudolf Bork Korreferent: Prof. Dr. Klaus Dierßen Tag der mündlichen Prüfung: 28. Januar 2009 Zum Druck genehmigt: Kiel, Der Dekan I Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1 1.1 Ziele 1 1.2 Stand der Forschung 1 1.3 Forschungsfragen und Hypothesen 9 2. Methodik 10 2.1 Auswahl des Untersuchungsgebietes und der Untersuchungsstandorte 10 2.1.1 Lage des Untersuchungsgebietes 12 2.2 Geländearbeiten 16 2.2.1 Aufschlüsse 16 2.2.1.1 Festlegung und Anlage der Aufschlüsse 16 2.3 Laborarbeiten 19 2.3.1 Altersbestimmung von Sedimenten mittels optisch stimulierter Lumineszenz (OSL-Datierung) 19 2.3.2 Altersbestimmung von Keramikartefakten 22 3. Der Untersuchungsraum 23 3.1 Naturräumliche Gegebenheiten 23 3.1.1 Gesteine und Relief 23 3.1.2 Klima 23 3.1.3 Substrat und Böden 24 3.1.4 Gewässernetz 24 3.1.5 Heutige Landnutzung 25 4. Das mittelalterliche Winnefeld 26 5. Ergebnisse 31 5.1 Boden-Sediment-Sequenz im Chor der Kirchenruine 31 5.2 Aufschlüsse in der Aue des Reiherbaches und am Unterhang zwischen der Kirche Winnefeld und der Aue 32 5.2.1 Aufschluss A (Ost- und Westhang) 33 5.2.2 Aufschluss 121 in der südlichen Aue des Reiherbaches oberhalb des Forstwegdamms 39 II 5.2.3 Aufschluss Reiherbach: Aufschluss in der nördlichen Aue des Reiherbaches oberhalb des Forstwegdammes 41 5.2.4 Aufschlüsse Reiherbachaue: Aufschlüsse im Zentrum der Reiherbachaue unterhalb des Forstwegdamms 43 5.3 Aufschluss B: Die Entwicklung der Delle östlich der Kirche Winnefeld 49 6. -

Eifas Und Ahlsburg - Die Struktur Der Schollengrenze Zwischen Hils Und Solling
Mitt. Geol. Inst. Hannover ISSN 0440-2812 38 S. 149-162, 6 Abb. Univ. Hannover Juli 1998 Eifas und Ahlsburg - die Struktur der Schollengrenze zwischen Hils und Solling von Heinz Jordan Kurzfassung: Die Eifas-, Ahlsburg- und Salzderhelden-Überschiebung gelten seit langem als halo tektonisch entstanden, d. h. unter Beteiligung von Zechsteinsalz, das diapirartig in die Überschie bungsbahnen und sonstige Schwächezonen des Deckgebirges eindrang. Die Markoldendorfer Mulde zwischen den Überschiebungen ist in weiten Teilen von Quartär-Ablagerungen verhüllt. Bei der Neuaufnahme des Blattes 4124 Dassel der GK 25 wurde mit zahlreichen Bohrungen und mikropaläontologischer Datierung der Intembau der Mulde sowie ihre West- und Süd-Begrenzung kartiert: Die Ahlsburg-Überschiebung setzt sich nach NW fort und mündet in den Lüthorster Graben, der die Mulde im Westen abschneidet und sich bis zur Sattelstörung des Eifas fortsetzt. Abb. 6 zeigt die SE-verlaufenden Störungen als Grenzen dreier Schollen, die sich nach seismischer Interpretation (Geotektonischer Atlas 1996) mehrfach, abschnittsweise auch gegenläufig bewegt haben. Die NNE-streichenden Grabenstrukturen trennen wie Scharniere diese Abschnitte unterschiedlichen Bewegungsablaufs. Abstract: The Eifas, Ahlsburg, and Salzderhelden overthrusts have been considered for a long time to be halotectonic structures caused by diapiric rise of Zechstein salt into thrust planes and other zones of weakness in the overlying rocks. Much of the Markoldendorf syncline between the overthrusts is covered by Quaternary deposits. The structure of the syncline and its western and southern boundaries were mapped with the help of many boreholes and micropalaeontological dating during remapping of the 1 : 25 000 geological sheet 4124 (Dassel). The Ahlsburg overthrust has now been shown to continue to the NW and to lead into the Lüthorst graben, which truncates the syncline in the west and passes into the crestal fault of the Elfas anticline.