Werkhilfe Singheft 2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
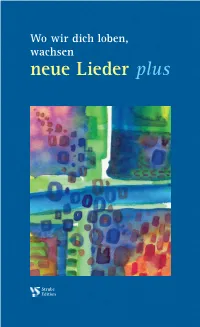
Neue Lieder Plus
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus Strube Edition ALPHABETISCHES VERZEICHNIS Accorde-nous la paix .............. 202 Christe, der du trägst Adieu larmes, peines .............. 207 die Sünd der Welt .................. 110 Aimer, c’est vivre .................... 176 Christ, ô toi qui portes Allein aus Glauben ................. 101 nos faiblesses ........................ 110 Allein deine Gnade genügt ....102 Christ, ô toi visage de Dieu .... 111 Alléluia, Venez chantons ........ 174 Christus, Antlitz Gottes ........... 111 Alles, was atmet .................... 197 Christus, dein Licht .................. 11 Amazing love ......................... 103 Christus, Gottes Lamm ............ 12 Amen (K) ............................... 104 Christus, höre uns .................... 13 An den Strömen von Babylon (K) ... 1 Christ, whose bruises An dunklen, kalten Tagen ....... 107 heal our wounds ................... 111 Anker in der Zeit ...................... 36 Con alegria, Atme in uns, Heiliger Geist ..... 105 chantons sans barrières ......... 112 Aube nouvelle dans notre nuit .. 82 Con alegria lasst uns singen ... 112 Auf, Seele, Gott zu loben ........ 106 Courir contre le vent ................. 40 Aus den Dörfern und aus Städten .. 2 Croix que je regarde ............... 170 Aus der Armut eines Stalles ........ 3 Danke für die Sonne .............. 113 Aus der Tiefe rufe ich zu dir ........ 4 Danke, Vater, für das Leben .... 114 Avec le Christ ........................... 70 Dans la nuit Bashana haba’a ..................... 183 la parole de Dieu (C) .............. 147 Behüte, Herr, Dans nos obscurités ................. 59 die ich dir anbefehle .............. 109 Das Leben braucht Erkenntnis .. 14 Bei Gott bin ich geborgen .......... 5 Dass die Sonne jeden Tag ......... 15 Beten .................................... 60 Das Wasser der Erde .............. 115 Bis ans Ende der Welt ................ 6 Da wohnt ein Sehnen Bist du mein Gott ....................... 7 tief in uns .............................. 116 Bist zu uns wie ein Vater ........... -

Katalog 2019 2 >
Katalog 2019 2 > Wer nicht neugierig ist, singt nichts Neues. Das sind wir > Neue Noten! Digitale Noten! Neugierig? > www.dehm-verlag.de Katalog 2019 Katalog Dehm Verlag Verlag Dehm 3 Das sind wir ... < > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust, und mehr… Der Dehm Verlag ist ein Partner für kreative Köpfe, die ihr musikalisches Schaffen und ihre Ideen in die Öffentlichkeit bringen möchten. Weil uns die Musik am Herzen liegt, weil Musik belebt, verbindet und bewegt, arbeiten wir mit Musiker/innen und Texter/innen stets an neuen Liedern und Chorwerken. Das sind wir > Patrick Dehm Cornelius Dehm Jürgen Kandziora 2019 Katalog Dehm Verlag Verlag Dehm Verleger: Patrick Dehm Dehm Verlag e.K. Rechte & Lizenzen: Cornelius Dehm Auf der Unterheide 40 Notensatz: Jürgen Kandziora 65549 Limburg/Lahn Gestaltung: Ulrike Mahr, Tel. +49 (0) 6431-71905 Mahr Graphic & Performing Arts, Kronach Fax +49 (0) 6431-976016 Preisänderungen, Lieferbarkeit und Irrtümer [email protected] vorbehalten. (Stand: Februar 2019) www.dehm-verlag.de 4 > Das sind wir ... > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust, und mehr… > Notenmaterial und Fortbildung Das ist unser Beitrag, damit sich neue Chöre gründen und bestehende Chöre neue Nahrung finden. Chöre und Kirchengemeinden suchen nach zeitgenössischen Texten und Musik. Das nehmen wir ernst und bieten modernes Notenmaterial an. Das sind wir Um unser Ziel zu erreichen, Chören zu lebendiger Musik und zeitgemäßer Sprache zu > verhelfen, haben wir Seminare mit Tagesworkshops, halbtägigem und ganztägigem offenen Singen und einer einwöchigen Fortbildung entwickelt. Infos zu den Fortbildungen finden sich auf unserer Website www.neuesgeistlicheslied.de. -

Katalog Dehmverlag 2017 DRUCK.Indd
Katalog 2017 2 Neugierig? > Das sind wir ... NEUER Web-Shop! > Chorbücher , Liederbücher, > www.dehm-verlag.de Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, Leselust und mehr… Vielen ist unser breites Verlagsangebot mit modernen Beiträgen zum musika lischen Leben ein Grund, neu oder wieder einzukaufen. Dafür haben wir unseren Onlineshop überarbeitet. Unter www.dehm-verlag.de fi nden sich Notenbeispiele, Inhaltsverzeich- nisse der Bücher, YouTube Videos, Hintergrundinformationen und Rezensionen aus Das sind wir Fachzeitschriften. Wonach gehe ich bei der Auswahl? Immer häufi ger nach Empfehlungen und Kommen- > taren anderer Nutzer. Daher unsere Bitte: Gefällt Ihnen ein Artikel, sagen Sie es wei- ter. Sie helfen damit dem Verlag, den Autoren und unseren gemeinsamen Ideen. Sie fi nden die Buttons für Twitter, Facebook und E-Mail unter jeder Artikelbeschreibung auf unserer Website. Ihre Meinung können Sie auch allen anderen Besucherinnen und Besuchern unseres Web-Shops kundtun. Wenn Sie uns Ihre Rezension zusenden, werden wir diese veröf- Katalog 2017 Katalog fentlichen und Sie erhalten ein Präsent aus unserem Verlagsprogramm. Druckfrisch im neuen Verlagsprogramm sind 10 Neuerscheinungen. Darunter die Messe zum Emmaus-Gang „Feuer im Herzen“ von Helmut Schlegel und Winfried Heurich und die Messe „Lass die Liebe größer werden“ von Elvira und Johann Kreuz- pointner; von Georg Schemberg die Messe „Aus Erde und aus Geist“ und die Gospel- messe „Sing to God“ von Eugen Eckert und Kai Lünnemann. Dehm Verlag Verlag Dehm Ein Chorband zu Hochzeiten und Segnungen der Liebe mit 29 Liedern und Texten unter dem Titel „ Die Segel sind gesetzt“ will entdeckt werden. Neu ist das Pfi ngst-Oratorium„Feuerzungen“ von Eugen Eckert und Peter Reulein und das Oratorium „Laudato si“ von Helmut Schlegel und Peter Reulein sowie eine deutschsprachige mittelalterliche Mottete zum Lied der Liebe „Ich bin eine Blume zu Saron“. -

Gottesdienst Am 31. Mai 2020 St. Maria
Pfingstsonntag 2020 – nur für den privaten einmaligen gottesdienstlichen Gebrauch 1 GOTTESDIENST AM 31. MAI 2020 ST. MARIA EINZUG GL 347 DER GEIST DES HERRN ERFÜLLT 1. Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten; er krönt mit Jubel Berg und Tal, er lässt die Wasser fluten. Ganz überströmt von Glanz und Licht erhebt die Schöpfung ihr Gesicht,frohlockend: Halleluja. 2. Der Geist des Herrn erweckt den Geist in Sehern und Propheten, der das Erbarmen Gottes weist und Heil in tiefsten Nöten. Seht, aus der Nacht Verheißung blüht; die Hoffnung hebt sich wie ein Lied und jubelt: Halleluja. T: Maria Luise Thurmair (1941)1946 | M: Melchior Vulpius 1609 BEGRÜßUNG KYRIE GL 165 SEND UNS DEINES GEISTES KRAFT K Send uns deines Geistes Kraft, / der die Welten neu erschafft: A Christus, Herr, erbarme dich. K Lass uns als Waisen nicht, / zeig uns des Trösters Licht: A Christus, erbarme dich. K Dass in uns das Herz entbrennt, / deiner Gnade Reich erkennt: A Christus, Herr, erbarme dich. T: MARIA LUISE THURMAIR 1952 | M: HEINRICH ROHR 1952 GLORIA GL 172 GOTT IN DER HÖH SEI PREIS UND EHR Gott in der Höh sei Preis und Ehr, / den Menschen Fried auf Erden. Allmächtger Vater, höchster Herr, / du sollst verherrlicht werden. Herrr Jesus Christus, Gottes Sohn, / wir rühmen Deinen Namen du wohnst mit Gott / dem heilgen Geist / im Licht des Vaters, Amen. T: EGB 1971 nach dem Gloria | M: Augsburg 1659/EGB ZWISCHENGESANG GL 346 ATME IN UNS, HEILIGER GEIST Kv Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm! 2 – nur für den privaten einmaligen gottesdienstlichen Gebrauch Pfingstsonntag 2020 3. -

Ausg 756 Internetversion
29. November 2013 Nr. 756 LiebfrauenBrief www.liebfrauen.net 48 Liebfrauenbrief Nr. 741 48 INHALT „UND NUN KONNTE WIEDER LIEBEN/ WAS ERST AUSEINANDER FIEL 3 „EIN ORT, DEN GOTT SELBER SICH GESCHAFFEN HAT“ 8 Liebe ORTSAUSSCHUSS FÜR LIEBFRAUEN 10 STARKE, VOLLE, TIEFE WOCHE DES HEILS11 Mitchristen, JESUS SETZT DAS HERZ IN FLAMMEN 12 EIN LICHT FÜR ST. ANTONIUS 13 Liebfrauen ist ein Ort, an dem es viel Bestän- MITARBEITERFEST - RÜCKBLICK 14 diges gibt, aber auch viel Veränderung. So CHÖRE AUS LIEBFRAUEN IN PRAG 16 auch jetzt wieder. Am Franziskusfest durften VON DER FREUDE DES TEILENS 18 wir erfreulicherweise zwei Ordensschwestern UMZUG AN ST. MARTIN 19 aus der Gemeinschaft „Königin der Apostel“, ZUM WUNDERBAREN TEAM Sr. Nita und Sr. Gretta, begrüßen, die jetzt das GEWORDEN 20 Leben in Liebfrauen mitgestalten. WALLFAHRT DER LITURGISCHEN Ich selbst verabschiede mich mit diesem Lieb- MITARBEITER 22 frauenbrief von Ihnen. Nach dreijähriger „WERDET BOTSCHAFTER FÜR Tätigkeit in Liebfrauen kommt zu Beginn des RUMÄNIEN 24 neuen Jahres eine neue Aufgabe auf mich zu. LIEBFRAUEN BEI FACEBOOK 26 Mein Nachfolger wird ein Alt-Bekannter sein: BETEN PER APP 27 P. Christophorus wird meine bisherige Aufga- NEUE SCHWESTERN AN LIEBFRAUEN 28 be in Liebfrauen übernehmen. ADIEU FRANKFURT ..... 30 Kommen und Gehen, Ankunft und Abschied: PERSONELLE VERÄNDERUNGEN 32 nichts Neues in Liebfrauen. Darüber und über NOTENSCHLÜSSEL 34 vieles andere, was mit dem Leben in Liebfrau- MUSIK IN LIEBFRAUEN 36 en zu tun hat, können Sie in diesem Liebfrau- BILDUNGSWERK LIEBFRAUEN 38 enbrief wieder lesen. INFORMATIONEN & Ihnen allen wünsche ich eine besinnliche und VERANSTALTUNGEN 39 möglichst stressfreie Adventszeit, frohe und SEELSORGE 45 gesegnete Weihnachtstage und für das neue KALENDER 46 Jahr 2014 Gottes Nähe und Segen an jedem Tag! TITELBILD: LUMINALE 2012 Foto: P. -

Die St.Galler Singtaglieder
Die St.Galler Singtaglieder www.ref-sg.ch/musik Titel Autor/-innen Singtag Am Abend der Welt C. Rüttlinger / D. Plüss 2011 Anker in der Zeit Albert Frey 2009 Atem Gottes Albert Frey 2012 Bei dir ist die Quelle des Lebens Monika und Reto Frischknecht 2014 Beten Christoph Zehendner / Manfred Staiger 2020 Bi an den Himmel René Schärer 2020 Bleib bei uns Martin Buchholz 2019 Bliib e treu Patrick Rufer 2012 Christus lebt! Natasha Hausammann 2014 Brich ein – brich auf Esther Wild-Bislin / Roman Bislin-Wild 2014 Da berühren sich Himmel und Erde Thomas Laubach 2009 Danke (für diesen Festtag heute) Unbekannt / Martin G. Schneider 2012 Danke für alles, was du gibst, Herr Albert Frey 2012 Da wohnt ein Sehnen Anne Quigley / Eugen Eckert 2019 Das wünsch ich dir Martin Buchholz 2011 Dein Herz fürchte sich nicht Martin Buchholz 2015 Dein Wort ist ein Licht (Thy Word) Amy Grant / M.W.Smith 2009 Der Herr segne dich Martin Pepper 2010 Der Herr segne dich (Stäheli) Irene Stäheli 2014 Der Herr ist mein Hirte Mitch Schlüter / Timo Böcking / 2020 Jelena Herder Die Zeit ist reif Christoph Zehendner / 2014 Andreas Hausammann Du Albert Frey 2009 Du bisch willkomme, du ghörsch dezue Roland Pöschl 2014 Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt Martin Pepper 2010 Du bist ewig M. Lönnebo / C. Bittlinger / J. Denke / 2014 D. Plüss Du bist heilig Fritz Baltruweit / Per Harling 2010 Du bist mein Zufluchtsort Michael Lender / Gitta Leuscher 2012 Durch das Dunkel Hans-Jürgen Netz / Christoph Lehmann 2012 Du hast Erbarmen Albert Frey 2010 Es Gschänk vom Himmel Andrew Bond -

Laudato Si.Org
Laudato si' Laudato si' (English: Praise Be to You!) is the second encyclical of Pope Francis. The encyclical has the subtitle "on care for our Laudato si' common home".[1] In it, the pope critiques consumerism and Central Italian for 'Praise Be to irresponsible development, laments environmental degradation and You!' global warming, and calls all people of the world to take "swift and Encyclical letter of Pope unified global action."[2] Francis The encyclical, dated 24 May 2015, was officially published at noon on 18 June 2015, accompanied by a news conference.[2] The Vatican released the document in Italian, German, English, Spanish, French, Polish, Portuguese and Arabic, alongside the original Latin.[3] The encyclical is the second published by Francis, after Lumen fidei Date 24 May 2015 ("The Light of Faith"), which was released in 2013. Since Lumen Subject On care for our common fidei was largely the work of Francis's predecessor Benedict XVI, home Laudato si' is generally viewed as the first encyclical that is entirely the work of Francis.[4][5] Pages 184 Number 2 of 2 of the pontificate Text In Latin (http://w2.vatican. Contents va/content/francesco/la/e ncyclicals/documents/pap Content Environmentalism a-francesco_20150524_e nciclica-laudato-si.html) Poverty Science and modernism In English (http://w2.vatic Technology an.va/content/francesco/e Other topics n/encyclicals/documents/ papa-francesco_2015052 Sources 4_enciclica-laudato-si.htm History l) Early stages Leak Release Reception Within Roman Catholic Church Criticism From other faiths From world leaders From the scientific community Impact on the United States political system Neoconservative critique and counterarguments From industry From other groups In music See also References Further reading Ecological consciousness Global climate change Life of St. -

Katalog 2021 2 >
Katalog 2021 2 > Wer nicht neugierig ist, singt nichts Neues. Das sind wir Neue Noten! Digitale Noten! Neugierig? > www.dehm-verlag.de > Katalog 2021 Katalog Dehm Verlag Verlag Dehm 3 Das sind wir ... < > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust und mehr… Der Dehm Verlag ist ein Partner für kreative Köpfe, die ihr musikalisches Schaffen und ihre Ideen in die Öffentlichkeit bringen möchten. Weil uns die Musik am Herzen liegt, weil Musik belebt, verbindet und bewegt, arbeiten wir mit Musiker*innen und Texter*innen stets an neuen Liedern und Chorwerken. Das sind wir Patrick Dehm Cornelius Dehm Jürgen Kandziora Johannes Schröder > Stefanie Schiederig Katharina Dehm Katalog 2021 Katalog Verleger: Patrick Dehm Dehm Verlag e.K. Rechte & Lizenzen: Cornelius Dehm Auf der Unterheide 40 Kundenservice: Stefanie Schiederig, Katharina Dehm 65549 Limburg/Lahn Notensatz: Jürgen Kandziora, Johannes Schröder Tel. +49 (0) 6431-71905 Gestaltung: Ulrike Mahr, Mahr Graphic & Performing Arts, Kronach Fax +49 (0) 6431-976016 Social Media: Johannes Schröder Verlag Dehm [email protected] Preisänderungen, Lieferbarkeit und Irrtümer www.dehm-verlag.de vorbehalten. (Stand: April 2021) 4 > Das sind wir ... > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust und mehr… > „Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.“ – Victor Hugo (1802–1885) Singen, ob alleine oder in der Gruppe, ergreift stets den ganzen Menschen. Singen erhöht unsere Lebensfreude und macht uns glücklich. Seit Beginn der Pandemie Das sind wir stand das Chorsingen unter Verdacht: Singen ist gefährlich. Mit den Aerosolen, die durch das Singen freigesetzt werden, wäre die Ansteckungsgefahr in der Pandemie zu groß. -

Gott? Und Ich, Trotz Wi - Der - Re - Den, 1
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder zur Ansicht zur Ansicht Anhang zum Gesangbuch der Evangelischen Landeskirche in Baden mit Kopierschutz mit Kopierschutz 1 Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder!" Das ist wahr für die Christen- Inhalt heit zu allen Zeiten. In ihre Lieder nehmen Menschen ihre Erfahrungen hin- Lieder = 1–94 und 101–224 ein, singen vom Leben mit dem Glauben. Verkündigung, Gotteslob, Klage Psalmen = 901–976 und Frage gewinnen dabei immer neue Gestalt, bringen Glauben in Bezie- Liturgischer Kalender: nach Nr. 976 hung zur erlebten Gegenwart zum Ausdruck und nehmen musikalische Ent- Thematisches Verzeichnis der Lieder wicklungen auf. Alphabetisches Inhaltsverzeichnis Vor 13 Jahren wurde das erste Liederheft „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder” als Ergänzung zum Evangelischen Gesangbuch herausgebracht. Seitdem sind weitere „Neue Lieder” hinzugekommen. Manche von ihnen wurden in dieser Zeit neu geschrieben, andere entstammen Regionalteilen der Gesangbücher oder neuen Beiheften anderer Landeskirchen. Außerdem enthält das Liederbuch alle neuen Wochenlieder, die nicht in den Gesangbü- chern der beteiligten Landeskirchen stehen. Dieses Plus von 124 Liedern ergänzt nun in einem Buch die Liedsammlung von 2005 – und ist den Gemeinden mit umfangreichem Begleitmaterial für Instrumente, Chöre und Bands zugänglich. Musik klingt über Grenzen hinweg! Das gilt auch für die Kommissionsarbeit, die diesem Liederbuch vorausging: Die Landeskirchen in Württemberg, Ba- den, der Pfalz und Elsass-Lothringen sind singend miteinander verbunden. Das vorliegende Liederbuch macht mit deutschen, französischen, englischen und spanischen Liedern Lust auf die Vielfalt der Singkulturen; die Bandbreite der Lieder eröffnet eine vielfältige theologische und musikalische Sprache des Glaubens für unsere Zeit. -

„Die Ngl-Literaturliste“
Peter Deckert: „DIE NGL-LITERATURLISTE“ Bücher – Zeitschriftentitel – Examensarbeiten zum Thema „Neues Geistliches Lied (NGL) – Sacro-Pop – Religiöse Popularmusik“ - Entstehung, Entwicklung, Formen, Funktionen, - Kriterien zu Auswahl und Bewertung, Kritik, - pädagogische, pastorale, liturgische Funktion und Bedeutung, - musikalische Einordnung, - Bewertung der Liedtexte, - Macher und Vermittler u.a. Die Liste ist alphabetisch nach Verfassern geordnet. Vielen Titeln sind den Inhalt erläuternde und kommentierende Hinweise beigefügt. Zur schnellen Übersicht verweisen Kennziffern auf den Hauptinhalt des Titels. Bei dieser Literaturzusammenstellung handelt es sich um die umfassendste verfügbare NGL-Bibliographie. Ein An- spruch auf Vollständigkeit wird damit jedoch nicht erhoben. Um die Liste zu verbessern und auf aktuellem Stand zu halten, sind Benutzer herzlich gebeten, Ergänzungen und Korrekturen mitzuteilen! Erarbeitet von Peter Deckert © Herausgegeben vom Arbeitskreis SINGLES im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Erzbistum Köln Köln 1975 ff. Bearbeitungsstand: November 2020 Literaturliste NGL - 2 - © Inhalt © Hinweise zum Gebrauch: Aufbau und Inhalt der Literaturliste...............................................................................3 Problem Literaturbeschaffung........................................................................................3 Recherchehilfen der Literaturliste ..................................................................................4 Liste der "Themenkennziffern" (= bei den Titeln -

The Development of a Fach System for the Tenor Oratorio Repertoire
James Madison University JMU Scholarly Commons Dissertations The Graduate School Spring 2017 The evelopmeD nt of a Fach System for the Tenor Oratorio Repertoire Randall C. Ball James Madison University Follow this and additional works at: https://commons.lib.jmu.edu/diss201019 Part of the Music Education Commons, Music Pedagogy Commons, Music Performance Commons, and the Music Practice Commons Recommended Citation Ball, Randall C., "The eD velopment of a Fach System for the Tenor Oratorio Repertoire" (2017). Dissertations. 145. https://commons.lib.jmu.edu/diss201019/145 This Dissertation is brought to you for free and open access by the The Graduate School at JMU Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of JMU Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. The Development of a Fach System for the Tenor Oratorio Repertoire Randall Criswell Ball A Doctor of Musical Arts document submitted to the Graduate Faculty of JAMES MADISON UNIVERSITY In Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Musical Arts School of Music May 2017 FACULTY COMMITTEE: Committee Chair: Kevin McMillan, M.M. Committee Members/Readers: Don Rierson, Ph.D. Jo-Anne van der Vat-Chromy, Ph.D. DEDICATION Soli Deo Gloria ii ACKNOWLEDGEMENTS First of all, I would like to thank my committee for their exceptional guidance throughout this process. Each one brought unique talents and singular perspective to my degree program and the scholarship involved in this document. I would like to thank Kevin McMillan for being my mentor, advisor, voice teacher, chair of my committee, cheerleader, and colleague throughout my doctoral program. -

Träume Hüten
INHALTSVERZEICHNIS Nr. Titel (Rubrik) Text Musik Seite Eröffnung 1 Die Träume hüten Eugen Eckert Joachim Raabe 2 2 Auf zu neuen Horizonten Helmut Schlegel Stephan Sahm 3 3 Wie ein Baum in ihm verwurzelt Dietmar Fischenich Joachim Raabe 8 4 In deine Zeit bin ich geboren Eugen Eckert Torsten Hampel 9 5 Kreuz, das unser Leben trägt Dietmar Fischenich Peter Reulein 13 6 Einen neuen Aufbruch wagen Dietmar Fischenich Thomas Quast 14 7 Wir sind gemeinsam unterwegs Lutz Riehl Lutz Riehl 20 8 Verstehst du, was uns hindert? Eugen Eckert Joachim Raabe 21 9 Nah bei dir suchen wir ein Zuhaus Hans Florenz Michel Wackenheim 22 10 Im Sonnenaufgang Eugen Eckert Dominik Sahm 24 11 Ich will dich erheben Eugen Eckert Thomas Gabriel 26 12 Mensch, wo bist du Eugen Eckert Andreas Neuwirth 28 (Ich habe dich geschaffen) 13 Wir sind eingeladen zum Fest Hans Florenz Hans Florenz 30 14 Die Liebe Gottes wohnt jetzt unter uns Eugen Eckert Peter Reulein 31 15 Wir sind Kirche, in Gemeinschaft Lutz Riehl Peter Reulein 37 16 Gemeinde sein Barbara Großmann Barbara Großmann 40 Kyrie 17 Einst warst du, Gott, uns gnädig Eugen Eckert Gerd-Peter Münden 42 18 Wenn der Himmel in unsre Nacht fällt Winfried Offele Hans Florenz 43 19 Du hast mich gerufen Eugen Eckert Jürgen Kandziora 50 20 Jesus Christus, Menschensohn Helmut Schlegel Joachim Raabe 53 21 Jesus Christus, Menschensohn Helmut Schlegel Helmut Föller 53 22 Wo? Eugen Eckert Horst Christill 54 23 Wenn die Nacht mich überschattet Hans Florenz Hans Florenz 56 24 Manchmal sind wir träge Eugen Eckert Peter Reulein 58 25 Was zwischen uns steht Eugen Eckert Peter Reulein 59 Gloria 26 Ehre sei Gott Hans Florenz Hans Florenz 60 27 Barmherzig und gnädig Eugen Eckert Peter Reulein 62 Nr.