Laudato Sii Mio Signore
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
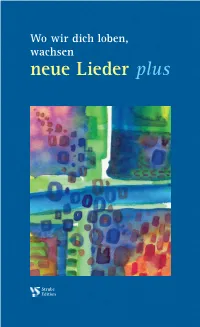
Neue Lieder Plus
Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus Strube Edition ALPHABETISCHES VERZEICHNIS Accorde-nous la paix .............. 202 Christe, der du trägst Adieu larmes, peines .............. 207 die Sünd der Welt .................. 110 Aimer, c’est vivre .................... 176 Christ, ô toi qui portes Allein aus Glauben ................. 101 nos faiblesses ........................ 110 Allein deine Gnade genügt ....102 Christ, ô toi visage de Dieu .... 111 Alléluia, Venez chantons ........ 174 Christus, Antlitz Gottes ........... 111 Alles, was atmet .................... 197 Christus, dein Licht .................. 11 Amazing love ......................... 103 Christus, Gottes Lamm ............ 12 Amen (K) ............................... 104 Christus, höre uns .................... 13 An den Strömen von Babylon (K) ... 1 Christ, whose bruises An dunklen, kalten Tagen ....... 107 heal our wounds ................... 111 Anker in der Zeit ...................... 36 Con alegria, Atme in uns, Heiliger Geist ..... 105 chantons sans barrières ......... 112 Aube nouvelle dans notre nuit .. 82 Con alegria lasst uns singen ... 112 Auf, Seele, Gott zu loben ........ 106 Courir contre le vent ................. 40 Aus den Dörfern und aus Städten .. 2 Croix que je regarde ............... 170 Aus der Armut eines Stalles ........ 3 Danke für die Sonne .............. 113 Aus der Tiefe rufe ich zu dir ........ 4 Danke, Vater, für das Leben .... 114 Avec le Christ ........................... 70 Dans la nuit Bashana haba’a ..................... 183 la parole de Dieu (C) .............. 147 Behüte, Herr, Dans nos obscurités ................. 59 die ich dir anbefehle .............. 109 Das Leben braucht Erkenntnis .. 14 Bei Gott bin ich geborgen .......... 5 Dass die Sonne jeden Tag ......... 15 Beten .................................... 60 Das Wasser der Erde .............. 115 Bis ans Ende der Welt ................ 6 Da wohnt ein Sehnen Bist du mein Gott ....................... 7 tief in uns .............................. 116 Bist zu uns wie ein Vater ........... -

Concerto Per Organo
I Concerti di San Gioacchino in Prati in collaborazione con l’Accademia Romana d’Organo C. Franck DOMENICA 18 febbraio 2018 ORE 17 – Ingresso libero Concerto per Organo Organista: Eugenio Maria Fagiani (Organista Aggiunto del Santuario Francescano della Verna, Arezzo) Via Pompeo Magno Tel.: 06-3216659 (Piazza dei Quiriti - Roma) Fax: 06-3216659 Sito: www.sangioacchino.org E-mail: [email protected] Programma Charles-Marie Widor Mattheus-Final (da “Bach’s Memento”) (1844-1837) Moritz Brosig Preludio in sol minore op. 3 n°5 (1815-1887) Johann Sebastian Bach Aus tiefer Not schrei’ zu dir BWV 686 (1685-1750) Johannes Brahms O Welt, ich muss dich lassen op. 122 n°3 (1833-1897) Josef Gabriel Rheinberger Passacaglia (dalla “Ottava Sonata op. 132”) (1839-1901) Eugenio Maria Fagiani è annoverato tra i maggiori organisti italiani e più presenti sulla scena internazionale. Si esibisce costantemente in tutta Europa, Cipro, Giordania, Israele, Libano, Palestina, Siria, Russia, Bielorussia, Stati Uniti e Canada sugli strumenti più prestigiosi.È Docente Titolare della Classe di Organo dei Corsi Accademici del “Magnificat Institute” di Gerusalemme, Israele, ed è costantemente invitato a tenere conferenze e masterclasses sia d'interpretazione che d'improvvisazione (arte nella quale è internazionalmente riconosciuto come grande specialista) presso prestigiose istituzioni musicali Europee e Nordamericane quali l'Ente Ecclesiastico Duomo di Messina (dove è stato incaricato di un corso annuale di improvvisazione organistica, su uno degli strumenti più grandi d’Europa), il Cambridge University Organ Scolars' Forum (UK), i corsi dell’ISAM in Ochsenhausen (D), Il Conservatorio di Minsk (BY) ed il Royal Canadian College of Organists di Toronto (CDN). -

MUSIC LIST Master
updated: 13/2/18, 2:29 pm CHRIST CHURCH MUSIC LIST 2018 (B) 31 Dec 17 ORG/Talia Epiphany Mass DUDMAN Prelude Wie schön leuchtet der Morgenstern - Johann Pachelbel (1653-1706) Hymns 291; 452; 454; 268 Communion Wie schön leuchtet der Morgenstern - F.W.Zachow (1663-1712) Postlude Vom Himmel hoch, LV 51 - F.W.Zachow 7 Jan 18 NO Lucians (no Sunday School) ORG/cw & Jonathan Lee (Canberra) Baptism of our Lord We welcome visiting organ student Jonathan Lee Mass DUDMAN Prelude Andante Allegro from Organ Concerto in Bb, op.4/6 - G.F.Handel (1685- Hymns 3081750) (AHB t.230); 405; 526; 447 Communion Larghetto from Organ Concerto in Bb, op.4/6 - G.F.Handel Postlude Allegro moderato from Organ Concerto in Bb, op.4/6 - G.F.Handel 14 Jan 18 NO Lucians (no Sunday School) ORG/Talia Ep 2 Mass DUDMAN Prelude Der Tag, der ist so freudenreich - Johann Pachelbel Hymns 449; 448; 497; 246 Communion Prière & Non troppo lento - César Franck Postlude Fugue No.3 in D - G.F.Handel 21 Jan 18 NO Lucians Last day of School Holidays ORG/cw Ep 3 Mass DUDMAN Prelude Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 684 - J.S.Bach (1685-1750) Hymns 160; 598; 560i; 595 Communion Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 685 - J.S.Bach Postlude Allebreve in D, BWV 589 - J.S.Bach 28 Jan 18 Australia Day Long-Weekend Ep 4 Mass DUDMAN Prelude Improvisation - Colin Brumby (1933-2018) Hymns 59; 226; 672ii; 631 (t.517) Communion Extemporization III - A.E.Floyd (1877-1974) Postlude Carillon (on 'Old 100th') - Archie Day (1901-1975) 4 Feb 18 LUCIANS RESUME Ep 5 Mass RUTTER Allegretto (3rd mvt) from Sonata IV in Bb, op,65/4 - Felix Mendelssohn Prelude (1809-1847) Hymns 111; 219 (1st t. -

Mayführung Siedlung Bornheimer Hang Ernst-May-Gesellschaft 01 Frankfurt Am Main
mayführung Siedlung Bornheimer Hang ernst-may-gesellschaft 01 frankfurt am main Abb. 1 Gesamtplan Siedlung Die Siedlung Bornheimer Hang entstand in den Jahren 1926-30 nach einem Gesamtplan von Ernst May unter Mithilfe von Herbert Boehm. Sie umfasst insgesamt etwas 1540 Wohnungen, vor allem 2- und 3-Zimmer-Wohnungen (55 resp. 65m2), ausgestattet mit Frankfurter Küche und Zentralradio; Bauherr war die Aktiengesellschaft für kleine Wohnungen. Neben Ernst May waren an der architektonische Bearbeitung und Umsetzung außerdem Carl Herrmann Rudloff und Adolf Aßmann beteiligt, die Heilig- Kreuz-Kirche (1929) wurde von Martin Weber entworfen, die Gestaltung der Grünanlagen übernahmen Max Bromme und sein Mitarbeiter Ulrich Wolf. Im Unterschied zu den zeitnah konzipierten Wohngebieten von Praunheim (ebenfalls ab 1926) und der Römerstadt (ab 1927) schloss die Bornheimer Siedlung zeitlich und räumlich unmittelbar an eine bereits bestehende Architektur an: Der Stadtteil Bornheim, 1877 eingemeindet, war erst kurz zuvor mit einer traditionellen Blockbebauung längs der Wittelsbacher Allee und Saalburgallee zum nordöstlichen Stadtrandgebiet von Frankfurt geworden. Auf diese spezifische Situation nahm May in seiner Planung Bezug, und zwar sowohl in der Gesamtraumplanung (z.B. mit den zentralen Straßenachsen) als auch in der Bauweise (so entstanden im ersten Bauabschnitt 1926/27 am westlichen und östlichen Pestalozziplatz ganz May-untypisch und bedingt durch die alte Bebauungsordnung Häuser mit Steildach); die Siedlung gewann durch diese Elemente und ihre überwiegend mehrgeschossige Bebauung fast einen ‚großstädtischen Charakter’. Doch noch ein anderer Aspekt bestimmte die Siedlungsplanung von Anfang an ganz wesentlich mit: die spezifische topographische Struktur des Geländes. Im Osten endet das Gebiet mit dem Abhang zum Riederbruch, wodurch der Bornheimer Hang eine doppelte Panoramastruktur gewinnt – einerseits gibt es den Blick aus der Siedlung in das (damals fast unbebaute) Land, andererseits den Blick aus der Ferne auf die bebaute Hangsilhouette. -

Honor Choirs! Pre-Conference [email protected] - Website: Europacantatjunior
INTERNATIONAL CHORAL BULLETIN ISSN - 0896-0968 Volume XXXIX, Number 3 ICB 3rd Quarter, 2020 - English DOSSIER Composer’s Corner: BASIC COGNITIVE PROCESSES Choral Music is an Expression of our IN CONDUCTING Souls and our Social Togetherness Interview with John Rutter INTERNATIONAL CHORAL BULLETIN CONTENTS 3rd Quarter 2020 - Volume XXXIX, Number 3 COVER John Rutter 1 MESSAGE FROM THE PRESIDENT Emily Kuo Vong DESIGN & CONTENT COPYRIGHT © International Federation DOSSIER for Choral Music 3 BASIC COGNITIVE PROCESSES IN CONDUCTING Theodora Pavlovitch PRINTED BY PixartPrinting.it, Italy IFCM NEWS 13 IFCM AND THE QATAR NATIONAL CHORAL ASSOCIATION WORKING ON SUBMITTING MATERIAL THE WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC 2023/2024 When submitting documents to be IFCM Press Release considered for publication, please provide articles by Email or through the CHORAL WORLD NEWS ICB Webpage: 15 REMEMBERING COLIN MAWBY http://icb.ifcm.net/en_US/ Aurelio Porfiri proposeanarticle/. The following 18 CHOIRS AND CORONA VIRUS ... THE DAY AFTER electronic file formats are accepted: Aurelio Porfiri Text, RTF or Microsoft Word (version 97 21 CHATTING WITH ANTON ARMSTRONG or higher). Images must be in GIF, EPS, A PROUD MEMBER OF THE INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL TIFF or JPEG format and be at least MUSIC FOR MORE THAN 30 YEARS 300dpi. Articles may be submitted in one Andrea Angelini or more of these languages: English, French, German, Spanish. IMPOSSIBLE INTERVIEWS 27 THE TRUE HISTORY OF THE VESPERS OF THE BLESSED VIRGIN REPRINTS BY ALESSANDRO GRANDI Articles may be reproduced for non Andrea Angelini commercial purposes once permission has been granted by the managing editor CHORAL TECHNIQUE and the author. -

A Prima Vista
A PRIMA VISTA a survey of reprints and of recent publications 2002/1 BROEKMANS & VAN POPPEL Van Baerlestraat 92-94 Postbus 75228 1070 AE AMSTERDAM sheet music: 020-6796575 CDs: 020-6751653/fax: 020-6646759 also on INTERNET: www.broekmans.com e-mail: [email protected] 2 CONTENTS A PRIMA VISTA 2002/1 PAGE HEADING 03 PIANO 2-HANDS 07 PIANO 4-HANDS, 2 AND MORE PIANOS, HARPSICHORD 08 ORGAN 09 KEYBOARD 1 STRING INSTRUMENT WITHOUT ACCOMPANIMENT: 10 VIOLIN SOLO, VIOLA SOLO 1 STRING INSTRUMENT WITH ACCOMPANIMENT, piano unless stated otherwise: 11 VIOLIN WITH ACCOMPANIMENT 12 VIOLIN PLAY-ALONG 13 VIOLA WITH ACCOMPANIMENT, CELLO WITH ACCOMPANIMENT 14 VIOLA DA GAMBA WITH ACCOMPANIMENT 14 2 AND MORE STRING INSTRUMENTS WITH AND WITHOUT ACCOMPANIMENT: 1 WIND INSTRUMENT WITHOUT ACCOMPANIMENT: 18 FLUTE SOLO, OBOE SOLO 19 CLARINET SOLO, SAXOPHONE SOLO, BASSOON SOLO, TRUMPET SOLO 20 HORN SOLO, TROMBONE SOLO, TUBA SOLO 1 WIND INSTRUMENT WITH ACCOMPANIMENT, piano unless stated otherwise: 20 PICCOLO WITH ACCOMPANIMENT, FLUTE WITH ACCOMPANIMENT 22 FLUTE PLAY-ALONG, ALTO FLUTE WITH ACCOMPANIMENT 23 OBOE WITH ACCOMPANIMENT, OBOE PLAY-ALONG, CLARINET WIT ACCOMPANIMENT 24 CLARINET PLAY-ALONG 25 BASSETHORN WITH ACCOMPANIMENT, SAXOPHONE WITH ACCOMPANIMENT 27 SAXOPHONE PLAY-ALONG 28 BASSOON WITH ACCOMPANIMENT, TRUMPET WIT ACCOMPANIMENT 29 TRUMPET PLAY-ALONG, HORN WITH ACCOMPANIMENT 30 TROMBONE WITH ACCOMPANIMENT, TROMBONE PLAY-ALONG 31 TUBA WITH ACCOMPANIMENT, EUPHONIUM PLAY-ALONG 2 AND MORE WIND INSTRUMENTS WITH AND WITHOUT ACCOMPANIMENT: 31 2 AND MORE WOODWIND -

1 Nr. 108 Oktober 2019
Oktober 2019 Nr. 108 © Bistum Limburg 1 Aus dem Inhalt Zum Thema „… Flieg, kleiner Schmetterling, weil ich Dich nicht halten kann …“ Von Ursula Rieke 4 Komische Typen – diese Heiligen! Von Sr. M. Theresia Winkelhöfer ADJC 7 Kann ich trotz aller Skandale noch stolz darauf sein, zur Kirche zu gehören? Von Franz-Josef Ludwig 9 ADJC gestern Wie wurde aus dem ersten Häuschen das Mutterhaus? Von Sr. M. Gottfriedis Amend ADJC 11 ADJC aktuell Amtseinführung der neuen Generalleitung Von Sr. Judith Diltz ADJC 16 Der Dom bekommt eine neue Glocke Von STH 23 Katharina-to-go Von Sr. M. Clarentia Kurz ADJC 24 Heilige Edith Stein Von Hans-Jürgen Blanke 20 Katharina Kasper Katharinas Hingabe an Gott im Lied erfahrbar Von Sr. Annemarie Pitzl ADJC 26 Katharina liegt das Streben nach Heiligkeit am Herzen Von Katharina Kasper 28 Spuren der Heiligsprechung Von STH 30 In Memoriam 34 2 Editorial Liebe Schwestern, liebe Freunde unserer Gemeinschaft, heute halten Sie die letzte Ausgabe zum Thema Heiligkeit in Händen. Das Thema aber wird uns noch weiter begleiten, denn – Sie erinnern sich, nicht wahr?: „Ihr sollt heilig sein; denn ich bin heilig, der HERR, euer Gott.“ (Lev 19,2) Das ist ein Auftrag, der jede und jeden angeht, der sich Christ nennt. Katharina Kasper hat ganz ernst damit gemacht. In vielen ihrer Briefe fordert sie dazu auf, nach Heiligkeit zu streben (vgl. S. 28). Für sie ist das eine wichtige Aufgabe jeder einzelnen: Wir müssen „die Heiligkeit so recht erreichen wollen und als unsere größte Aufgabe erreichen. Was kann alles andere nützen.“ (Brief 191) Ja, sie ist sogar davon überzeugt, dass die eigene Heiligkeit die Voraus- setzung dafür ist, dass glaubwürdig Zeugnis gegeben werden kann. -

Katalog 2019 2 >
Katalog 2019 2 > Wer nicht neugierig ist, singt nichts Neues. Das sind wir > Neue Noten! Digitale Noten! Neugierig? > www.dehm-verlag.de Katalog 2019 Katalog Dehm Verlag Verlag Dehm 3 Das sind wir ... < > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust, und mehr… Der Dehm Verlag ist ein Partner für kreative Köpfe, die ihr musikalisches Schaffen und ihre Ideen in die Öffentlichkeit bringen möchten. Weil uns die Musik am Herzen liegt, weil Musik belebt, verbindet und bewegt, arbeiten wir mit Musiker/innen und Texter/innen stets an neuen Liedern und Chorwerken. Das sind wir > Patrick Dehm Cornelius Dehm Jürgen Kandziora 2019 Katalog Dehm Verlag Verlag Dehm Verleger: Patrick Dehm Dehm Verlag e.K. Rechte & Lizenzen: Cornelius Dehm Auf der Unterheide 40 Notensatz: Jürgen Kandziora 65549 Limburg/Lahn Gestaltung: Ulrike Mahr, Tel. +49 (0) 6431-71905 Mahr Graphic & Performing Arts, Kronach Fax +49 (0) 6431-976016 Preisänderungen, Lieferbarkeit und Irrtümer [email protected] vorbehalten. (Stand: Februar 2019) www.dehm-verlag.de 4 > Das sind wir ... > Chor- und Bandbücher, Liederbücher, Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, digitale Bücher, Leselust, und mehr… > Notenmaterial und Fortbildung Das ist unser Beitrag, damit sich neue Chöre gründen und bestehende Chöre neue Nahrung finden. Chöre und Kirchengemeinden suchen nach zeitgenössischen Texten und Musik. Das nehmen wir ernst und bieten modernes Notenmaterial an. Das sind wir Um unser Ziel zu erreichen, Chören zu lebendiger Musik und zeitgemäßer Sprache zu > verhelfen, haben wir Seminare mit Tagesworkshops, halbtägigem und ganztägigem offenen Singen und einer einwöchigen Fortbildung entwickelt. Infos zu den Fortbildungen finden sich auf unserer Website www.neuesgeistlicheslied.de. -

Denkmalzeitung 2005 13.07.2005 13:37 Uhr Seite 1
Denkmalzeitung 2005 13.07.2005 13:37 Uhr Seite 1 Zeitung zum »Tag des offenen Denkmals« in Hessen 11. September 2005 14. Jahrgang Herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege Krieg und Frieden Hessen Schloss Biebrich 65203 Wiesbaden »Suche Frieden und jage ihm nach« www.denkmalpflege- hessen.de audenkmale zwischen Vertraut- Aus dem Inhalt Bheit und Fremdheit geben uns zu denken. Mit dem Thema „Krieg Grußworte und Frieden“ wird 60 Jahre nach zum „Tag des offenen Kriegsende für den „Tag des offenen Denkmals“ 2 Denkmals” ein Schwerpunkt ge- wählt, der es unweigerlich mit sich Krieg und Frieden bringt, dass wir auch mit Denk- Das Schwerpunkt- mälern, Mahnmalen und Gedenk- thema 2005 3 stätten konfrontiert werden, die Nachdenklichkeit, ja, Unbehagen Denkmäler im verursachen. Es sind oftmals unbe- Spiegel der Als- queme und ungeliebte Denkmäler felder Geschichte wie Bunker, ehemalige Strafgefange- Schüler des Albert- nenlager, Kasernen, Kriegsruinen Schweitzer-Gym- oder Munitionsfabriken, die der nasiums zur sonst meist so gefälligen Denkmal- kunst drastisch gegenüber stehen. Spurensuche auf Baudenkmäler, die nicht schon dem Frauenberg 5 seit langem „dazu gehören“, die »Zweckmäßig, nicht als integriert gelten und die schön und sich nicht von selbst erklären, führen zwar oft in einem ersten Impuls zur würdig« Ablehnung und zur Konzentration Die ehemalige auf „identifikationsfähigere“ Epo- Coleman-Kaserne in chen, Gattungen, Objekte und Er- Gelnhausen 7 scheinungsweisen von Denkmälern. Der zweite Blick aber zeigt, wie Stadtluft macht wichtig es ist, dass es auch diese Heppenheim und die Starkenburg. Ölgemälde von August Lucas 1858 frei, braucht aber Zeugen unserer Vergangenheit gibt. feste Mauern Insbesondere Kriegsbezogenes gerät urch ihre faszinierende Aus- Ein Prachtexemplar dieser Spe- Kriegerdenkmäler sind uns in die- Alt-Büdingen heute rasch zum Fremdkörper und Dstrahlung und die Stimmung, zies ist die Starkenburg über dem sem Zusammenhang allen gegen- zwischen „Krieg wird abgewehrt, häufig so vehe- die sie verbreitet, ist wohl kaum Schlossberg in Heppenheim. -

Katalog Dehmverlag 2017 DRUCK.Indd
Katalog 2017 2 Neugierig? > Das sind wir ... NEUER Web-Shop! > Chorbücher , Liederbücher, > www.dehm-verlag.de Messen, Musicals, CDs, Kinderbücher, Leselust und mehr… Vielen ist unser breites Verlagsangebot mit modernen Beiträgen zum musika lischen Leben ein Grund, neu oder wieder einzukaufen. Dafür haben wir unseren Onlineshop überarbeitet. Unter www.dehm-verlag.de fi nden sich Notenbeispiele, Inhaltsverzeich- nisse der Bücher, YouTube Videos, Hintergrundinformationen und Rezensionen aus Das sind wir Fachzeitschriften. Wonach gehe ich bei der Auswahl? Immer häufi ger nach Empfehlungen und Kommen- > taren anderer Nutzer. Daher unsere Bitte: Gefällt Ihnen ein Artikel, sagen Sie es wei- ter. Sie helfen damit dem Verlag, den Autoren und unseren gemeinsamen Ideen. Sie fi nden die Buttons für Twitter, Facebook und E-Mail unter jeder Artikelbeschreibung auf unserer Website. Ihre Meinung können Sie auch allen anderen Besucherinnen und Besuchern unseres Web-Shops kundtun. Wenn Sie uns Ihre Rezension zusenden, werden wir diese veröf- Katalog 2017 Katalog fentlichen und Sie erhalten ein Präsent aus unserem Verlagsprogramm. Druckfrisch im neuen Verlagsprogramm sind 10 Neuerscheinungen. Darunter die Messe zum Emmaus-Gang „Feuer im Herzen“ von Helmut Schlegel und Winfried Heurich und die Messe „Lass die Liebe größer werden“ von Elvira und Johann Kreuz- pointner; von Georg Schemberg die Messe „Aus Erde und aus Geist“ und die Gospel- messe „Sing to God“ von Eugen Eckert und Kai Lünnemann. Dehm Verlag Verlag Dehm Ein Chorband zu Hochzeiten und Segnungen der Liebe mit 29 Liedern und Texten unter dem Titel „ Die Segel sind gesetzt“ will entdeckt werden. Neu ist das Pfi ngst-Oratorium„Feuerzungen“ von Eugen Eckert und Peter Reulein und das Oratorium „Laudato si“ von Helmut Schlegel und Peter Reulein sowie eine deutschsprachige mittelalterliche Mottete zum Lied der Liebe „Ich bin eine Blume zu Saron“. -

Spread the Word • Promote the Show • Support Public
Program No. 1610 3/7/2016 –Bernard Haas (1906 Link/Evangelical church, PETER MØLLER: 3 Meditations –Sven-Ingvart More March Marches and Corteges . we Giengen an der Brenz) Naxos 8.553926 Mikkelksen (1979 Frobenius/St. Peter’s Church, get the month off to a right and proper start by REGER: Aus tiefer Not, Op. 67, no. 3 –Christopher Kolding, Denmark) Point 5104 putting our left foot forward! Anderson (1951 Aeolian-Skinner, expanded/ SERGEI RACHMANINOFF: Easter –Kalevi Perkins Chapel, Southern Methodist University, Kiviniemi (1998 Berner/St. Matthew’s Church, GIUSEPPE VERDI (trans. Lemare): Grand March, Dallas, TX) SMU 2009 Stuttgart. Germany) Fuga 9207 fr Aida –Andrew Wilson (2004 Nicholson/Great BACH: Aus tiefer Not, BWV 686 –Olivier Vernet CALVIN HAMPTON: There’s a wideness in God’s Priory, Malvern, England) Regent 325 (1737 Treutmann/Grauhof Cloister, Goslar) mercy –Choir of All Saint’s Church/Thomas PHILIP PLAISTED: Grand March –Thomas Ligia Digital 0104077-99 Foster; Craig Phillips (1951 Casavants/All Saint’s Heywood (1929 Hill-2001 Schantz/Town Hall, BACH: Fugue in E-flat, BWV 552b –David Rothe Episcopal Church, Beverly Hills, CA) Gothic 49074 Melbourne, Australia) Pro Organo 7257 (1990 Yokota/California State University, KENNETH LEIGHTON: Et Ressurexit, Op. 49 ANDREW BOEX: Marche Champetre –Robert Chico, CA) CSU 001 –Dennis Townhill (1931 Harrison/St. Mary’s Scoggin (1967-1983 Sipe/Christ United REGER: Prelude & Fugue in d/D, Op. 65, nos. 7/8 Cathedral, Edinburgh, Scotland) Priory 326 Methodist Church, Rochester, MN) Pipedreams –Stefan Frank (1996 Rieger/Fulda Cathedral) Archive (r. 5/5/92) Program No. 1613 3/28/2016 Naxos 8.557186 WILLIAM LLOYD WEBBER: Dedication March The Phillips Factor . -

Moving Horns Will Move You, Keep You in Motion, and Will Inspire You to Move on in New Horn Adventures
Sound Innovation from an American Classic C.G. Conn 11DES French Horn conn-selmer.com INHOUDSTAFEL / TABLE OF CONTENTS MOVING AROUND AT IHS51 p.03 WELCOME AT IHS51 p.05 PROGRAM SCHEDULE p.09 CONCERTS p.29 FRINGE p.39 HISTORICAL HORN CONFERENCE p.45 LECTURES / WORKSHOPS p.57 MASTERCLASSES p.71 WAKE THE DRAGON! p.75 COMPETITIONS p.79 SOCIAL PROGRAM p.81 CURRICULA p.87 VENUES p.159 Become part of our century-old horn playing legacy, and study at the heart of vibrant Ghent! Our horn professors Rik Vercruysse and Jeroen Billiet will guide you through our English Master programs in classical music for horn and natural horn. WWW.SCHOOLOFARTSGENT.BE/EN Study Classical Music at Royal Conservatory Ghent 2 MOVING AROUND AT IHS51 SERVICE DESK Wijnaert Resto upon Unauthorized people Located in the Vestibulum showing their badge. cannot enter any indoor of Royal Conservatory, Access from the Cathedral symposium activity. the service desk is open side of the building and Badges are strictly daily 09:00-23:00 for take the elevator to the personal and can in no case 1 registration third floor. be transferred to someone 2 general information It is not possible to eat else. Badge Fraud will lead 3 bar tokens in Wijnaert Restaurant to immediate cancellation 4 tickets for social without a registered of your symposium program activities meal plan. entry right. (Brewery Visit, Don Ángel Wine Tasting, Canal Boat CLOAKROOM ELEVATOR Tour, Brussels MIM, (HORN DORM) The Elevator in the Banquet) & comple- A secured ‘horn dorm’ conservatory is strictly mentary concert tickets operates 09:00-23:00 reserved for IHS51 staff 5 cloakroom & from the service desk.