Jungen Welt« Vom 18
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Visual Arts in the Urban Environment in the German Democratic Republic: Formal, Theoretical and Functional Change, 1949–1980
Visual arts in the urban environment in the German Democratic Republic: formal, theoretical and functional change, 1949–1980 Jessica Jenkins Submitted: January 2014 This text represents the submission for the degree of Doctor of Philosophy (in partial fulfilment of its requirements) at the Royal College of Art Copyright Statement This text represents the submission for the degree of Doctor of Philosophy at the Royal College of Art. This copy has been supplied for the purpose of research for private study, on the understanding that it is copyright material, and that no quotation from this thesis may be published without proper acknowledgment. Author’s Declaration 1. During the period of registered study in which this thesis was prepared the author has not been registered for any other academic award or qualification. 2. The material included in this thesis has not been submitted wholly or in part for any academic award or qualification other than that for which it is now submitted. Acknowledgements I would like to thank the very many people and institutions who have supported me in this research. Firstly, thanks are due to my supervisors, Professor David Crowley and Professor Jeremy Aynsley at the Royal College of Art, for their expert guidance, moral support, and inspiration as incredibly knowledgeable and imaginative design historians. Without a generous AHRC doctoral award and an RCA bursary I would not have been been able to contemplate a project of this scope. Similarly, awards from the German History Society, the Design History Society, the German Historical Institute in Washington and the German Academic Exchange Service in London, as well as additional small bursaries from the AHRC have enabled me to extend my research both in time and geography. -
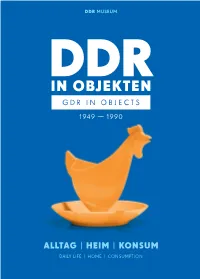
In Objekten Gdr in Objects
DDR MUSEUM DDR IN OBJEKTEN GDR IN OBJECTS GDR IN OBJECTS 1949 — 1990 1949 – 1990 1949 DDR IN OBJEKTEN DDR IN OBJEKTEN ALLTAG | HEIM | KONSUM DDR DAILY LIFE | HOME | CONSUMPTION MUSEUM DDR IN OBJEKTEN GDR IN OBJECTS 1949 – 1990 BAND EINS VOLUME ONE DANKSAGUNGEN Acknowledgments Ralf Graf Adelmann, Anett und Stephan Hüssen, Matthias Kaminsky Ralf Graf Adelmann, Anett und Stephan Hüssen, Matthias Kaminsky und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des DDR Museum. and the staff of the DDR Museum. Besonderer Dank gilt dem Sammlungsleiter des DDR Museum, Jörn Our special thanks to Jörn Kleinhardt, the head of collections at the Kleinhardt, sowie den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Samm- DDR Museum, and to the staff members in the collection department: lung: Maria Bartholomäus, Timotheus Götz, Frank Meißner sowie allen Maria Bartholomäus, Timotheus Götz, Frank Meißner. We also thank Objektspenderinnen und -spendern, ohne deren Großzügigkeit und En- everyone who donated their objects to the DDR Museum; without their DDR gagement es die Sammlung des DDR Museum nicht geben würde. generosity and commitment, the museum’s collection would not exist. IN OBJEKTEN GDR IN OBJECTS 1949 — 1990 Herausgeber [Publisher] Quirin Graf Adelmann v.A., Gordon Freiherr von Godin Projektleitung [Project management] Melanie Alperstaedt Text Quirin Graf Adelmann v.A., Dr. Stefan Wolle Edit Joris Buiks, Jörn Kleinhardt Lektorat [Copy-editing] Melanie Alperstaedt, Vanessa Jasmin Lemke Korrektorat [Correction] Shaya Zarrin Gestaltung [Design] Joris Buiks QUIRIN -

12. JAHRESAUKTION in Zusammenarbeit Mit Der Kunsthandlung Huber & Treff, Jena
JENAER KUNSTVEREIN e.V. 12. JAHRESAUKTION in Zusammenarbeit mit der Kunsthandlung Huber & Treff, Jena 9. Dezember 2017, 16 Uhr Galerie im Stadtspeicher Jena, Markt 16 Liebe Kunstfreunde, Jenaer Kunstverein e.V. Ihr Auktionsteam Galerie im Stadtspeicher Jürgen Conradi, JKV Auktion Nummer 12! Wer hätte vor über zwölf Jahren Markt 16, 07743 Jena Conny Dietrich, JKV gedacht, dass wir so lange erfolgreich zum Bieten aufru- Tel.: 03641-6369938 Armin Huber, Huber & Treff fen werden? Und dieses Mal kommt nahezu die zweifache Öffnungszeiten: Gerhard Pfeifer, JKV Anzahl an Objekten unter den Hammer. Die Jahresauktion des Jenaer Kunstvereins bleibt also eine beliebte Plattform Mi, Fr, Sa 12–16 Uhr, Do 12–19 Uhr Torsten Treff, Huber & Treff für Künstler, Händler, Sammler und Kunstliebhaber. Die (So–Di geschlossen) Auswahl an Objekten ist nicht nur vielfältig. Sie finden Auktionator zahlreiche Arbeiten von Künstlern, die sich erstmalig an der Volkmar Schorcht, JKV Auktion beteiligen – und sie finden in allen Sparten Angebote Vorbesichtigung von günstig bis hochwertig. 29. November – 2. Dezember Kontakt Der Katalog gibt Schätzpreise in Euro an. Der untere Wert 6. Dezember – 9. Dezember 2017 Jenaer Kunstverein e.V. ist in der Regel das Gebotslimit, der obere repräsentiert den zu den oben stehenden Öffnungszeiten im Stadtspeicher Jena aktuellen Marktwert und bietet somit eine Preisorientierung. Markt 16, 07743 Jena Sie finden die Vitae der Künstler am Ende des Kataloges. Der Aufruf erfolgt, sofern kein höheres schriftliches Gebot Tel.: 03641-6369938 vorliegt, zum niedrigsten Wert. Der Zuschlag erfolgt an den Auktion E-Mail für Gebote: [email protected] Höchstbietenden mit einem Aufgeld von unverändert 15 Pro- 9. -

East German Art Collection, 1946-1992
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/ft538nb0c2 No online items Guide to the East German art collection, 1946-1992 Processed by Special Collections staff; machine-readable finding aid created by Steven Mandeville-Gamble. Department of Special Collections Green Library Stanford University Libraries Stanford, CA 94305-6004 Phone: (650) 725-1022 Email: [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc © 2002 The Board of Trustees of Stanford University. All rights reserved. Guide to the East German art M0772 1 collection, 1946-1992 Guide to the East German art collection, 1946-1992 Collection number: M0772 Department of Special Collections and University Archives Stanford University Libraries Stanford, California Contact Information Department of Special Collections Green Library Stanford University Libraries Stanford, CA 94305-6004 Phone: (650) 725-1022 Email: [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc Processed by: Special Collections staff Encoded by: Steven Mandeville-Gamble © 2002 The Board of Trustees of Stanford University. All rights reserved. Descriptive Summary Title: East German art collection, Date (inclusive): 1946-1992 Collection number: M0772 Extent: 21 linear ft. (ca. 1300 items) Repository: Stanford University. Libraries. Dept. of Special Collections and University Archives. Language: English. Access Restrictions None. Publication Rights Property rights reside with the repository. Literary rights reside with the creators of the documents or their heirs. To obtain permission to publish or reproduce, please contact the Public Services Librarian of the Dept. of Special Collections. Provenance Purchased, 1995. Preferred Citation: East German art collection. M0772. Dept. of Special Collections, Stanford University Libraries, Stanford, Calif. Historical note The collection was put together by Jurgen Holstein, a Berlin bookseller. -

Lersch Gregor H.Pdf
GREGOR H. LERSCH „ART FROM EAST GERMANY?“ – DIE INTERNATIONALE VERFLECHTUNG DER KUNST IN DER DDR: AUSSTELLUNGEN, REZEPTION IM AUSLAND, TRANSFERS Veröffentlichung als ePublikation auf OPUS, dem Publikationsserver der Universitätsbibliothek der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder): https://opus4.kobv.de/opus4-euv/home Diese Arbeit wurde als Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) am 5.01.2021 angenommen. Betreut wurde die Dissertation von Prof. Dr. Christoph Asendorf und die Disputation fand am 18.12.2020 statt. Frankfurt (Oder), 2021 „Art from East Germany?“ – Die internationale Verflechtung der Kunst in der DDR: Ausstellungen, Rezeption im Ausland, Transfers 1. Einleitung 1.1. Untersuchungsgegenstand…………………………………………………………………………………………………………………… 1 1.2. Forschungsstand………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 1.3. Kunst in der DDR………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 1.4. Struktur……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 2. 1945-1951 2.1. „Kulturnost“ – Liberale Kulturpolitik in der frühen SBZ………………………………………………………………………… 21 2.2.1. Ausstellungen in der SBZ/DDR, die Wiedereröffnung der Berliner Nationalgalerie und Präsentationen internationaler Kunst…………………………………………………………………………………………………. 26 2.2.2. Die Wandbildaktion 1949 und der Einfluss des mexikanischen Muralismo…………………………………………. 38 2.2.3. Die Wiedereröffnung der Nationalgalerie in Berlin…………………………………………………………………………….. 45 2.3. Die Zeitschrift bildende -

Catalogue.Pdf
13. KUNSTAUKTION Auktion bedeutender Bildender Kunst des 17. - 21. Jh. Gemälde, Arbeiten auf Papier & Druckgrafik des 17.-21. Jh. Antiquitäten und Kunsthandwerk, Modernes Design Sammlung Glas des 19. Jh. und Murano Glas SCHMIDT KUNSTAUKTIONEN DRESDEN 1 Schmidt Kunstauktionen Dresden OHG | Bautzner Str. 6 | 01099 Dresden Tel: 0351 / 81 19 87 87 | Fax 81 19 87 88 www.schmidt-auktionen.de | [email protected] Annekathrin Schmidt M.A. | Kunsthistorikerin | Auktionatorin | 0177 / 690 37 38 James Schmidt | Auktionator | 0163 / 574 46 55 Hypo Vereinsbank | KNr 32774 28 76 | BLZ 850 200 86 IBAN DE50 8502 00 860 32 774 28 76 | SWIFT (BIC) HY VE DE MM 496 Amtsgericht Dresden | HRA 5662 Steuer Nr. 202 / 164 / 19104 USt-Id Nr DE 238 20 72 17 I N H A L T Z E I T A B L A U F A B K Ü R Z U N G E N / K A T A L O G A N G A B E N GEMÄLDE 17.–19. JH. Seite 2 - 18 ab 10.00 Uhr Für Objekte der bildenden Kunst werden Maße wie folgt angegeben: GEMÄLDE 20. JH. Seite 19 - 44 BA. Bildausschnitt (Passepartout) GRAFIK 17.–19. JH. FARBTEIL Seite 45- 48 ca. ab 11.00 Uhr Bl. Blatt GRAFIK 17.–19. JH. Seite 49- 67 Darst. Darstellung GRAFIK 20. JH. Seite 68 - 128 ca. ab 11.45 Uhr Pl. Platte Pause Ra. Rahmen Stk. Stock FOTOGRAFIE Seite 129 - 136 St. Stein GRAFIK 20. JH. FARBTEIL Seite 137 - 161 ca. ab 14.30 Uhr SKULPTUR & PLASTIK Seite 162 - 169 ca. -

Ostdeutschland Ost Leipzig 3
hochschule politisch akademisches journal aus ostdeutschland ost Leipzig 3. Quartal 1996 3/96 MEII\Jt HERREN, Ll:ID�� 5. Jahrgang IST DAS 'f'R.OGRAMM HIT l>EM l'P-.C>TOl,(OLL ABGEHÜ�Z T, l-llR. ISSN 0944-7989 11U�.S€N '!>AHE/t DI!: GANZ� 511l.UNG IJll;D€fl.-HOL�N! Thema & Autoren: FrauenforschungOst: Geschichte& BIianzdes Neubeginns: Renate Llebsch & Angelika Haas, Monika Stein, lrene Dölllng, Astrid Franzke, Ulrlke Dledrich & Heidi Stecker \iÖ. Weitere Beiträge von Relnhard Slegmund-Schultze, Burchard Brentjes, DieterWittlch,Claudia Salchow, LotharMertens,Wieland Kelnath,Manfred Cartoon: Oswald Huber I Baaue Wölfling, Karin Reiche, Bernd Markert, GOnterWlrthu.a. hochschule politisch- akademisches joumalaus ostdeutschland 0 s t· 3/96 Herausgegeben für den Arbeitskreis Hochschulpolitische Öffentlichkeit beim StuRa der Universität Leipzig von Peer Pasternack Redaktion: Sonja Brentjes, Frank Geißler, Monika Gibas, Matthias Middell, P·eer Pasternack, Georg Schuppener Redaktionsanschrift: Universität Leipzig, PF 920, 04009 Leipzig. Hausanschrift: Augustusplatz 11, 04109 Leipzig. Tel. (0341) 3027 855 und (0171) 614 61 64, Fax (0341) 97 37 859. E-Mail: [email protected]. hso im Internet: http:// www.uni-leipzig.de/~stura/sturaags.html#agoeff. hochschu/e ost erscheint quartalsweise. Schutzgebühren: Einzelheft DM 25,-. Jahresabonnement (4 Ausgaben) DM 98,-. Privatabonnentinnen DM 42,-. Nichtverdienende DM 31,-. (Abo-Gebühren incl. DM 10, Versandkosten) Konto: 45 37 343, Bayerische Vereinsbank Leipzig, BLZ 860 200 86. Die Artikel geben selbstverständlich nicht in jedem Falle Meinungen des Arbeitskrei ses HpÖ bzw. der Redaktion wieder. Die Redaktion lädt zur Einsendung von Manuskripten (Ausdruck+ Diskette) ein. Ein Veröffentlichungsanspruch besteht nicht. Gern. § 33 BDSG weisen wir unsere Abonnentinnen darauf hin, daß wir Namen und Anschrift ausschließlich zum Zweck der Abonnementverwaltung maschinell gespei chert haben. -

12. JAHRESAUKTION in Zusammenarbeit Mit Der Kunsthandlung Huber & Treff, Jena
JENAER KUNSTVEREIN e.V. 12. JAHRESAUKTION in Zusammenarbeit mit der Kunsthandlung Huber & Treff, Jena 9. Dezember 2017, 16 Uhr Galerie im Stadtspeicher Jena, Markt 16 Liebe Kunstfreunde, Jenaer Kunstverein e.V. Ihr Auktionsteam Galerie im Stadtspeicher Jürgen Conradi, JKV Auktion Nummer 12! Wer hätte vor über zwölf Jahren Markt 16, 07743 Jena Conny Dietrich, JKV gedacht, dass wir so lange erfolgreich zum Bieten aufru- Tel.: 03641-6369938 Armin Huber, Huber & Treff fen werden? Und dieses Mal kommt nahezu die zweifache Öffnungszeiten: Gerhard Pfeifer, JKV Anzahl an Objekten unter den Hammer. Die Jahresauktion des Jenaer Kunstvereins bleibt also eine beliebte Plattform Mi, Fr, Sa 12–16 Uhr, Do 12–19 Uhr Torsten Treff, Huber & Treff für Künstler, Händler, Sammler und Kunstliebhaber. Die (So–Di geschlossen) Auswahl an Objekten ist nicht nur vielfältig. Sie finden Auktionator zahlreiche Arbeiten von Künstlern, die sich erstmalig an der Volkmar Schorcht, JKV Auktion beteiligen – und sie finden in allen Sparten Angebote Vorbesichtigung von günstig bis hochwertig. 29. November – 2. Dezember Kontakt Der Katalog gibt Schätzpreise in Euro an. Der untere Wert 6. Dezember – 9. Dezember 2017 Jenaer Kunstverein e.V. ist in der Regel das Gebotslimit, der obere repräsentiert den zu den oben stehenden Öffnungszeiten im Stadtspeicher Jena aktuellen Marktwert und bietet somit eine Preisorientierung. Markt 16, 07743 Jena Sie finden die Vitae der Künstler am Ende des Kataloges. Der Aufruf erfolgt, sofern kein höheres schriftliches Gebot Tel.: 03641-6369938 vorliegt, zum niedrigsten Wert. Der Zuschlag erfolgt an den Auktion E-Mail für Gebote: [email protected] Höchstbietenden mit einem Aufgeld von unverändert 15 Pro- 9. -

Terrified by the Close Other. Is the Postwar History of German Art Ready to Embrace "State Functionaries"?
RIHA Journal 0249 | 31 August 2020 Terrified by the Close Other. Is the Postwar History of German Art Ready to Embrace "State Functionaries"? Justyna Balisz-Schmelz Wersja polska dostępna pod adresem / Polish version available at: https://www.riha-journal.org/articles/2020/0248-balisz-schmelz-PL (RIHA Journal 0248) Abstract The article sets out to investigate the fundamental problem for the methodology of postwar German art history, namely, the unavoidable fusion of two markedly different perspectives, i.e., those of East and West Germany, into a coherent narrative. The reconstruction of key exhibitions and controversies sparked by East German art, in 1989 and beyond, suggests that the revision of the canon of art history may be faced with greater challenges whenever adopting the perspective of the close Other (political or ideological), rather than that of a remote Other (ethnic or cultural). The incorporation of the close Other into a uniform narrative on art history can be a moot point, most notably in those cases where the western concept of art calls for a necessary restatement, and one's identity needs to be critically redefined in the process. This is best exemplified by what happened in Germany after 1989. Contents Introduction Two art histories in one polity Between the canon and the scrapyard of history A new interpretation for the new millennium Faces of Otherness Postcolonialism: better than Postsocialism? Conclusions Introduction [1] On the occasion of celebrating German reunification, which took place on 2 October 1990 at the Bundestag, Günter Grass (1927–2015) delivered a rather sorrowful address. His speech seems to be vital for several reasons. -

August – Dezember
August – Dezember Programm 2017 Friedrich-Wolf-Gesellschaft 5 Alter Kiefernweg Lehnitz | OT 16515 Oranienburg 03301 524480 [email protected] 100. Jahrestag der Oktoberrevolution Impressum Unsere Partner und Förderer Friedrich-Wolf-Gesellschaft e. V. Alter Kiefernweg 5 16515 Lehnitz (03301) 52 44 80 Friedrich-Wolf-Gesellschaft kontakt @ friedrichwolf.de www.friedrichwolf.de Vorstand Für die Bereitstellung der Fotos bedanken wir uns bei Paul Werner Wagner | Vorsitzender • Deutsche Kinemathek | DEFA-Stiftung Prof. Dr. Thomas Naumann | Stellvertreter • Privatarchive Honert, Karney, Stempel, Paris, Familie Wolf Eberhard Meyer | Schatzmeister Titelfoto: Conrad Felixmüller: Menschen über die Welt, 1919 Tatjana Trögel | Leiterin Gedenkstätte Bildnachweis Privatarchiv der Familie Wolf | Titelfoto, S. 22; ©Günther Wolfram | S. 4; Dr. Frank Bugenhagen-Gölden © Markus Nowak | S. 5; Rat der Götter©DEFA-Stiftung; Privatarchiv Honert | S. 9; © Steffen Mühle | S. 11; Glück im Hinterhaus ©DEFA-Stiftung / Herbert Kroiss | S. 12; Der Bruch ©DEFA-Stiftung / Waltraut_Pathenheimer | S. 14 Uwe Radack © Judah Passow | S. 15; Privatarchiv Ronald Paris | S. 17; ©ratatosk[at]ratatosk.de/Wikimedia | S. 18; Magdalena Wanitschek Irgendo in Berlin©DEFA-Stiftung / Kurt Wunsch; Privatarchiv Jürgen Karney, Jörg Stempel | S. 20; Grüne Hochzeit©DEFA-Stiftung / Herbert Kroiss Dr. Michael Wolf ФРИДРИХШТРАССЕ 176-179, БЕРЛИН 10117 Wir danken der Druckerei vierC print+mediafabrik GmbH & Co. KG für die freundliche Unterstützung. Unser Programm finden Sie digital unter: -

East German Poster Collection, Series 4: Art Exhibition Posters, Special
East German Poster Collection, Series 4: Art Exhibition Posters, Special Collections and Archives, GMU Libraries item: AE‐0001 title: Sowjetishes Künstlerishes Glas und Gobelins date: 1977 size (cm): 57.5 x 81 summary: This poster is green with a center image of a blue blown glass vase holding blown glass flowers. It is for an art exhibit of Soviet glass and tapestries at the Exhibition Center in Berlin (July ‐ August 1977). item: AE‐0002 title: Ausstellung Glas aus zwei Jahrtausenden date: 1977 size (cm): 57 x 81 summary: This poster shows an ornate glass vase painted with scenes of villages and people. It is for an exhibit of glass art at the State Gallery in Halle (August 1977 ‐ July 1978). item: AE‐0003 title: Grafik zur Sowjetischen Literatur date: 1977 size (cm): 81 x 57 summary: This poster shows a black and white painting of stylized people spinning in a vortex surrounded by a Soviet cityscape. It is for an exhibit of art in Soviet literature at the Club of Culture in Berlin (October 15, 1977 ‐ November 8, 1977). item: AE‐0004 title: Galerie der Fruendschaft 1973 date: 1973 size (cm): 58.5 x 84 summary: This poster shows a black and white painting of young child in the style of folk art. Behind the child are five circles of bright colors. It is for an exhibit entitled "Gallery of Friendship" at the State Museum in Schwerin (June ‐ July 1973). item: AE‐0005 title: Hans Grundig date: 1973 size (cm): 57 x 81 summary: This poster shows a painting of a pack of wolves surrounding a larger wolf in the middle. -
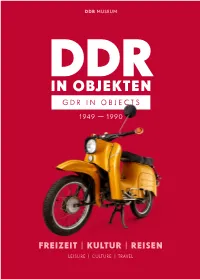
In Objekten Gdr in Objects
DDR MUSEUM DDR IN OBJEKTEN GDR IN OBJECTS GDR IN OBJECTS 1949 — 1990 1949 – 1990 1949 DDR IN OBJEKTEN DDR IN OBJEKTEN FREIZEIT | KULTUR | REISEN DDR LEISURE | CULTURE | TRAVEL MUSEUM DDR IN OBJEKTEN GDR IN OBJECTS 1949 – 1990 BAND ZWEI BOOK TWO DANKSAGUNGEN Acknowledgments Ralf Graf Adelmann, Anett und Stephan Hüssen, Matthias Kaminsky Ralf Graf Adelmann, Anett and Stephan Hüssen, Matthias Kaminsky und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des DDR Museum. and the staff of the DDR Museum. Besonderer Dank gilt dem Sammlungsleiter des DDR Museum, Jörn Our special thanks to Jörn Kleinhardt, the head of collections at the Kleinhardt, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Sammlung, DDR Museum, and to the staff members in the collection department: Maria Bartholomäus, Timotheus Götz, Frank Meißner, sowie allen Maria Bartholomäus, Timotheus Götz, Frank Meißner. We also thank Objektspenderinnen und -spendern, ohne deren Großzügigkeit und En- everyone who donated their objects to the DDR Museum; without their DDR gagement es die Sammlung des DDR Museum nicht geben würde. generosity and commitment, the museum’s collection would not exist. IN OBJEKTEN GDR IN OBJECTS 1949 — 1990 Herausgeber [Publisher] Quirin Graf Adelmann v.A., Gordon Freiherr von Godin Projektleitung [Project management] Melanie Alperstaedt Text Quirin Graf Adelmann v.A., Dr. Stefan Wolle Edit Joris Buiks, Jörn Kleinhardt Lektorat [Copy-editing] Melanie Alperstaedt, Vanessa Jasmin Lemke Korrektorat [Correction] Dr. Laura Gemsemer, sprachraum-schoeneberg.de/Derek Shee- ler