Schöner Tod Die Euthanasiemapnahmen An
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Und Gedenkort Schloss Hartheim Bei Linz – Ein Projekt Zur Auseinandersetzung Mit Der NS-Euthanasie Von 1940 – 1944
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim bei Linz – ein Projekt zur Auseinandersetzung mit der NS-Euthanasie von 1940 – 1944 Verfasserin Jaqueline Kastler angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2016 Studienkennzahl lt. Studienblatt A 190 313 299 Studienrichtung lt. Studienblatt Lehramt UF Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung, UF Psychologie – Philosophie Betreuer Univ.-Prof. Mag. DDr. Oliver Rathkolb 1 Danksagung Zu Beginn meiner Diplomarbeit möchte ich all jenen danken, die mich im Laufe meiner Studienzeit unterstützt haben und beim Entstehen der Diplomarbeit beteiligt waren. Ein besondere Dank gilt meinem Diplomarbeitsbetreuer Univ.-Prof. Mag. DDr. Oliver Rathkolb, der mit vielen weiterführenden Ideen, Geduld und enormen Fachwissen mich während meiner Diplomarbeit betreut hat. Weiters bedanke ich mich recht herzlich bei Frau Mag. Irene Zauner-Leitner, der stellvertretenden Leiterin des Lern- und Gedenkortes Schloss Hartheim, für das interessante und informative Interview und der Unterstützung und Mithilfe beim Entstehen der Diplomarbeit. Besonders großer Dank gebührt meinen Eltern, die mein Studium durch Vertrauen, finanzielle Unterstützung und enorme Geduld erst überhaupt ermöglicht haben. Ohne diese seelische Unterstützung und ständige Motivation wäre diese Diplomarbeit nicht entstanden. Ich danke meinem Freund Marco für seine liebevolle Unterstützung während meiner Studienzeit, den aufmunternden und anspornenden Worten und sein großes Verständnis. Nicht zuletzt bedanke ich mich bei meinen Freunden für das Interesse an meiner Arbeit, der Motivation und dem Verständnis. DANKE! 2 Offizielle Bestätigung Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich die vorliegende Diplomarbeit eigenständig verfasst und nur die in der Arbeit ausdrücklich benannten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wien, am 3.1.2016 Jaqueline Kastler 3 Inhaltsverzeichnis I. -

Nurses and Midwives in Nazi Germany
Downloaded by [New York University] at 03:18 04 October 2016 Nurses and Midwives in Nazi Germany This book is about the ethics of nursing and midwifery, and how these were abrogated during the Nazi era. Nurses and midwives actively killed their patients, many of whom were disabled children and infants and patients with mental (and other) illnesses or intellectual disabilities. The book gives the facts as well as theoretical perspectives as a lens through which these crimes can be viewed. It also provides a way to teach this history to nursing and midwifery students, and, for the first time, explains the role of one of the world’s most historically prominent midwifery leaders in the Nazi crimes. Downloaded by [New York University] at 03:18 04 October 2016 Susan Benedict is Professor of Nursing, Director of Global Health, and Co- Director of the Campus-Wide Ethics Program at the University of Texas Health Science Center School of Nursing in Houston. Linda Shields is Professor of Nursing—Tropical Health at James Cook Uni- versity, Townsville, Queensland, and Honorary Professor, School of Medi- cine, The University of Queensland. Routledge Studies in Modern European History 1 Facing Fascism 9 The Russian Revolution of 1905 The Conservative Party and the Centenary Perspectives European dictators 1935–1940 Edited by Anthony Heywood and Nick Crowson Jonathan D. Smele 2 French Foreign and Defence 10 Weimar Cities Policy, 1918–1940 The Challenge of Urban The Decline and Fall of a Great Modernity in Germany Power John Bingham Edited by Robert Boyce 11 The Nazi Party and the German 3 Britain and the Problem of Foreign Office International Disarmament Hans-Adolf Jacobsen and Arthur 1919–1934 L. -
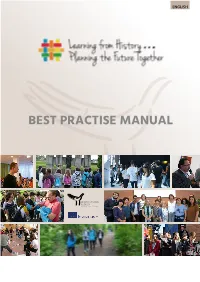
BEST PRACTISE MANUAL Best Practice Manual
ENGLISH BEST PRACTISE MANUAL Best Practice Manual Contents AUDIOWALK GUSEN – GUSEN, AUSTRIA ........................................................................................... 2 DENK.STATT Johann Gruber –TEACHING BOX ................................................................................. 6 INVESTING IN DEMOCRACY – A Project by the city of Empoli .......................................................... 12 EDUCARE ALLE PACE (The biggest Memorial) – The Project by the city of Vinci ............................. 16 PROYECTO ALT EMPORDÀ – MAUTHAUSEN .................................................................................. 20 A JOURNEY TO THE CONCENTRATION CAMPS ............................................................................. 20 VIDEO INTERVIEWS WITH CONTEMPORARY WITTNESSES- Educational Work Guidelines ........ 24 ROUTES OF EXILE AT „MUSEO MEMORIAL DEL EXILIO” (MUME)................................................. 26 Dr. Christian Angerer - Assessment of the Contributions for the Best Practice Handbook .................. 29 1 Best Practise Manual AUDIOWALK GUSEN – first draft 2018 AUDIOWALK GUSEN – GUSEN, AUSTRIA The AUDIOWALK GUSEN is an art project About 37,000 of the approximately 120,000 created by Christoph Mayer on dealing with the camp victims who perished within present-day memory and the life on the grounds of the Austrian territory were killed in and around the former concentration camp Gusen I and II camps Gusen I, II & III: Many of the victims (Upper Austria). were political opponents of -

AGE of FEAR-ED GUIDE INTERIOR.Indd 1 11/27/12 7:58 PM Important Information for Readers
EDUCATOR’S GUIDE PSYCHIATRY’S REIGN OF TERROR 11/27/12 7:58 PM ENG-22142-03-AGE OF FEAR-ED GUIDE INTERIOR.indd 1 Important Information for Readers This Educator’s Guide and the accompanying DVD, The Age of Fear: Psychiatry’s Reign of Terror, provide insight into psychiatry’s long history of human rights abuses, culminating in the conceiving, ii organizing and running of the sterilization and extermination campaigns of Nazi Germany. For decades afterward, leading psychiatrists in Germany and around the world consistently denied or greatly minimized their profession’s main role in Nazi Germany’s euthanasia atrocities. But in fact, psychiatric atrocities have never really ended, and today extend to contemporary practices such as psychosurgery, electroshock and powerful mind-altering psychotropic drugs. Is any of this even medically justified? In medicine, strict criteria exist for calling a condition a disease: a predictable group of symptoms and the cause of the symptoms or an understanding of their physiology (function) must be proven and established. Diseases are proven to exist by objective evidence and physical tests. The same can not be said of mental disorders, which are assigned to the person on the basis of opinion. As the late Dr. Thomas Szasz, Professor of Psychiatry Emeritus, observed, “There is no blood or other biological test to ascertain the presence or absence of a mental illness, as there is for most bodily diseases.” Does this mean that people don’t have “ups and downs,” or feel unhappy or anxious, sometimes for long periods of time? Of course not. It does mean that because these conditions cannot be proven medically, they do not need to be treated with powerful, side effect-laden psychiatric drugs that only mask the real underlying problem. -

Euthanasie"-Verbrechen Musste Man Sich Bisher Vor Allem Auf Nachträglich Entstandene Prozessakten Stützen
79 Bei der Rekonstruktion der „Euthanasie"-Verbrechen musste man sich bisher vor allem auf nachträglich entstandene Prozessakten stützen. In einem Sonderarchiv des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR sind nun fast 30.000 Krankenakten aufge taucht, die es erlauben, den „Verwaltungsmassenmord'' (Hannah Arendt) an psychisch Kranken und geistig Behinderten minutiös nachzuzeichnen. Annette Hinz-Wessels, Petra Fuchs, Gerrit Hohendorf, Maike Rotzoll Zur bürokratischen Abwicklung eines Massenmords Die „Euthanasie"-Aktion im Spiegel neuer Dokumente Die Kenntnisse über die Planung und Durchführung der nationalsozialistischen Krankenmordaktion „T4"1 beruhen vor allem auf den Überlieferungen der betroffenen Anstalten und ihrer übergeordneten Verwaltungsbehörden sowie auf Zeugenvernehmungen und Täteraussagen, die im Zuge strafrechtlicher Ermitt lungen nach 1945 entstanden. Die internen Aufzeichnungen und Akten der eigentlichen „Euthanasie"-Verwaltungszentrale, der „Zentraldienststelle" in der Berliner Tiergartenstraße 4, sind seit Kriegsende verschollen2. Erst nach der Wende 1989/90 entdeckte man in einem Sonderarchiv des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR in Berlin-Hohen schönhausen fast 30.000 Krankenakten eben jener ca. 70.000 Opfer, die 1940/ 41 im Rahmen der „Aktion T4" in einer der insgesamt sechs Tötungsanstal- 1 Das Kürzel „T4", abgeleitet von der Adresse der „Euthanasie"-Organisationszentrale in der Berliner Tiergartenstraße 4, ist keine nationalsozialistische Tarnbezeichnung, sondern wird erst nach 1945 in -

Medical Ethics in the 70 Years After the Nuremberg Code, 1947 to the Present
wiener klinische wochenschrift The Central European Journal of Medicine 130. Jahrgang 2018, Supplement 3 Wien Klin Wochenschr (2018) 130 :S159–S253 https://doi.org/10.1007/s00508-018-1343-y Online publiziert: 8 June 2018 © The Author(s) 2018 Medical Ethics in the 70 Years after the Nuremberg Code, 1947 to the Present International Conference at the Medical University of Vienna, 2nd and 3rd March 2017 Editors: Herwig Czech, Christiane Druml, Paul Weindling With contributions from: Markus Müller, Paul Weindling, Herwig Czech, Aleksandra Loewenau, Miriam Offer, Arianne M. Lachapelle-Henry, Priyanka D. Jethwani, Michael Grodin, Volker Roelcke, Rakefet Zalashik, William E. Seidelman, Edith Raim, Gerrit Hohendorf, Christian Bonah, Florian Schmaltz, Kamila Uzarczyk, Etienne Lepicard, Elmar Doppelfeld, Stefano Semplici, Christiane Druml, Claire Whitaker, Michelle Singh, Nuraan Fakier, Michelle Nderu, Michael Makanga, Renzong Qiu, Sabine Hildebrandt, Andrew Weinstein, Rabbi Joseph A. Polak history of medicine Table of contents Editorial: Medical ethics in the 70 years after the Nuremberg Code, 1947 to the present S161 Markus Müller Post-war prosecutions of ‘medical war crimes’ S162 Paul Weindling: From the Nuremberg “Doctors Trial” to the “Nuremberg Code” S165 Herwig Czech: Post-war trials against perpetrators of Nazi medical crimes – the Austrian case S169 Aleksandra Loewenau: The failure of the West German judicial system in serving justice: the case of Dr. Horst Schumann Miriam Offer: Jewish medical ethics during the Holocaust: the unwritten ethical code From prosecutions to medical ethics S172 Arianne M. Lachapelle-Henry, Priyanka D. Jethwani, Michael Grodin: The complicated legacy of the Nuremberg Code in the United States S180 Volker Roelcke: Medical ethics in Post-War Germany: reconsidering some basic assumptions S183 Rakefet Zalashik: The shadow of the Holocaust and the emergence of bioethics in Israel S186 William E. -
I Tourist Information Places of Remembrance for the Nazi Period 1
NATO is formed. Foundation Paris The United Nations The People’s Republic Treaty of Rome Moon landing Fall of of the Republic Peace Treaties Spanish Civil War is established of China is proclaimed (EEC is established) Chernobyl the Berlin European Union formed, of Austria First mobile phones Nuclear Accident Wall Maastricht Treaty Fukushima Prague Spring. Nuclear „Brexit“- The League of Anschluss: the annexation The FRG and the GDR Revolutions in Hungary and Poland Worldwide student Ongoing War Arab Spring Accident Referendum Russian Revolution Nations is founded of Austria by Nazi Germany are established protests Oil price shock Soviet-Afghan War Yugoslav Wars in Afghanistan Stock exchange Construction Mussolini’s crash and global Hitler seizes Popular uprising The Warsaw of the Global Civil war Ongoing War First World War March on Rome economic crisis power in Germany Second World War Israel is founded in the GDR Pact is formed Berlin Wall Vietnam War Iran-Iraq War Persian Gulf War Austria entry in the EU Iraq War Financial Crisis in Syria in Ukraine 1917 1915 1918 1981 2011 1914 1961 1919 1991 1977 1974 1975 1957 1973 2017 1947 1922 1970 1952 1979 1923 1924 1928 1955 1935 1953 1933 2015 1985 2013 1938 1992 1929 2018 1988 1954 1934 1995 1956 1965 1945 2014 1936 1984 1993 1939 1986 1968 1989 1948 2016 1920 1964 1994 1996 1966 1969 1949 1950 1930 1980 2001 2010 1960 1990 1940 2007 2003 2008 2004 2009 2000 Incorporation of Incorporation of The Parkbad Civil War Nazi persecution Liberation Neue Galerie LD steelworks officially University of Social and The new syna- The Bruckner- forum metall exhi- Posthof Linz designated Social programme National Socialism in Linz Haupt- Linz: European Centurial Start new St. -

Memorialization of the National Socialist Aktion T4 Euthanasia Programme
Lives Worthy of Life and Remembrance: Memorialization of the National Socialist Aktion T4 Euthanasia Programme by Meaghan Ann Hepburn A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of Germanic Languages and Literatures University of Toronto © Copyright by Meaghan Ann Hepburn 2014 Meaghan Ann Hepburn Degree of Doctor of Philosophy (2014) Department of Germanic Languages and Literatures University of Toronto “Lives Worthy of Life and Remembrance: Memorialization of the National Socialist Aktion T4 Euthanasia Programme Abstract It is estimated that over 70,000 German and Austrian victims deemed mentally and physically disabled by the Nazis lost their lives in the National Socialist euthanasia programmed entitled Aktion T4. These murders prove to be the first instance of mass gassings of a selection of society deemed unwanted, and provided the intellectual and technological framework that was employed in the Extermination Camps. And yet a void in memorialization exists for the topic. Deficient memorialization of such a historically important event in German and Austrian society raises questions as to why this Nazi programme was not memorialized to the same degree as other historical events and victim groups of the Holocaust. The scarce number of representations of the victims in the forms of literature, art, monuments and memorials is indicative of a reluctance or selective remembering of the topic in WWII memorialization practices. The void in memorialization of Aktion T4 is founded in three important and influential factors. Firstly, the negative stigmas associated with mental and physical disabilities, both in confronting the topic, but also presenting it on public display. -

Reflections on Memory, the Common Good, and Being Human
Reflections on Memory, the Common Good, and Being Human Author(s): Margo Borders, Patrick Calderon, Juanita Esguerra, Kevin Kho, Tracy-Lynn Lockwood, Andrew Mach, Theodore Mueller, Adrian Pacurar, Clemens Sedmak, Rachel Ziegler 2018, 2 CSC Occasional Paper Series The Center for Social Concerns at the University of Notre Dame is an academic institute committed to research in the areas of Catholic social tradition and community-engaged learning and scholarship. The Occasional Papers Series was created to contribute to the common good by sharing the intellectual work of the Center work with a wider public. It makes available some of the lectures, seminars, and conversations held at the Center. The papers in the series are available for download free of charge; as long as proper credit is given they can be used as any other academic reference. Reflections on Memory, the Common Good, and Being Human University of Notre Dame, Notre Dame, IN INTRODUCTION The following is an exercise in the communication of memories; a group of young adults, all graduate students from the University of Notre Dame, traveled to Germany and Austria for a week in spring 2018 to experience Holocaust memorial sites. The immersion was part of the “Common Good Initiative” and intended to provide access to the cultivation of a “thick sense” of the Holocaust, a creative understanding of an ethics of remembering and its connections to Catholic Social Tradition. Remembering can be understood to mean: putting the fragments of the past together; making memories whole; healing memories; connecting the past and the future. A proper culture of remembering is an important aspect of the common good. -

Download a Pdf Copy of the Publication
In Germany and occupied Austria, people with disabilities were the first to fall victim to National Socialist mass murder, propa- IHRA gated under the euphemistic term of “euthanasia”. For racist and economic reasons they were deemed unfit to live. The means and methods used in these crimes were applied later during the Holocaust— perpetrators of these first murders became experts in the death camps of the so-called “Aktion Reinhardt”. International Holocaust Remembrance Alliance (Ed.) Over the course of World War II the National Socialists aimed to exterminate people with disabilities in the occupied territories of Mass Murder of People with Western Europe, and also in Eastern Europe. This publication presents the results of the latest research on Disabilities and the Holocaust these murders in the German occupied territories, as discussed at an IHRA conference held in Bern in November 2017. Edited by Brigitte Bailer and Juliane Wetzel Mass Murder of People with Disabilities and the Holocaust the and Disabilities with People of Murder Mass ISBN: 978-3-86331-459-0 9 783863 314590 us_ihra_band_5_fahne.indd 1 11.02.2019 15:48:10 IHRA series, vol. 5 ihra_5_fahnen Nicole.indd 2 29.01.19 13:43 International Holocaust Remembrance Alliance (Ed.) Mass Murder of People with Disabilities and the Holocaust Edited by Brigitte Bailer and Juliane Wetzel ihra_5_fahnen Nicole.indd 3 29.01.19 13:43 With warm thanks to Toby Axelrod for her thorough and thoughtful proofreading of this publication, and Laura Robertson from the Perma- nent Oce of IHRA for her support during the publication procedure. ISBN: 978-3-86331-459-0 ISBN (E-Book): 978-3-86331-907-6 © 2019 Metropol Verlag + IHRA Ansbacher Straße 70 10777 Berlin www.metropol-verlag.de Alle Rechte vorbehalten Druck: buchdruckerei.de, Berlin ihra_5_fahnen Nicole.indd 4 29.01.19 13:43 Content Declaration of the Stockholm International Forum on the Holocaust .......................................... -
Dachau Concentration Camp from Wikipedia, the Free Encyclopedia Coordinates: 48°16′08″N 11°28′07″E
Create account Log in Article Talk Read Edit View history Dachau concentration camp From Wikipedia, the free encyclopedia Coordinates: 48°16′08″N 11°28′07″E Dachau concentration camp (German: Konzentrationslager (KZ) Dachau, IPA: [ˈdaxaʊ]) was the Navigation Dachau first of the Nazi concentration camps opened in Germany, intended to hold political prisoners. It is Main page located on the grounds of an abandoned munitions factory near the medieval town of Dachau, Concentration camp Contents about 16 km (9.9 mi) northwest of Munich in the state of Bavaria, in southern Germany.[1] Opened Featured content in 1933 by Heinrich Himmler, its purpose was enlarged to include forced labor, and eventually, the Current events imprisonment of Jews, ordinary German and Austrial criminals, and eventually foreign nationals Random article from countries which Germany occupied or invaded. It was finally liberated in 1945. Donate to Wikipedia In the postwar years it served to hold SS soldiers awaiting trial, after 1948, it held ethnic Germans who had been expelled from eastern Europe and were awaiting resettlement, and also was used for Interaction a time as a United States military base during the occupation. It was finally closed for use in 1960. Several memorials have been installed there, and the site is open for visitors. Help American troops guarding the main entrance to About Wikipedia Contents Dachau just after liberation, 1945 Community portal 1 History Recent changes 2 General overview Contact Wikipedia 3 Main camp 3.1 Purpose Toolbox 3.2 Organization -
Spring 2013 (PDF)
THE BULLETIN OF THE CAROLYN AND LEONARD MILLER CENTER FOR HOLOCAUST STUDIES SPRING 2013 The Bulletin OF THE CAROLYN AND LEONARD MILLER CENTER FOR HOLOCAUST STUDIES VOLUME 17 THE UNIVERSITY OF VERMONT SPRING 2013 Jewish Children with Disabilities and Nazi “Euthanasia” Crimes by Lutz Kaelber, UVM Dept. of Sociology ([email protected]) In memory of Henry Friedlander A Child with a Disability Erwin Sänger was born into a Jewish family in Hamburg in 1935. these children and Jewish adults with disabilities in Nazi Germany. First I He had an older brother, Jacob, whom his parents put on a children’s briefly discuss the rise of social Darwinist thought in the Weimar Republic. transport, or Kindertransport, to England.1 Erwin Sänger’s mother I then turn to measures of Nazi “racial hygiene” affecting disabled Jews, and father, Flora and Willy Sänger, were deported to Theresienstadt in particularly the murder of (mostly adult) institutionalized patients in the 1942 and died in Auschwitz in 1944. Curiously enough, seven-year old so-called “T4” program, before presenting case studies of children murdered Erwin was not deported along with his parents, even though it would in the “children’s euthanasia” program. have been easy enough to do. Instead, on the very day his parents were Death and Disability in the Weimar Republic deported, the Gestapo had him placed in the “special The experience of WWI in psychiatric hospitals and children’s ward” at Hamburg-Langenhorn, his expenses to be paid for by Hamburg’s association the publication of a widely discussed book by a jurist of Jews.