1954-Heimatkundliches Aus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Rhaeto-Romance Languages
Romance Linguistics Editorial Statement Routledge publish the Romance Linguistics series under the editorship of Martin Harris (University of Essex) and Nigel Vincent (University of Manchester). Romance Philogy and General Linguistics have followed sometimes converging sometimes diverging paths over the last century and a half. With the present series we wish to recognise and promote the mutual interaction of the two disciplines. The focus is deliberately wide, seeking to encompass not only work in the phonetics, phonology, morphology, syntax, and lexis of the Romance languages, but also studies in the history of Romance linguistics and linguistic thought in the Romance cultural area. Some of the volumes will be devoted to particular aspects of individual languages, some will be comparative in nature; some will adopt a synchronic and some a diachronic slant; some will concentrate on linguistic structures, and some will investigate the sociocultural dimensions of language and language use in the Romance-speaking territories. Yet all will endorse the view that a General Linguistics that ignores the always rich and often unique data of Romance is as impoverished as a Romance Philogy that turns its back on the insights of linguistics theory. Other books in the Romance Linguistics series include: Structures and Transformations Christopher J. Pountain Studies in the Romance Verb eds Nigel Vincent and Martin Harris Weakening Processes in the History of Spanish Consonants Raymond Harris-N orthall Spanish Word Formation M.F. Lang Tense and Text -

Feldschiessen / Tir En Campagne 2018 GR 300M
Feldschiessen / Tir en campagne 2018 GR 300m Rang Resultat Schütze Jahrgang Auszeichn. Waffe Verein Résultat Tireur Né en Mention Arme Société 1 71 Gadient Reto 1962 S KA AK Kar Chur Schützengesellschaft der Stadt Chur 2 70 Maurer Georg 1965 S KA AK 57 Felsberg Feldschützen 3 70 Brunold Bini 1965 S KA AK 90 Maladers Feldschützengesellschaft 4 70 Jäger Andreas 1965 S KA AK 57 Peist Schützenverein 5 69 Obrecht Andrea 1963 S KA AK 57 Trimmis Feldschützengesellschaft 6 69 Bürkli Daniel 1980 E KA AK 90 Zizers Schützenverein Zizers-Untervaz 7 69 Lüthi Reto 1980 E KA AK 90 Fläsch Vereinigte Schützenges. St.Luzisteig 8 69 Meuli Claudio 1984 E KA AK Kar Says Feldschützengesellschaft 9 68 Gansner Peter 1941 SV KA AK 90 Chur Freischützen Grütli 10 68 Bieler Alfons 1945 SV KA AK 90 Bonaduz Schützenverein 11 68 Kohler Christian 1956 V KA AK 57 Malix Schützenverein 12 68 Hunger Reto 1962 S KA AK 57 Chur Schützengesellschaft der Stadt Chur 13 68 Davatz Jakob 1963 S KA AK 57 Malans Schützenverein 14 68 Schlegel Rudolf 1963 S KA AK 57 Jenins Ortsschützengesellschaft 15 68 Hug Werner 1966 S KA AK 57 Zizers Schützenverein Zizers-Untervaz 16 68 Oberfrank Josef 1967 S KA AK 90 Zizers Schützenverein Zizers-Untervaz 17 68 Candrian Dino 1972 S KA AK 90 Bonaduz Schützenverein 18 68 Balestra Marco 1974 E KA AK 57 Malix Schützenverein 19 68 Kessler Michael 1991 E KA AK 57 Malix Schützenverein 20 67 Weiss Luca 1998 U21 KA AK 57 Tamins Schützenverein 21 67 Vasella Franco 1940 SV KA AK 57 Chur Schützengesellschaft der Stadt Chur 22 67 Schällibaum Walter 1943 SV KA AK 90 Maladers Feldschützengesellschaft 23 67 Tanner Anton 1943 SV KA AK 57 Fläsch Vereinigte Schützenges. -

Landschaftliche Wandlungen Im Nördlichen Churer Rheintal Werner Nigg
LANDSCHAFTLICHE WANDLUNGEN IM NÖRDLICHEN CHURER RHEINTAL WERNER NIGG Das Rheintal zwischen Reichenau und Sargans bildet in natur- und kulturgeographischer Hinsicht weitgehend eine Einheit. Es ist im folgenden versucht, den neueren Wandlungen im Talabschnitt nördlich von Chur nachzugehen. Natürliche Grundlagen Die rund 20 km lange Talschaft verläuft in süd-nördlicher Richtung und bildet eine breite, tiefe Bresche in der nordbündnerischen Bergwelt. Die Talsohle mit den weit ausladenden Schuttfächern ist im Mittel 3 km breit. Das Rheinbett liegt bei Chur 560, bei Fläsch 500 m ü. M. Die beiden Talhänge sind verschiedenartig. Die Ostflanke besteht zwischen den Einmündungen des Schanfigg und des Prätigau aus der Hochwang-Kette, die Höhen bis 1900 m erreicht und aus weichem penninischen Bündner Schiefer aufgebaut ist. Nördlich der Einmündung des Prätigau, der sogenannten Klus, folgt die Vilan-Falk- nis-Gruppe mit Gipfelhöhen bis 2562 m. Sie wird zur Hauptsache aus weichem Flysch- Schiefer aufgebaut; die schroffe Gipfelpartie des Falknis jedoch aus ostalpinen Kalken. Die westliche Talflanke wird von der Kette Calanda (2706 m) - Pizalun (1478 m) gebildet. Hier sieht man deutlich die dicken helvetischen Kalkschichten ostwärts unter die Talsohle einfallen. Ebenfalls zu den helvetischen Decken gehört der relativ niedrige Fläscherberg, der, isoliert im Tal stehend, die nördliche Begrenzung des Bündner Rheintales markiert. Die petrographischen Verhältnisse sind wesentlich mitverantwortlich an der Ver¬ schiedenartigkeit der beiden Talhänge. Die aus weichen Gesteinen bestehenden östli¬ chen Bergzüge sind durch die Arbeit zahlreicher Rufen (Wildbäche) stark zerfurcht worden und fallen zum Teil steil, fast senkrecht ab. Eine Reihe mächtiger Schuttfächer schiebt sich westwärts ins Tal vor und drängt den Rhein auf die Gegenseite. -

1968-Die Freien Walser Im Churer Rheintal
Untervazer Burgenverein Untervaz Texte zur Dorfgeschichte von Untervaz 1968 Die freien Walser im Churer Rheintal Email: [email protected] . Weitere Texte zur Dorfgeschichte sind im Internet unter http://www.burgenverein-untervaz.ch/dorfgeschichte erhältlich. Beilagen der Jahresberichte „Anno Domini“ unter http://www.burgenverein-untervaz.ch/annodomini . - 2 - 1968 Die freien Walser im Churer Rheintal Johann Ulrich Meng Jahresbericht der Walservereinigung Graubünden. Chur 1968. Seite 09-32. - 3 - Die Freien Walser in Hintervalzeina und an den Hängen des Churer Rheintales S. 09: Einwanderung und Landnahme Über die Freien Walser in Graubünden, im Vorarlberg, Liechtenstein und Tirol ist schon viel geschrieben und gesprochen worden. Trotzdem ist das Thema noch lange nicht erschöpft. In den Archiven unserer deutschen Bündnergemeinden kommen immer wieder neue Quellen zum Vorschein, Dokumente und Aufzeichnungen, denen man bislang keine Bedeutung beimass, die aber manchmal wertvolle Ergänzungen zu Bestehendem sein können. In diesem Sinne soll das bezügliche Quellenmaterial des Trimmiser Gemeindearchivs dazu dienen, den Schleier über das Walsergebiet Hintervalzeina und am Sayser Berg etwas zu lüften. Soweit wir über die Ansiedlung der Walser und deren Kolonisationswerk orientiert sind, haben sich «Die herkommen Lüth» durchwegs in den obern Talstufen der Flusstäler oder auf Hochterrassen der Berghänge, die von der romanischen Bevölkerung nicht bewohnt und kaum für Alpung benutzt wurden, niedergelassen. In solchen Wildenen mussten sie sich mit den ansässigen Welschen nicht teilen oder gar streiten. Das dichtbestockte Waldgebiet von Hintervalzeina auf einer Meereshöhe von 1300-1600 m bot den fremden Landsuchern grosse Vorteile. Das 12 km lange Valzeinertal war im Mittelalter nur im vorderen Teil und auch dort jedenfalls nur sehr locker von Romanen besiedelt. -
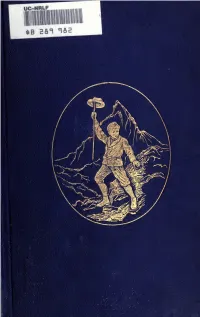
A Walk in the Grisons; Being a Third Month in Switzerland
UC-NRLF $B 26"^ "^ftS ^^ i 'I '^ ^fss&Js^^meti. THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESENTH3 BY PROF. CHARLES A. KOFOID AND MRS. PRUDENCE W. KOFOID A THIRD MONTH IN SWITZERLAND IB'Sr THE S-A^3VnE ^TJTHOE,. T// DUTY and DISCIPLINE of EXTEMPORARY PREACHING. Second Edition. New York : C. Scribner & Co. A WINTER in t/ie UNITED STA TES ; Being Table- Talk collected during a Tour through the Southern the Far and the &-'c. Confederation f West, Rocky Mountains, ' We have here a record of the travels of a sagacious and just-minded man, who saw thoroughly, describes it in a perfectly unprejudiced everything ' manner, and refrains from forcing upon us theories of his own. Pall Mall Gazette. London : John Murray. EGYPT of the PHARAOHS and of the KHEDIVE, Second Edition. ' Mr. Zincke speaks like a man of rare powers of perception, with an intense love of nature in her various moods, and an intellectual sympathy, broad and deep as the truth itself.' Saturday Review. A MONTH IN SWITZERLAND, ' There is quite enough in this little volume to arrest the attention of any- body who cares for an hour's intercourse with the mind of one who has arefully pondered some of the deepest problems which affect the physical well-being of his fellow-creatures.' Spectator, SWISS ALLMENDS,and a WALK to SEE THEM; Being a Second Month in Sxvitzerland, ' Here is a magician who can actually make the beaten tracks of Swiuer- and more interesting than Magdala and Coomassie.' Examiner. SMITH, ELDER, & CO. : 15 Waterloo Place, London. -

Jahresbericht – Stiftung Schulheim Chur Impressionen Aus Unserem Schulheim
2012 2013 jahresbericht – stiftung schulheim chur Impressionen aus unserem Schulheim 2 | jahresbericht stiftung schulheim chur bericht des präsidenten Mit Stolz dürfen wir feststellen, dass das Schulheim Chur heute das Kompetenzzentrum für Son- derschulung mit der kantonsweit grössten Anzahl an Kindern und Jugendlichen in der Integration ist. Mittlerweile betreuen unsere Mitarbeiter mehr Schülerinnen und Schüler in der Integration als separativ in unserer eigenen Schule. Dies zeigt, dass das Integrationskonzept des Kantons Graubünden in der hochschwelligen Sonderschulung funktioniert und unsere Institution eine wesentliche Erfolgskomponente dafür ist. Interessant ist auch die Feststellung, dass über 90% unserer Mitarbeitenden in der Integration Frauen sind. Wir schätzen ihre Leistungen, die sie täglich zugunsten unserer Kinder und Jugend- lichen erbringen, sehr hoch ein und sind dankbar für ihre Freude am Beruf. Der hohe Frauenanteil ist aber auch ein Spiegel der Volksschule, und es stellt sich die Frage, ob die Absenz der Männer in der Grundschule langfristig gut für unsere Gesellschaft ist. Unseres Erachtens besteht im Kanton Graubünden ein Mangel an ausserschulischer Betreuung von schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen. Eines der wenigen Angebote wird vom Therapeion in Zizers zur Verfügung gestellt. Dieses war Ende des vorletzten Jahres an unsere Institution gelangt mit der Bitte um eine Übernahme, da die Finanzierung nicht mehr sicherge- stellt sei. Das Schulheim Chur hat der Übernahme mittels einer schriftlichen Absichtserklärung unter der Auflage zugestimmt, dass sich der Kanton entsprechend an der Finanzierung der Ver - bindung beteiligt. In einem Regierungsbeschluss lehnte der Kanton die Übernahme ab. Dies mit der Begründung, dass die Regierung keinen Bedarf dafür erkennt und dass bei Schliessung des Therapeions für alle schwerstbehinderten Kinder und Jugendlichen Plätze in den verschiedensten Institutionen unseres Kantons gefunden oder geschaffen werden können. -

Evidence on Opting-In for Non-Citizen Voting Rights∗
Power Sharing at the Local Level: Evidence on Opting-In for Non-Citizen Voting Rights∗ Alois Stutzer† and Michaela Slotwinski‡ October 28, 2020 Accepted for publication in Constitutional Political Economy Abstract The enfranchisement of foreigners is likely one of the most controversial frontiers of insti- tutional change in developed democracies, which are experiencing an increasing number of non-citizen residents. We study the conditions under which citizens are willing to share power with non-citizens. To this end, we exploit the setting of the Swiss canton of Grisons, where municipalities are free to decide on the introduction of non-citizen voting rights at the local level (a so called opting-in regime). Consistent with the power dilution hypothe- sis, we find that enfranchisement is less likely when the share of resident foreigners is large. Moreover, municipalities with a large language/cultural minority are less likely to formally involve foreigners. In contrast, municipality mergers seem to act as an institutional catalyst, promoting democratic reforms. A supplementary panel analysis on electoral support for an opting-in regime in the canton of Zurich also backs the power dilution hypothesis, showing that a larger share of foreigners reduces support for an extension of voting rights. Keywords: non-citizen voting rights, opting-in, power sharing, democratization JEL classifications: D72, D78, J15, K16 ∗We are grateful to Jean-Thomas Arrighi, Joachim Blatter, Janine Dahinden, Johan Elkink, Eva Green, Dominik Hangartner, Ron Hayduk, Anita Manatschal, Lorenzo Piccoli, Didier Ruedin, Klaudia Wegschaider and the participants of the research seminar at the Immigration Policy Lab Zurich, the meeting of the NCCR - on the move as well as of the Max-Planck conference on citizenship for helpful comments. -

Amtliche Anzeigen 18
Amtliche Anzeigen 18. Juli 2014 x Nr. 29 Stadtrat Aus den Verhandlungen des Stadtrats Der Stadtrat hat sich unter anderem mit folgen- den Geschäften befasst: Kreditfreigaben –Sportanlagen Obere Au, Einbau behinderten- gerechte Duschenanlagen Hallenbad; Fr. 22 500.– –Sportanlagen Obere Au, instandstellung Lüf- tung Duschen Hallenbad; Fr. 44 000.– –Obere Au, Sanierung und Beleuchtung Finnen- bahn; Fr. 135 000.– –Kleine Belagsarbeiten Los 1; Fr. 150 000.– –Schanfiggerstrasse, Belagsarbeiten; Fr. 127 000.– –Bahnhof Chur, Bahnhofplatz mit Wendemög- lichkeit; Fr. 85 142.50 –Gürtelstrasse, Absenkung Unterführung Tur- nerwiese; Fr. 80 000.– Ab in die Badi Obere Au – man weiss ja heutzutage nie, wie lange die Kondition des Sommers hält. –Sommeraustrasse, Bereich Medienhaus, Rad- Foto W. Schmid und Gehweg; Fr. 490 000.– –Anschaffung von Mobiliar sowie Spiel- und Bastelsachen infolge Eröffnung von zwei Kin- –Thomas Coray, Chur, vertreten durch Roberto 21.45 Uhr Feier auf der Quaderwiese dergärten per Schuljahr 2014/15; Fr. 56 000.– Outumuro, Zürich, für Innere Umbauten mit –Ansprache von Pascal Pajic, Fassadenänderungen, Ausbau Dachgeschoss, Präsident Jugendparlament Baubewilligungen wärmetechnische Dachsanierung sowie Ein- Stadt Chur –Hans Peter Bernhard, Basel, vertreten durch bau Dachflächenfenster und Dachterrasse, –Allgemeiner Gesang «Trittst im Peter Suter AG, Chur, für Sanierung und Er- Loëstrasse 42 Morgenrot daher» (begleitet gänzung Dachterrasse sowie Einbau Dach- durch das Musikkorps) flächenfenster als Dachsanierung, Poststras- ca. 22 Uhr Feuerwerk auf der Quaderwiese se 39 bis 23 Uhr Festwirtschaft –Ladina Barblan, Chur, vertreten durch Konrad Stadtkanzlei Erhard, dipl. Arch. ETH/SIA Architekturbüro, Wir bitten, das Abbrennen von Feuerwerk in der Chur, für Neubau Einfamilienhaus mit Park- Bundesfeier 2014 Umgebung des Platzes während der Feier sowie platz, Rätusstrasse 3a während des Umzugs zu unterlassen, und dan- Programm: ken für Ihr Verständnis. -

0955-Untervaz Und Der Königshof Von Zizers
Untervazer Burgenverein Untervaz Texte zur Dorfgeschichte von Untervaz 955 Untervaz und der Königshof von Zizers Email: [email protected] . Weitere Texte zur Dorfgeschichte sind im Internet unter http://www.burgenverein-untervaz.ch/dorfgeschichte erhältlich. Beilagen der Jahresberichte „Anno Domini“ unter http://www.burgenverein-untervaz.ch/annodomini . - 2 - 955955955 Untervaz und der Königshof von Zizers Martin Bundi Bundi Martin: Zur Besiedlungs- und Wirtschaftsgeschichte Graubündens im Mittelalter. Calven Verlag Chur 1982. Seite 59-64. Zizers Hier haben wir mit einem Siedlungskonglomerat zu tun, das im Reichsguturbar von 831 noch nicht Erwähnung fand. Erst 124 Jahre später, nämlich 955, schenkte König Otto II. der Churer Kirche die «curtem nostram in loco Zizuris» in der Grafschaft Rätien. (BU I, S. 92/93.) Wenn nicht ausdrücklich von einer «curtis dominica» die Rede war, so bildete der Grosshof von Zizers doch entsprechend seiner Zusammensetzung und seines Umfanges ein Siedlungswesen von der Bedeutung eines grösseren Königshofes. Zu ihm gehörten nebst dem grössten Teil von Zizers selbst Güter zu Igis, Untervaz , Trimmis, Says und Valzeina. In der Aufzählung der Hofpertinenz finden sich fast alle jene Elemente, wie sie auch für den Königshof von Chur genannt wurden, nämlich die Kirche mit den Zehnten, Hofstätten, Gebäuden, Leibeigenen, Äckern, Wiesen, Weingärten, Wäldern, Weiden, Alpen, Gewässern und Wasserläufen, Quellen, Inseln, Fischgründen, Mühlen in den Ebenen und auf den Bergen. 1 Im darauffolgenden Jahre präzisierte König Otto in einer Bestätigung dieser Schenkung den Umfang des Grosshofes Zizers. 2 Zu dieser Präzisierung gehört, dass nunmehr von mehreren Kirchen, von Leibeigenen beiderlei Geschlechts, von Viehtriften (Waldwiesen, Töbeln, lat. «saltus»), Wegen, Stegen, Ein- und Ausgängen die Rede ist. -

Valzeina, S. Sisinnius Und Die Patrozinien Von Trimmis, Zizers Und Igis
Valzeina, S. Sisinnius und die Patrozinien von Trimmis, Zizers und Igis Autor(en): Poeschel, Erwin Objekttyp: Article Zeitschrift: Bündnerisches Monatsblatt : Zeitschrift für bündnerische Geschichte, Landes- und Volkskunde Band (Jahr): - (1932) Heft 8 PDF erstellt am: 05.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-396703 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch 241 überbietender Deutlichkeit angegeben. Aber nicht nur dies. Hier wird auch zum ersten und einzigen Mal klipp und klar, ohne daß irgendein Zweifel möglich wäre, das Bestehen eines altern gemeinsamen Bundesbriefes als desjenigen von 1524 bezeugt. (Schluß folgt.) Valzeina, S. Sisinnius und die Patrozinien von Trimmis, Zizers und Igis. -
Sorbian, Scottish Gaelic and Romansh: the Viability of Three Indigenous European Minority Languages
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by RERO DOC Digital Library Sorbian, Scottish Gaelic and Romansh: the Viability of Three Indigenous European Minority Languages. Lizentiatsarbeit, eingereicht bei der Philosophischen Fakultät Freiburg (CH) Elisabeth Peyer (Schleitheim, SH) University of Fribourg Department of English Linguistics Mémoire supervised by Prof. P. Trudgill 2004 Acknowledgements i ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank Renzo Caduff for imparting his inside knowledge of the Romansh situation in the course of many interesting discussions, Professor Peter Trudgill for his encouragement and expert guidance at every stage of my research, St John Skilton for his kind help in relation to Scottish Gaelic, and for providing me with useful information on the relevant reading material, Elaine Sheerin who was kind enough to proofread the entire mémoire, My family and friends for their support and interest in my work. Cover: Competition and Harmony by Eduardo Chillida (1988) Table of Contents ii TABLE OF CONTENTS Acknowledgements .....................................................................................................................i Table of Contents .......................................................................................................................ii List of Abbreviations.................................................................................................................iv Introduction ............................................................................................................................... -

Ls Dh1iff:Diid'sl'ifr#Ll : E =T Ments That Matters." =E
FOCUS "It is atways others who are surptus" The referendumwith probably the most far-reaching consequences of the past two decades is currently keeping Swiss potiticians very busy - the Yes vote to the initiative on mass immigration is jeopardising the minimum consensus that currently exists in domestic politics regarding policy towards Europe. And an even more radical initiative on immigra- tion is already casting its shadow. By Jtirg Miittet elements "The bear cannot bewashedwithout getting National Council debate in March: "If I must terminate the detrimental of r and that is, the its fur wet." Adrian Amstutz, the Swiss Peo could choose between the continuation of the bilateral agreements z ple's Party (SVP) parliamentary group the excessive immigration which is destroy free movement ofpersons and Schengen/ 'ElJ leader, quoted this old proverb in March ing this country and the bilateral agree- Dublin in particular as they are acces- accelerants' zor4 during the National Council debate on ments, I would choose the protection ofthe sion accelerants' , or eten'fire , just the implementation of the initiative on mass nation, full stop." and are damaging not direct democracy immigration. \[ith these words, Amstutz According to a Vox Analysis scientific but also our econom\'." This is the message neatly summed up the current situation and study on the referendum, most of those who from AUNS President and SVP National his organ- indirectly conceded that Switzerland non' supported the SVP initiatit'e v'ere well Councillor Pirmin Schn'ander on Gartenmann faces enormous challenges in domestic pol- aware that the adoption of the popular ini- isation's homepage.