NISH Jahrbuch 2017/18
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Die Geschichte Des ASV Durlach 1902 E. V
die Geschichte des ASV Durlach 1902 e. V. Der ASV Durlach 1902 ist ein Sport- und Fußballverein aus dem Karlsruher Stadtteil Durlach mit über 30.000 Einwohnern. Unser Stadtteil liegt im Osten Karlsruhes; das Wahrzeichen ist der weithin sichtbare Turmberg. Der Verein hat rund 400 Mitglieder in den Abteilungen Fußball, Lauftreff, Damengymnastik und Kampfsport. Die erfolgreichste Mannschaft stellen die nun in der Oberliga Baden Württemberg spielenden Fußballer dar. Geschichte Der Verein wurde am 14. Mai 1902 als FC Germania Durlach gegründet. Durch den Zusammenschluss aller Durlacher Sportvereine am 8. September 1945 entstand der ASV Durlach. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Verein nach dem Krieg in den 1950er-Jahren, als man von 1950 bis 1955 in der 2. Oberliga Süd spielte. In der Folgezeit spielte der ASV Durlach meist in der 1. und 2. Amateurliga. Zwischenzeitlich erfolgte sogar der Fall bis hinab in die A-Klasse (1961/62). Ab dem Ende der 1980er-Jahre konnte der Verein mit der Rückkehr in die Verbandsliga Nordbaden wieder etwas an die Erfolge vergangener Tage anknüpfen. In den Jahren 1993, 2006 und 2008 erreichte man die Meisterschaft in der Verbandsliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg. Nach dem sofortigen Abstieg aus der Oberliga in der Saison 2005/06 spielte der Verein in der Verbandsliga Nordbaden. Dort konnte er in der Runde 2007/08 erneut die Meisterschaft erzielen und spielt daher nun wieder in der baden-württembergischen Oberliga. Zusätzlich konnte der BFV-Hoepfner-Cup (2007/08) gewonnen werden, was den ASV für die direkte Teilnahme am DFB-Pokal 2008/09 qualifiziert. Hier traf man in der 1. -

Saison Auf in Die Neue
42. Jahrgang Nr. 02/2016 14. Januar 2016 Diese Ausgabe erscheint auch online Auf in die neue rausch kultur Martina Brandl Saison 13.02. Bernd Lafrenz 12.03. Lieblingsfarbe Schokolade 08.04. Oropax powered by: 20./21./22.04. Vorpremiere Das ausführliche Programmheft der klag- Bühne liegt bereits an zahlreichen Stellen in Gaggenau und in der Region aus. Informa- tionen zum Programm gibt es im Kulturamt Gaggenau (07225 962-513) und im Internet Echoes of Swing unter www.kulturrausch-gaggenau.de. 28.04. Die neuen Gutscheinkarten des Gaggenauer Familien- und Sozialpasses für das Jahr 2016 sind im Bürgerbüro erhältlich. Ab sofort können bereits ausgestellte Ausweise verlängert oder neue Ausweise beim Bürgerbüro beantragt werden. Weitere Informationen auf S. 8 Seite 2Gaggenauer Woche 02/2016 Neue BONUSCARD als Karte und als App, so komfortabel wie nie Seit fast 15 Jahren gibt es die BONUS- jederzeit und überall den eigenen Punk- - ohne Laufzeitbeschränkung. Die Wer- CARD in Gaggenau, über 15.000 Kunden testand einsehen. Gleichzeitig lassen begemeinschaft weist daraufhin, dass aus der gesamten Region nutzen die sich damit die persönlichen Daten ver- BONUSCARDs mit dem Verfalldatum BONUSCARD regelmäßig. Jetzt präsen- walten und stets die neuesten Informati- 12/2015 bis zum ersten Umtauschtag ver- tiert sie sich im neuen frischen Design, onen in Sachen Vorteile, News und Cou- wendet werden können. Am Mo., 18. Jan., mit neuen zeitgemäßen Funktionen. pons rund um die BONUSCARD abrufen. beginnt die große Umtauschaktion beim Gleichzeitig wird aus der BONUSCARD Servicebüro BONUSCARD (geänderte Gaggenau die neue, moderne BONUS- Dabei können die Kartenbesitzer die App, Öffnungszeiten beachten); Augenoptik CARD Murgtal. -
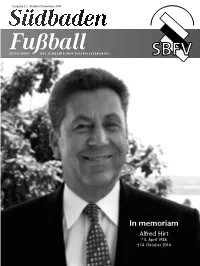
In Memoriam Alfred Hirt * 3
Ausgabe 5 | Oktober/November 2014 Südbaden Zeitschrift Fußball des südbadischen fussballverbandes in memoriam Alfred Hirt * 3. April 1958 † 14. Oktober 2014 FUSSBALL Der Südbadische Fußballverband startet mit ERHARD® SPORT in die neue Saison! Partner des Sonderkonditionen für SBFV Vereine! SOCCER Mehr Informationen und attraktive Angebote unter www.erhard-sport.de oder Katalog anfordern unter 09843 9356-0 PERFEKTER ABSCHLUSS. FUSSBALL-KUNSTRASENSYSTEME VON POLYTAN|STI. Fußball ist Leidenschaft. Und Technik. Wenn beides zusammen- kommt, entsteht das, was diesen Sport so besonders macht: pure Magie. Polytan|STI Fußball-Kunstrasensysteme sind das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung, getrie- ben von immer dem gleichen Ziel: Den Sportlern eine perfekte Leistung zu ermöglichen. Durch naturnahes Rasenfeeling. Durch optimale Spieleigenschaften. Durch extreme Robustheit und Langlebigkeit. Im Erstligastadion, im Verein oder auf dem Bolzplatz. Entdecken Sie die ganze Welt von Polytan|STI unter www.polytan.de oder kontaktieren Sie uns via Mail: [email protected] Polytan GmbH · [email protected] · www.polytan.de INHALT Nachruf sbfv-Präsident alfred hirt verstorben Der Fußball in Südbaden trauert4 SüddeutScherfuSSball-VerbaNd Klare linien beim sfv FUSSBALL Verbandstag in Freiburg-Munzingen 6 Der Südbadische Fußballverband startet mit ERHARD® SPORT in die neue Saison! MaSterplaN bildung im fußball Jahrestagung in Frankfurt 8 Partner des vereinsdialoge Sonderkonditionen In Bühl und Schopfheim 9 für SBFV Vereine! auSwahleN dfb- und sfv-turniere -

BACHELORARBEIT SV Waldhof Mannheim 07 Ev
BACHELORARBEIT Herr Thomas Mayor Fernandez SV Waldhof Mannheim 07 e.V.- Die Geschichte eines Traditi- onsvereins, sowie strukturelle Schwächen und Barrieren bei der Neuetablierung 2012 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT SV Waldhof Mannheim 07 e.V.- Die Geschichte eines Traditi- onsvereins, sowie strukturelle Schwächen und Barrieren bei der Neuetablierung Autor/in: Herr Thomas Mayor Fernandez Studiengang: Angewandte Medien / Medien-, Sport- und Eventmanagement Seminargruppe: AM09wS2-B Erstprüfer: Prof. Dr. phil. Ludwig Hilmer Einreichung: Mannheim, 10.08.2012 Faculty of Media BACHELOR THESIS SV Waldhof Mannheim 07 e.V.- the history of a traditional club as well as structural weak- nesses and barriers to the re- establishment author: Mr. Thomas Mayor Fernandez course of studies: Applied Media Economics Special field Media, Sports and Event Manager seminar group: AM09wS2-B first examiner: Prof. Dr. phil. Ludwig Hilmer submission: Mannheim, 10.08.2012 Bibliografische Angaben Mayor Fernandez, Thomas: „SV Waldhof Mannheim 07 e.V. - Die Geschichte eines Traditionsvereins, sowie strukturelle Schwächen und Barrieren bei der Neuetablierung“ „ SV Waldhof Mannheim 07 e.V. - the history of a traditional club as well as struc- tural weaknesses and barriers to the reestablishment” 69 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2012 Inhaltsverzeichnis II Abstract Tennis Borussia Berlin, Borussia Neunkirchen, KFC Uerdingen, SSV Ulm etc. - die Liste ist lang und es sind nur ein paar wenige Beispiele für Traditionsvereine, die in den achtziger und neunziger Jahren in der Fußballbundesliga für Wirbel sorgten und heute in den Ober- und Regionalligen um ihre Existenz kämpfen müssen. Wieso kommt es zu derart vielen Abstürzen in den Amateurbereich und mit welchen Schwierigkeiten haben die Vereine im Amateurfußball zu kämpfen? Die nachfolgende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung des SV Waldhof Mannheim. -

Vfr Wormatia Worms — SV Südwest Ludwigshafen
VfR Wormatia Worms — SV Südwest Ludwigshafen Unser heutiger Gast aus Ludwigshafen wieder ENORM IN FORM MIT BENIFÄRM Zur Genesung braucht der Körper Kraft wie ein Sportler im Wettkampf Bei schweren Krankheiten wie • bei harten Leistungskämpfen braucht der Körper BENIMM REVITALISIERUNGSKUR • kräftigt Herz und Kreislauf • verbessert die Konzentrationsfähigkeit • stärkt den gesamten Organismus Erhältlich in der Apotheke BENIRSRM als 10-, 20- oder 40-Tageskur. 6520 Worms Enthält 18 Vol.-% Alkohol Dreihornmühlgasse 36 Packungsbeilage beachten Tel. 06241 / 7 00 90 • Unser heutiger Gegner: SV Südwest Ludwigshafen # Südwest-Wind könnte zum Orkan werden Alle Achtung vor Südwest Ludwigshafen. Obwohl die Anilinstädter zum letzten Rundenende ganz wichtige Leute abgeben mußten (Libowsky, Gron- bach!!!), überflügelten die Pradt-Schützlinge letztes Wochenende unsere Wormatia und übernahmen den zweiten Tabellenplatz. Was die meisten zum Staunen bringt, ist für die Lud wigshafener eigentlich keine Überraschung. Die Anschrift: SV Südwest Ludwigshafen Mannschaft ist noch stärker als letztes Jahr, hat sich Postfach 211207,6700 Ludwigshafen Tel. 06 21 / 57 18 77 od. 57 57 25 mit Torwart Stefan Märtens, Libero Leo Spielberger, Vorstand: 1. Vors. Wolfgang Schneider Mittelfeldmann Uwe Gaßner (alle vom SV Edenko- 2. Vors. u. Leiter der Fußballabteilung: Frau Gerda Reiff ben) sowie Stürmer Gernot Seifert (Hassia Bingen) Geschäftsführer: Thomas Neumüller gezielt verstärkt. Dennoch war die Arbeit zu Beginn Schatzmeister: Werner Lähr der Saison nicht einfach. Bekanntlich verließ Ex- Zielsetzung: vorderes Tabellendrittel Trainer Günter Neues die Mannschaft in einer Erfolge: Südwestpokalsieger 1983 und 1987 „Nacht-und-Nebel-Aktion“, Nachfolger Walter Pradt )vereinsfarben: blau/weiß Vereinsgeschichte: Der heutige SV Südwest 1882 Ludwigshafen ist ein (früher Torwart u.a. in Waldhof) mußte mit dem Kader Zusammenschluß zweier Traditionsclubs, die in den arbeiten, den ihm Neues überlassen hatte. -

Vfr Wormatia Worms — FK Pirmasens
VfR Wormatia Worms — FK Pirmasens Können die Spieler des VfR Wormatia am Wochenende, wie unsere Fotos zeigen, wieder so jubeln!! Nahtlos eingegliedert in die „Neue Wormatia-Elf“ haben sich Förster und Heng. Sehr mannschaftsdienlich zeigt sich auch Baumgärtner. Fotos, Text und Gestaltung: F. Weygand wieder ENORM IN FORM MIT B E N IF © R M Zur Genesung braucht der Körper Kraft wie ein Sportler im Wettkampf Bei schweren Krankheiten wie • bei harten Leistungskämpfen braucht der Körper REVITALISIERUNGSKUR • kräftigt Herz und Kreislauf • verbessert die Konzentrationsfähigkeit • stärkt den gesamten Organismus Erhältlich in der Apotheke 6520 Worms als 10-, 20- oder 40-Tageskur. Enthält 18 Vol.-% Alkohol Dreihornmühlgasse 36 Packungsbeilage beachten Tel. 06241 / 7 00 90 * FK Pirmasens im Spiegel der Statistik „Lebenslauf“ ab 1908 Wormatia - FKP Saison Liga Platz Heim Ausw 1908/09 B-Klasse Pfalzgau Meister __ __ (FCP) 1909/10 B-Klasse Pfalzgau Meister — — (FCP) 1910/11 B-Klasse Pfalz 2 — — (FCP) 1911/12 B-Klasse Pfalz 2 — — (FCP) 1912/13 B-Klasse Pfalz 2 — — (FCP) 1913/14 A-Klasse Bezirk 3 Meister — _ (FCP) 1914/15 keine (FCP) bis Plazierung (FCP) Anschrift: Fußballklub 03 e.V. Pirmasens 1918/19 bekannt (FCP) 1919/20 Kreisl. Saar 4 — Zweibrücker Straße 1920/21 Kreisl. Pfalz 6 — _ 1921/22 Kreisl. Pf. Abt. 1 2 — — 6780 Pirmasens 1922/23 B-Klasse Pfalz 4 — __ 1923/24 BezI. Rhein 4 — __ Vorstand: Präsident: Heinz Jürgen Frank 1924/25 BezI. Rhein 5 __ __ 1925/26 BezI. Rhein 8 — — Vizepräsident: Peter Föller 1926/27 BezI. Rhein 5 — — 1927/28 BezI. Saar 5 _ __ Schatzmeister: Hans-Georg Stark 1928/29 BezI. -
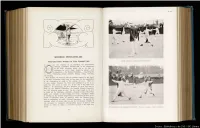
Source : Bibliothèque Du CIO / IOC Library but This Was Not Enough
MODERN PENTATHLON. PREPARATORY WORK OF THE COMMITTEE. EFEE FENCING, MODERN PENTATHLON n the pr0p0Sai 0f jts President, the International ) < Olympic Committee decided that, in the programme : I I /"j ••••. \ \ j of the Fifth Olympiad which was to be held in 1 I I V I. /j i| Stockholm in 1912, there should be placed a new .> \\. yy competition — the Modern Pentathlon — comprising the 1.™ ."'.Jfollowing events: athletics, fencing, riding, swimming and shooting. This decision was received with the greatest interest by the Swed ish Olympic Committee which took its first steps for the organization of the competition, as early as the autumn of 1910. This was no easy matter, however, for there was nothing to go by as re gards the new event as there was in the case of the other com petitions. In determining the five branches of sport that were to make up the Modern Pentathlon, the Swedish Olympic Committee had the following points in view: the five events ought to be such as would test the endurance, resolution, presence of mind, intrepidity, agility and strength of those taking part in the competition, while, in drawing up the detailed programme, it was necessary to have all the events of equivalent value, in order to make the Modern Penta thlon a competition of really all-round importance. As regards the shooting, which, of course, was not any test of physical strength, it was necessary to demand a corresponding degree of skill in that branch, in order to make it equivalent to each of the other iour events. EPEE FENCING, MODERN PENTATHLON. -

Germany - Table of Honor
Germany - Table of Honor Tops Winner of Championship Cup Final Super Cup Final 31 x Bayern München 20 x Bayern München 9 x Bayern München 9 x FC Nürnberg 6 x Werder Bremen 6 x Borussia Dortmund 8 x Borussia Dortmund 5 x Borussia Dortmund 3 x Werder Bremen 7 x Schalke 04 5 x Eintracht Frankfurt 1 x FC Kaiserslautern 6 x Hamburger SV 5 x Schalke 04 1 x Schalke 04 5 x Borussia Mönchengladbach 4 x FC Köln 1 x VfB Stuttgart 5 x VfB Stuttgart 4 x FC Nürnberg 1 x VfL Wolfsburg 4 x FC Kaiserslautern 3 x Borussia Mönchengladbach 4 x Werder Bremen 3 x Hamburger SV 3 x FC Köln 3 x VfB Stuttgart 3 x SpVgg Fürth 2 x Dresdner SC 3 x VfB Leipzig 2 x FC Kaiserslautern 2 x Dresdner SC 2 x Fortuna Düsseldorf 2 x Hannover 96 2 x Karlsruher SC 2 x Hertha BSC Berlin 2 x München 1860 2 x Viktoria Berlin 1 x Bayer Leverkusen 1 x Eintracht Braunschweig 1 x Bayer Uerdingen 1 x Eintracht Frankfurt 1 x First Vienna 1 x Fortuna Düsseldorf 1 x Hannover 96 1 x Freiburger FC 1 x Kickers Offenbach 1 x Holstein Kiel 1 x Rapid Wien 1 x Karlsruher FV 1 x RW Essen 1 x München 1860 1 x SW Essen 1 x Phönix Karlsruhe 1 x VfB Leipzig 1 x Rapid Wien 1 x VfL Wolfsburg 1 x RW Essen 1 x Union 92 Berlin 1 x VfL Wolfsburg 1 x VfR Mannheim © by soccer library 1 Germany - Table of Honor Season Champion Super Cup Winner Cup Winner 2020/21 Bayern München Bayern München Borussia Dortmund 2019/20 Bayern München Bayern München Bayern München 2018/19 Bayern München Borussia Dortmund Bayern München 2017/18 Bayern München Bayern München Eintracht Frankfurt 2016/17 Bayern München Bayern München -

Sgk-Chronik-2019-20-Internet.Pdf
Liebe Mitglieder und Sportfreunde, wer hätte dies vor einem Jahr für möglich gehalten. Von heute auf morgen waren wir als Menschen, als Sportler und vor allem auch Capoeira als einer der größten Mehrspartenvereine gefordert weitreichen- Basketball de Entscheidungen zu treffen. Wir mussten eine noch nie dagewesene Herausforderung annehmen. Was in Wuhan in China begann wurde mit Fußball Covid19, dem Corona Virus, auch bei der SG Heidelberg-Kirchheim spätes- tens am 12. März 2020 Wirklichkeit, als wir uns entscheiden mussten, den Handball Trainings- und Sportbetriebs einzustellen. An dieser Stelle möchte ich mich Kegeln bei allen Verantwortlichen in den Abteilungen und im Vorstand bedanken, die diese Maßnahmen mitgetragen und unterstützt haben. Wir wollten zu Leichtathletik diesem Zeitpunkt weder unsere Sportler, die Kinder und Jugendliche, noch deren Angehörigen einem gesundheitlichen Risiko aussetzen. Rollstuhlbasketball Zwei Wochen nach dem Shutdown begannen wir mit wöchentlichen Schach Videokonferenzen um Folgen auf den Sport so gering wie möglich zu halten. Es entstanden Initiativen für unsere Mitglieder und Sporttreiben- Schwerathletik den um diese, gerade in dieser zu unterstützen. Es wurden Trainingsvideos für jung und alt aufgezeichnet und ausgestrahlt und Poster angefertigt, Tennis die man zum Heimtraining heranziehen konnte. In einem Brief boten wir Turnen unseren älteren Mitgliedern Unterstützung beim Einkaufen an. Auch wenn von Seiten des Vereins eine Haushaltssperre für direkte Investitio- Volleyball nen verhängt wurden, so hat der Verein gerade für die Mitglieder keine Kosten und Mühen gescheut, um präsent zu sein. Viele Abteilungen haben Herausgeber mit ihren Sportlern intensive Athletiktrainings via Zoom-Videokonferen- SPORTGEMEINSCHAFT zen organisiert und Aktionen gestartet. Ein Newsletter, den man über die HEIDELBERG-KIRCHHEIM E.V. -

Olympic Games + International Sport– 100 Titles
OLYMPIC GAMES + INTERNATIONAL SPORT– 100 TITLES 1912 STOCKHOLM GAMES 1. Olympiska Spelen I Stockholm 1912 Stockholm. Gustaf G. Uggla. Svenska Bokförlaget. Lg. 8vo. 726pp. Gilt-decorated lavender cloth binding with dust jacket. Light rubbing to edges. Tearing and two small chips to dj; head and tail of dj spine and bottom edge repaired with modern scotch tape. Spine sunned. Marble endpapers. Profusely illustrated with annotated b/w photos. Scarce in dust jacket. (13376) $650. 2. Fifth Olympiad: Olympic Games of Stockholm, Sweden 1912 Programme and General Regulations Swedish Olympic Committee. 8vo. 36pp. Original decorated brown wrappers. Illustrated with three annotated b/w photos, one plan and some charts. Summary of the regulations of the most popular disciplines: Athletics, Lawn Tennis, Modern Pentathlon, Football, Gymnastics, Shooting, Rowing, Yacht Racing, etc. (22584) $375. 3. Die Konkurrenzen zu Pferde an den Olympischen Spielen zu Stockolm Schickhardt & Ebner. Stuttgart, 1913. 8vo. xi, 204pp. With 53 photographs by Gustav Rau. Rebound with illustrated wrapper laid down. Slightly warped. Minor rubbing to edges. Illustrated with annotated b/w photographs and charts. Some minor underlining. (22585) $500. 4. Den Femte Olympiaden Olympiska Spelen I Stockholm 1912 I Bild Och Ord Stockholm, 1912. Oblong folio. Blue cloth with decorative gilt stamping. Wrapper of Issue #1 laid in. Illustrated with annotated b/w photos; some color. (13366) $650. 5. Olympische Spiele Stockholm 1912 Veranstaltet vom Internationalem Olympischen Komitee. Präsident Baron Pierre De Coubertin. Eichenberger, A.; Julius Wagner (ed.). Folio. viii, ads + 136 pp. + ads. Grey cloth binding. Minor age rubbing to edges. Foxing throughout. Head of spine frayed. Frontispiece. -

The Games of 1916
Cancelled but still counted, and never annulled: the Games of 1916 By Volker Kluge As early as 1896 Dr. Willibald Gebhardt full of enthusiasm the town of Brandenburg indicated that it would and without any consultation with the German give a loan of 1000 Marks. On 31 March 1909 Asseburg government had put his home city of Berlin forward to passed away. Carl Diem, who three years later became host the 1904 Olympic Games. He did so at the first IOC General Secretary of the Organising Committee for the meeting on 6 April 1896.1 Pierre de Coubertin, at that 1916 Games, wrote of him: “... he died because of the time General Secretary, made a note of the offer in the stadium.”8 minutes, but secretly he had long had other plans. The When the IOC met at the end of May 1909 in Berlin for The telegram in which third Games were to take place in the “New World”, in its 12th Session, Graf von Wartensleben, by now the only Pierre de Coubertin the USA. German still to belong to the IOC, was forced to admit informed Kaiser Five years later, in 1901 in Paris, the German IOC Members that it would not be possible to build a stadium in Wilhelm II. The IOC (now three in number) restated their proposal – how- time for 1912.9 Thereupon Stockholm was unanimously decision about the ever this time for the year 1908.2 Once again the offer nomi nated. For the host of the Session, who had relied award of the 1916 did not fit into Coubertin’s strategy, as he had for some on home advantage, it was a poor consolation when at Olympic Games to time intended Rome for that year. -

Kicking Through the Wall: Football, Division, and Entanglement In
Kicking Through the Wall: Football, Division, and Entanglement in Postwar Berlin By Emmanuel Hogg, BA (Hons), MA A thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Affairs in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History Carleton University Ottawa, ON © 2016, Emmanuel Hogg Abstract Seldom is the German capital referred to as a “Fußballstadt” (“football-city”). When Berlin and football are mentioned together, themes of corruption, hooliganism, the Stasi, and scandal dominate. And yet, Berlin holds a rich footballing history that dates back to the late nineteenth and early twentieth centuries and has long played an important role in the lives of Berliners as spaces for sociability. In the postwar period, two divergent states emerged, each with their own competing structures of football. Whereas in the Federal Republic football remained an autonomous but not apolitical space, it was explicitly politicized in East Germany. As an important form of “soft power” during the Cold War, the people’s game reveals the extent to which the Iron Curtain was much more porous and elastic than the imagery of the Berlin Wall suggests. Rather than view football as “war without the fighting”, a microcosm that interprets the German and Cold War past as simplistic, reductive, and dichotomous, this dissertation analyzes the sport’s inherent dynamism that presented Berliners on both sides of the Wall with unique spaces for social interaction. Although both German states tried to use the sport to assert their own interests, this dissertation argues that football simultaneously provided fans with a relatively free space authorities could not effectively control, opening the opportunity for German- German interactions.