Gutachten Landschaftsbild Und Windenergieanlagen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

„Kinder in Bewegung“ Höhe 50 Mm
Mitglied im Immobilienverband Deutschland e. V. Ring Deutscher Makler e. V. Blatt Nr.: _________ A N Z E I G E N A U F T R A G An Rundschau Ausgabe Erscheinungstag August 2021 Rubrik Titelkopf/Titelseite 1-spaltig Fließsatz einfach Fließsatz fett Fließsatz Schlagzeile TEXT PREIS Anzeige bitte direkt von eMail abnehmen Im Rahmen einer Mitgliedschaft helfen wir u.a. Arbeitnehmern, Beamten und Rentnern in KAPITALANLAGE IN RUNDSCHAU FÜR DIE GEMEINDE LEHRE BRAUNSCHWEIG-NORD Lohnsteuersachen 1-Zimmer-ETW in Veltenhof, BOTE ca. 37 m², frei ab 01.08.21, Lohnsteuerberatungsverbund e.V. - Lohnsteuerhilfeverein - großer Südbalkon, gepflegte Wohnanlage, Bj. 1978. Beratungs- Birkenfeldstr. 9e VerbrA, Öl, 114,9 kWh, Kl. D stelle 38165 Lehre KP: 79.000,00 Leiter Herr S. Robling LEHRSCHER Telefon 05308 990 551 E-Mail [email protected] Internet www.steuerverbund.de Petritorwall 6, 38118 Braunschweig Ausgabe 08/21 44. Jahrgang Unabhängig Nicht parteigebunden Erscheint monatlich 0531/244770, www.wolter.de Mode von Mensch zu Mensch LEHRE Kleiderladen eröffnet im August „Kinder in Bewegung“ Höhe 50 mm Der Kleiderladen bie- LEHRE tet Freiwilligen die Gemeinsames Kindersommerfest vom VfL und Kreissportbund am 29. August Möglichkeit, sich sozi- al zu engagieren. Spaß an Mode, ein gutes Ge- spür für Menschen soll- ten die Ehrenamtlichen mitbringen. Sie können sich bei der Sortierung der Spenden und Be- ratung der Kunden, so- Datum: 22.07.21 lhö/- gesehen/geprüft: genehmigt: wie der Dekoration des Ladens einbringen. Be- D 4 01/19 0001 werbungen bitte an: Jo. Wolter Immobilien GmbH · Petritorwall 6 · D-38118 Braunschweig · Gerichtsstand für Amtsgericht und Landgericht ist Braunschweig · Registergericht Braunschweig · HRB Nr. -

Liebe Eltern, Vielen Dank Für Die Anmeldung Ihres Kindes. Wir Freuen Uns Sehr. Nachfolgend Erhalten Sie Einige Hinweise Zu
Schulträger Gemeinde Landkreis Helmstedt Lehre Liebe Eltern, vielen Dank für die Anmeldung Ihres Kindes. Wir freuen uns sehr. Nachfolgend erhalten Sie einige Hinweise zu den Anmeldeunterlagen: Anmeldebogen, Zeugnis: o Mit der Anmeldung benötigen wir eine Kopie des letzten Schulzeugnisses. o Besteht ein festgestellter sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf, benötigen wir eine Kopie des Bescheids und vorhandener Unterlagen wie Gutachten oder Förderpläne. o Außerdem bitten wir Sie, die aktuell besuchte Schule von ihrer Schweigepflicht zu entbinden. Erklärung zur Sorgeberechtigung bei getrennt lebenden Eltern o Diese muss bitte vollständig ausgefüllt und vor Beginn der Schulzeit an uns zurückgegeben werden. o Alleinerziehungsberechtigte legen die gerichtliche Entscheidung in der Schule vor. Infektionsschutzgesetz §34 und Masernschutzgesetz o Die Kenntnisnahme der Belehrung zum IfSchG muss unterschrieben an die Schule zurückgegeben werden. o Vor dem ersten Schultag muss der Schule ein Nachweis über den Masernschutz vorgelegt werden. Datenschutzgrundverordnung, Einwilligung zur Veröffentlichung und Eintrag in den Email-Verteiler o Die Kenntnisnahme muss unterschrieben an die Schule zurückgegeben werden. o Ebenso erhalten Sie ein Einwilligungsschreiben zur Veröffentlichung von Fotos und Werken Ihres Kindes. Ihre Einwilligung erfolgt freiwillig. o Mit Angabe einer Email-Adresse erhalten sie Elternbriefe über diesen Weg. Die Einwilligung ist freiwillig. Lernmittelausleihe o Die Anmeldung zur Schulbuchausleihe erfolgt online über iServ. -

Lehrscher Bote Oktober 2020
Mitglied im Immobilienverband Deutschland e. V. Ring Deutscher Makler e. V. Blatt Nr.: _________ A N Z E I G E N A U F T R A G An Rundschau Ausgabe Erscheinungstag September 2020 Rubrik Titelkopf/Titelseite 1-spaltig Fließsatz einfach Fließsatz fett Fließsatz Schlagzeile TEXT PREIS Anzeige bitte direkt von eMail abnehmen Kapitalanlage nahe Im Rahmen einer Mitgliedschaft helfen wir u.a. Arbeitnehmern, Beamten und Rentnern in Theater Braunschweig RUNDSCHAU FÜR DIE GEMEINDE LEHRE 3-Zimmer-Eigentumswohnung, Lohnsteuersachen Wohnfläche 64,12 m², Keller, Bal- kon u. Aufzug, Bj. 1958, Verbrauch- Lohnsteuerberatungsverbund e.V. sausweis, Fernwärme, 85,2 kWh, BOTE - Lohnsteuerhilfeverein - Kl. C Beratungs- Online-Besichtigung: Birkenfeldstr. 9e www.wolter.de/steinweg stelle 38165 Lehre Leiter Herr S. Robling KP 185.000,- Telefon 05308 990 551 LEHRSCHER E-Mail [email protected] Internet www.steuerverbund.de Ausgabe 10/20 43. Jahrgang Unabhängig Nicht parteigebunden Erscheint monatlich Petritorwall 6, 38118 Braunschweig IN KÜRZE 6. UND Höhe 20. OKTOBER:50 mm INFOS ZU RENTENFRAGEN Dieter Fäßler bietet an jedem 1. und 3. Dienstag im Monat eine kostenlose Sprechstunde zu Rentenfragen in Zim- mer 14 des Rathauses (Marktstraße 10, Symbolbild: Envato Elements Envato Symbolbild: Erdgeschoss) an. Dabei nimmt er An- träge an, gibt Formulare aus oder hilft bei Unklarheiten. Die nächsten Termi- ne fi nden statt am 15. September und 6. Oktober von 14 bis 18 Uhr. Eine Termin- Datum:vereinbarung 17.09.20 ist notwendig lam/- unter Tel. gesehen/geprüft:Aktionstage genehmigt: in den 05304 930990 oder 0171 2879932. D 4 01/19 0001 Jo. Wolter ImmobilienUM DEN GmbH 11. -
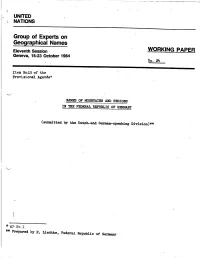
Group of Experts on Geographical Names Z Te^ WORKING PAPER
UNITED NATIONS Group of Experts on Geographical Names ZElevent Teh Sessio^ n WORKING PAPER Geneva, 15-23 October 1984 No. 2U Item NoJ.5 of the Provisional Agenda* . NAMES OF MQUITTAINS AND REGIONS IH THE FEDERAL REPUBLIC OP GERMAHY (submitted by the Butciv-and German-speaking Division)** •* W? Ifo. I ** Prepared by H. Liedtke, Federal Republic of Germany - 2 - GEOGRAPHICAL NAMES IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ACCORDING TO THE OFFICIAL GENERAL MAP (UBERSICHTSKARTE) 1:500,000, WORLD MAP SERIE 1404. Compiled by the Permanent Committee on Geographical -Names in the Federal Republic of Germany and prepared for publication by its chairman Prof. Dr. Herbert Liedtke, Geography Department, Ruhr-University, Bochum. Frankfurt am Main May 1984 Adresses; Standiger AusschuB fur Geographische Namen (Permanent Committee on Geographical Names) Institut fiir Angewandte Geodasie Richard-StrauB-Allee 11 D 6000 Frankfurt am Main Prof. Dr. H. Liedtke Ruhr-Universitac Bochum Geographisches Institut Postfach 102148 D 4630 Bochum HOW TO USE THE LIST OF GEOGRAPHICAL NAMES Alphabetical order; A a, A a H h Q o, 6 o U u, U ii B b I i Pp V v Co" J j Q q W w Dd Kk R r • X x Ee LI S s Y y F f . Mm T t Z z G g N n Annotation: A a, Q a £ U ii are handled as a, o & u. 3 can be handled as ss. Examples;_ Breisgau; Underlined names are printed in the Ubersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:500 000. Abteiland: Names not underlined are not printed in the above-mentioned map but are hereby recommended for consideration in a new edition. -
Veranstaltungen 2020
Veranstaltungen 2020 6 e it Se s. Infos Willkommen! Information und Anmeldung: Was ist ein Geopark? Telefon: 05353 - 3003, [email protected] Ein Geopark ist ein erdgeschichtlich überregional GEOPARK Geschäftsstelle bedeutendes Gebiet mit Felsen, Steinbrüchen und Niedernhof 6, 38154 Königslutter am Elm anderen Geotopen von besonderer Seltenheit und Telefon: 053 53 / 3003 Schönheit. Er enthält auch bedeutsame archäologische, www.geopark-hblo.de historische und kulturelle Objekte, die mit den natür- Bitte beachten Sie: lichen Ressourcen eng verknüpft sind. Aus organisatorischen Gründen bitten wir bei einigen Veranstaltungen um eine rechtzeitige Anmeldung per E-Mail oder Telefon. Einen Termin für den Anmeldeschluss finden Sie gegebenenfalls Unter einem Dach beim jeweiligen Angebot in dieser Broschüre. Freie Ein Geopark dient als Instrument für eine nachhaltige regi- Plätze werden jedoch auch nach Anmeldeschluss onale Entwicklung. Unter seinem Dach werden bestehen- vergeben. de Einrichtungen miteinander vernetzt und gemeinsame Herausgeber: Aktivitäten im Geotopschutz, im Freizeit- & Tourismus- bereich sowie in der Bildung für nachhaltige Entwicklung GEOPARK-Trägerverein Braunschweiger Land - Ostfalen Stadt Königslutter am Elm und der wissenschaftlichen Forschung entfaltet. Naturpark Elm-Lappwald Redaktion: Tanja Mühlhaus, Ulrich Scheithauer, Deborah Trümer, Dr. Henning Zellmer Geprüft und anerkannt! Gestaltung/Layout: Frank Gießelmann Der Geopark . Harz . Braunschweiger Land . Ostfalen Titelfoto: Steinsalz-Pseudomorphosen in Röt-Tonschie- wurde 2003 als Nationaler sowie 2005 als Europäischer fer, Oberer Buntsandstein, Grube Barley, Salzgitter Geopark anerkannt. 2015 erfolgte die Aufnahme ins Druck: Druckerei Bührig, Königslutter UNESCO Global Geopark Netzwerk. Kaum ein anderes Auflage: 8.000 Stück Gebiet in Europa ist von einer so großartigen geolo- Mitglied in den Netzwerken: Hallo, ich bin gischen und archäologischen Vielfalt geprägt! HOLLY, der kleine Europasaurus aus dem Vor- harz. -

18 HELMSTEDTER SONNTAG Schöningen • Heeseberg 11
HHELMSTEDTERELMSTEDTER www.helmstedter-sonntag.de Themen in dieser Ausgabe Exklusiv für Sie! 400.000 Euro jährlich für Kreis S. 2 Aktuelle Nachrichten SONDERHEFT: Dampflok auf Abschiedsfahrt S. 10 Zeitungs-Download ELM-LAPPWALD-MESSE Bauen & Wohnen S. 14 - 15 Bildergalerien KLEINANZEIGENMARKT SSONNTAGONNTAG Schöningen fehlen Kita-Plätze S. 18 Anzeigenannahme Seiten 11 - 13 20. Kindergartenturnier S. 20 - 21 Sonntag, 11. März 2018 DIE AKTUELLE REGIONALZEITUNG Unabhängig - nicht parteigebunden Nr. 10 Guten Morgen! Das Sonntagswetter Kleine Kunstwerke aus Ton wird Ihnen präsentiert von: Spitzentypen NEU - Unter den Ehrenamtli- chen gibt es zweierlei Omas Typen: die, die ständig Mittagsmenü und immer für alles Tel. 05352/50241 gelobt werden wol- len, was sie machen • min. 6 °C und die, die im Hin- • max. 18 °C tergrund agieren • heiter und auf das Rampenlicht keinen • Südostwind großen Wert legen. Die Sonne ist wieder zurück. Natürlich ist mir die zweite Perso- nengruppe deutlich lieber, aller- dings würden wir mit ihnen allein die ehrenamtliche Arbeit im Land wohl nicht bewältigen können. Es Scheibentausch sind also auch die nötig, denen i. d. R. innerhalb von 24 Std. regelmäßig der Rücken getätschelt Neue Scheiben oder der Bauch gepinselt werden muss, um die Gesellschaft an Lau- (alle Modelle) fen zu halten. Original Erstausrüsterqualität Dennoch: die bescheidenen sind HELMSTEDT die sympathischeren Typen, pa- Ecke Poststr./Magdeburger Tor cken sie doch an ohne große Fra- Scheiben-Doktor Helmstedt gen zu stellen oder lange zu über- Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 17 Uhr legen. Sie sind immer zur Stelle, Tel. 0 53 51 / 3 99 18 70 Anlässlich des Tages der offenen Töpferei, öffnet auch der Töpfergarten in Hötensleben seine Pforten für interessierte Besucher. -

Hydrogeologische Räume Und Teilräume in Niedersachsen
GeoBerichte 3 LANDESAMT FÜR BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE Hydrogeologische Räume und Teilräume in Niedersachsen Niedersachsen GeoBerichte 3 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Hydrogeologische Räume und Teilräume in Niedersachsen JÖRG ELBRACHT, RENATE MEYER & EVELIN REUTTER Hannover 2016 Impressum Herausgeber: © Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Stilleweg 2 30655 Hannover Tel. (0511) 643-0 Fax (0511) 643-2304 Download unter www.lbeg.niedersachsen.de 3. Auflage. Version: 04.05.2017 Redaktion: Ricarda Nettelmann e-mail: [email protected] Titelbild: Falschfarbenbild des Harlinger Landes und der Ostfriesischen Inseln zwischen Emsmündung und Jadebusen (Foto: Satellitenbild Landsat TM, zur Verfügung gestellt von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Fachbe- reich B 4.4). ISSN 1864–6891 (Print) ISSN 1864–7529 (digital) DOI 10.48476/geober_3_2016 GeoBer. 3 S. 3 – 118 42 Abb. Hannover 2016 Hydrogeologische Räume und Teilräume in Niedersachsen JÖRG ELBRACHT, RENATE MEYER & EVELIN REUTTER mit Beiträgen von BERND LINDER & CHRISTINA MAI Kurzfassung Im Zuge der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) wurde eine Be- schreibung der Grundwasserleiter und ihrer Eigenschaften erarbeitet. Dazu haben die Staatlichen Geologischen Dienste Deutschlands ein hierarchisches System von Hydrogeologischen Großräu- men, Räumen und Teilräumen entwickelt, mit dem Gebiete mit vergleichbaren geologischen und hydrogeologischen Eigenschaften nach einem bundesweit einheitlichen Verfahren beschrieben wer- den. Mit dem GeoBericht „Hydrogeologische Räume und Teilräume in Niedersachsen“ wird ein flächen- deckender Überblick der hydrogeologischen Verhältnisse in Niedersachsen vorgelegt. Dabei werden durch die Darstellung der elf Hydrogeologischen Räume zunächst die wesentlichen hydrogeologi- schen Gegebenheiten vermittelt. Die elf Hydrogeologischen Räume wurden weiter untergliedert in 81 Hydrogeologische Teilräume, die sich ganz oder teilweise in Niedersachsen erstrecken. -

Staffelzusammensetzungen 2021/22
Tischtennis-Kreisverband Helmstedt e.V. Staffelzusammensetzungen 2021/22 Staffeleinteilung Saison 21/22 (Stand 27.08.2021) nach Vereinsmeldung Kreisliga (9) Spielplanbesprechungen 1. Kreisklasse (10) TSG Königslutter II TuS Beienrode II Lutterwoelfe Vereinsheim des VfL Neu Büddenstedt/Offleben TSV Germania Helmstedt II TSV Rottorf/Gr. Steinum TTSG Brunsrode/Lehre III TSV Twieflingen Herbert‐Rauhut‐Straße SV Emmerstedt TSV Germania Helmstedt III 18:00 Uhr TSV Germania Helmstedt IV TVB Schöningen 1. September 2021 TSV Rottorf/Gr. Steinum TSV Grasleben III 18:30 Uhr TSV Lelm TSV Fichte Helmstedt TSV Gevensleben SC Rhode Spvg. Süpplingen TTSG Brunsrode/Lehre II 2. Kreisklasse Nord (8) Spielplanbesprechungen 2. Kreisklasse Süd (8) SV Beienrode/Uhry Helmstedter SV TTC Rieseberg/Scheppau Vereinsheim des TSV Germania Helmstedt V TTSG Brunsrode/Lehre IV TSV Rottorf/Gr. Steinum TSV Twieflingen II TTSG Brunsrode/Lehre V Herbert‐Rauhut‐Straße TSV Grasleben IV TSV Lauingen 19:00 Uhr TSV Süpplingenburg TSV Lauingen II 1. September 2021 SV Esbeck TuS Beienrode III SV Esbeck II TSG Königslutter III 19:30 Uhr TVB Schöningen II 3. Kreisklasse Nord (8) Spielplanbesprechungen 3. Kreisklasse Süd (8) TSV Lauingen III VfL Neu Büddenstedt/Offleben II Velpker SV Saal in Lauingen TVB Schöningen IV SC Rhode II Kornstraße 19 TVB Schöningen V TSV Lauingen IV 18:00 Uhr TSV Gevensleben II TSG Königslutter IV 3. September 2021 SV Emmerstedt II TSV Grasleben VI 18:30 Uhr SV Esbeck III TV Bornum TSV Grasleben V TuS Essenrode TVB Schöningen III 4. Kreisklasse Nord (11) Spielplanbesprechungen 4. Kreisklasse Süd (9) TTSG Brunsrode/Lehre VII Lutterwoelfe II TSV Rottorf/Gr. Steinum III Saal in Lauingen TV Bornum II SC Rhode III Kornstraße 19 SV Emmerstedt III Velpker SV IV 19:00 Uhr TSV Süpplingenburg II SV Beienrode/Uhry II 3. -

Ummendorf Castle
Collegiate church at the “Großer Graben” Hidden Anticline Tiefreichende Verkarstung ???? Claypit and gypsum Glossar 6 Hadmersleben and the “Großes Bruch” 7 Oschersleben and Hadmersleben 8 Kloster Gröningen und Erdfälle ??? 9 The “Kalkberg” at Westeregeln Geological development of the region Landmarks (“Landmarken”) are physically prominent We are driving first towards the collegiate church St. Having visited the municipal museum of Oschersleben Gröningen is situated at the southernmost edge of the Just across the boundary of the Landmark there is an The oldest rocks of the Landmark area are completely spots and/or well-known places which have been selec- Pankratius of the former monastery of Hadmersleben, we are driving to Hadmersleben which is now part of Landmark. The monastery of Kloster Gröningen with its outcrop of some importance for understanding the covered by younger rocks, but reach the surface in ted as being representative for a certain area. They are originally a collegiate foundation under the rules of St. Oschersleben. The village of Hadmersleben is situated church, St Vitus, is well known not only in the region and geological context. We follow the “Hadmersleberener the Flechtingen Ridge (“Flechtinger Höhenzug”) within name-giving for the area and may serve for a first ori- Augustine which belonged to the diocese of Halberstadt. at a ford crossing the river Bode on an old military thus became part of the touristic route “Romanesque Straße” northwest from Westeregeln towards the the area of Landmark 28 “Hundisburg Castle”. In entation within the second-largest geopark of Europe. Today it belongs to the diocese of Magdeburg and is part road from Halberstadt to Magdeburg and goes back Road” (“Straße der Romanik”). -

Verzeichnis Der Mitglieder Des Kreistages
A I 2 Verzeichnis der Mitglieder des Kreistages Anschrift Name, Vorname Telefon privat / Mobiles Telefon Beruf Partei Telefon dienstlich / Faxnummer Geburtstag E-Mail-Adresse Bahnhofstr. 20 b, 38154 Königslutter a.E. Albrecht, Claus-Helmuth (05353) 1052 / - Bauingenieur CDU (05353) 1051 / - 21.06.1948 [email protected] Dötling 5, 38373 Süpplingen Alt, Lars - / (0171) 1706327 Student FDP - / - 05.08.1991 [email protected] Am Wallgarten 37 a, 38364 Schöningen Backhauß, Rolf-Dieter (05352) 4923 / (0171) 3012828 Geschäftsführer SPD - / (05352) 58890 13.07.1941 [email protected] Im Oberdorf 6 a, 38165 Lehre, Wendhausen Beese, Burkhard (05309) 8800 / - Betriebswirt CDU - / - 07.01.1948 [email protected] Bahnhofstr. 24, 38459 Bahrdorf Broistedt, Hans-Hubertus - / (0171)5792988 Techn. Angestellter CDU - / - 17.06.1959 [email protected] [email protected] Schaperstr. 112, 38375 Räbke Dannehl, Dorothea (05355) 1946 / - Technische Zeichnerin CDU - / (05355) 1946 25.11.1952 [email protected] Kurzer Kamp 2, 38350 Helmstedt Dinter, Norbert (05351) 8079 / - Dipl. Verwaltungswirt (FH) CDU (05361) 4368343 / - 13.08.1963 [email protected] Marktstr. 10, 38154 Königslutter a. E. Dittmar, Gisela (05353) 7010 / - Hausfrau SPD - / (05353) 910761 04.02.1952 [email protected] Am Friedhof 6, 38350 Helmstedt Engelke, Roswitha (05351) 536054 / - Verwaltungsangestellte/ Rentnerin Die Linke. - / - 28.11.1948 [email protected] Am Cassebusch 25, 38165 Lehre, Groß Brunsrode Fitzke, Michael / / (0171) 6106754 Geschäftsführer UWG (05371) 98310 / (05371) 983131 03.04.1967 [email protected] Willigisstr. 9, 38364 Schöningen Fricke, Jan (05352) 909271 / - Kaufmann SPD - / (03222) 3783402 07.08.1980 [email protected] Schulweg 8, 38464 Groß Twülpstedt Hansmann, Dietrich (05364) 8367 / - Dipl. -

Doctoral Committee
THE HUMAN HORSE: EQUINE HUSBANDRY, ANTHROPOMORPHIC HIERARCHIES, AND DAILY LIFE IN LOWER SAXONY, 1550-1735 BY AMANDA RENEE EISEMANN DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2012 Urbana, Illinois Doctoral Committee: Associate Professor Craig Koslofsky, Chair Associate Professor Clare Crowston Professor Richard Burkhardt Professor Mark Micale Professor Mara Wade ii Abstract This dissertation examines how human-animal relationships were formed through daily equine trade networks in early modern Germany. As reflections of human cultural values and experiences, these relationships had a significant impact in early modern Braunschweig- Lüneburg both on the practice of horse breeding and veterinary medicine and on the gendering of certain economic resources, activities, and trades. My study relies on archival and cultural sources ranging from the foundational documents of the Hannoverian stud farm in Celle, tax records, guild books, and livestock registers to select pieces of popular and guild art, farrier guides, and farmers’ almanacs. By combining traditional social and economic sources with those that offer insight on daily life, this dissertation is able to show that in early modern Germany, men involved with equine husbandry and horse breeding relied on their economic relationship with horses' bodies as a means to construct distinct trade and masculine identities. Horses also served as social projections of their owners’ bodies and their owners’ culture, representing a unique code of masculinity that connected and divided individuals between social orders. Male identities, in particular, were molded and maintained through the manner of an individual’s contact with equestrian trade and through the public demonstration of proper recognition of equine value. -
Anmeldung Für Klasse 5 in Wolfsburg
Ihr KONTAKT zu uns: ANSPRECHPARTNER*INNEN LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE und weitere Informationen rund um das Thema ANMELDUNG KLASSE 5: AUS DEM LANDKREIS HELMSTEDT, Diese freien Schulplätze können unter bestimmten Wolfsburg bekennt sich zur Region und heißt daher Voraussetzungen an Kinder und Jugendliche STADT WOLFSBURG Schülerinnen und Schüler aus den angrenzenden vergeben werden, die nicht in Wolfsburg leben. Geschäftsbereich Schule Städten und Landkreisen herzlich willkommen! Schulberatung Aufgrund der steigenden Schülerzahlen kommt es Porschestraße 74 Mit diesem Faltblatt erhalten Sie einen Überblick über allerdings vor, dass an einigen Schulen mehr das Aufnahmeverfahren an einer weiterführenden Anmeldungen vorliegen, als Schulplätze zur 38440 Wolfsburg Schule in Wolfsburg. Damit möchte die Stadt Verfügung stehen. Davon waren in den letzten ✆ 05361 28 - 10 70 Wolfsburg Sie und Ihr Kind bei dem Wechsel in die Jahren die Schulformen Gymnasium und ✉ [email protected] Klasse 5 unterstützen. Gesamtschule betroffen (zukünftig auch Realschulen). An diesen Schulen müssen Los- Weitere Informationen zur Aufnahme an einer Grundsätzlich müssen Schüler*innen eine Schule in verfahren durchgeführt werden. Aufgrund der weiterführenden Schule in Wolfsburg erhalten Sie auch auf dem Schulbezirk besuchen, in dem sie ihren Wohnsitz Losverfahren erhalten überwiegend auswärtige www.wolfsburg.de/schulen. oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Das bedeutet in Schüler*innen keinen Schulplatz an der Ihrem Fall, dass Ihr Kind in der Regel eine Schule im erstgewählten Schule. Stand: Januar 2019 Landkreis Helmstedt besuchen muss. Ausschließlich Es empfiehlt sich daher, sich vorsorglich auch im Rahmen der im Anschluss folgenden Aufnahme- Gedanken über eine alternative Schule zu machen. ANMELDUNG FÜR KLASSE 5 regelungen ist die Anwahl einer Wolfsburger Schule Sollte Ihre Wahl auf die Schulform Gymnasium IN WOLFSBURG möglich.