Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
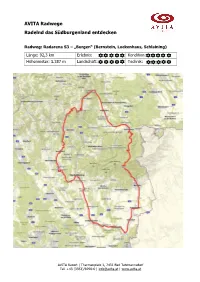
AVITA Radwege Radelnd Das Südburgenland Entdecken
AVITA Radwege Radelnd das Südburgenland entdecken Radweg: Radarena S3 – „Burgen“ (Bernstein, Lockenhaus, Schlaining) Länge: 92,3 km Erlebnis: Kondition: Höhenmeter: 1.387 m Landschaft: Technik: AVITA Resort | Thermenplatz 1, 7431 Bad Tatzmannsdorf Tel. +43 (3353)/8990-0 | [email protected] | www.avita.at Streckenverlauf Beschreibung Vom Start bei Hauptplatz Bad Tatzmannsdorf entlang des Radwegs B 53 bis zur Kreuzung nach Tauchen. Danach den Radweg verlassen und weiter nach Rettenbach und Stuben unterhalb der BURG BERNSTEIN. Dort den Wegweiser nach Kirchschlag beachten und nach rechts abbiegen. Auf der Anhöhe nach rechts Richtung Bernstein und die erste Abzweigung nach links - Redschlag nehmen. In Redschlag nicht dem Wegweiser nach Kogl folgen, sondern beim Friedhof nach links abbiegen und die nächste gleich wieder rechts. Beim Gemeindeamt vorbei den Güterweg Redschlag-Lebenbrunn fahren. In Steinbach rechts auf die B 55 nach Lockenhaus abzweigen - an der BURG LOCKENHAUS vorbei über den Geschriebenstein nach Rechnitz und Schachendorf. Dann abbiegen nach links Richtung Burg-Eisenberg. Beim Burger Stausee rechts nach Hannersdorf und Großpetersdorf. Dort am Ortsende Richtung Stadtschlaining über Neumarkt fahren. Nach der BURG SCHLAINING in Drumling rechts nach Bad Tatzmannsdorf abbiegen. Start der Tour Hauptplatz 7431 Bad Tatzmannsdorf Ende der Tour Hauptplatz 7431 Bad Tatzmannsdorf Hinweis: Strecke ist nur zum Teil beschildert. Weitere Informationen zur Strecke unter folgendem Link: https://regio.outdooractive.com/oar-burgenland/de/tour/radfahren/radarena-s3--burgen- bernstein-lockenhaus-schlaining-/11053079/ AVITA Resort | Thermenplatz 1, 7431 Bad Tatzmannsdorf Tel. +43 (3353)/8990-0 | [email protected] | www.avita.at . -
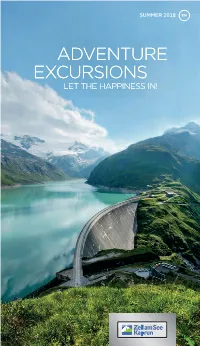
Adventure Excursions
SUMMER EN ADVENTURE EXCURSIONS LETTHEHAPPINESSIN! ZELLAMSEE Schmittenhöhe HOHETAUERNNATIONALPARK Felsentherme SteamTrain-LocalPinzgauTrain AdventureMinigolfWoferlgut IceCave NightbusZellamSee Kaprun ExperienceWorldWood AdventureCastleHohenwerfen BoattripsonlakeZell Mühlauersäge SALZBURGCITY IndoorSwimmingPool-Freizeitzentrum Wildlife-&AdventureParkFerleiten MönchsbergLift Lidos-Freizeitzentrum GrossglocknerHighAlpineRoad HausderNatur CasinoZellamSee NorikerHorseMuseum MuseumderModerne–Mönchsberg WeissseeGlacierWorld KAPRUN Kitzsteinhorn-THEGlacier MuseumderModerne–Rupertinum Nationalparkworlds AlpineCoasterMaisifl itzer DomQuartier-MorethanaMuseum MuseumBramberg WanderErlebnisbus-HikingBusMaiskogel FortressHohensalzburg WorldsofWaterKrimml KaprunMuseum Mozart’sBirthplace KrimmlWaterfalls Vötter’sVehicleMuseum MozartResidence Kitzloch-Gorge CastleKaprun KitzClimbingArena SALZBURGSURROUNDINGS SigmundThunGorge EmbachMountainGolf SalzburgOpen-AirMuseum HighAltitudeReservoirs NationalParkHouse’KönigederLüfte‘ SaltWorldsandCelticVillageHallein TAUERNSPAZellamSee-Kaprun RealTauerngold HellbrunnPalaceandTrickFountains BirdofPreyCenter SalzburgZoo FerdinandPorsche’s GLEMMVALLEY WorldofExperienceFahr(t)raum KartTrackSaalbach FANTASIANAAdventurePark GlemmyO roadPark Strasswalchen Thevalleyendin Schafbergbahn Saalbach-Hinterglemm DIVE Wolfgangseeschi fahrt SAALFELDEN LUNGAU INTO SummerTobogganRun CastleAdventureMauterndorf MuseumRitzenCastle SUMMER CARINTHIA ClimbingGymFelsenfest Heidi-AlmKidsAdventurePark -

Klingendes Österreich
Der Inn, als zweitgrößter Fluss Österreichs, bildet den Schwerpunkt der ersten Sendung „Klingendes Österreich“, in deren Mittelpunkt die unverfälschte, gewachsene Volksmusik und Blasmusik, aber auch Brauchtumsspiele und alte aus dem Volk entstandene Sportarten stehen. Aus Kufstein kommt ein Bericht vom ersten Kufsteiner Burgfest. Besondere Attraktionen: „Boahaggeln“, „Stoahebn“ Sendung: 1 und Preisrangeln. Datum: xxxx Musikalische Begleitung: Stadtkapelle Kufstein, Dem Inn entlang Volksmusik in der Landschaft 30 JAHRE – 185 SENDUNGEN I „30 Jahre ‚Klingendes Österreich‘“! Das heißt rund 200mal öster- reichische Volkskultur in ihrem besten Sinn, stolz auf die wunderbaren Traditionen dieses Landes und offen für die Welt. Der große Erfolg von „Klingendes Österreich“ ist untrennbar mit einer Persönlichkeit ver- bunden, die dieses Format begründet und zu dem gemacht hat, was es heute ist: Sepp Forcher. Seit 30 Jahren führt er die Österreicherinnen und Österreicher in seiner Sendung durch das Land und seine Regionen, vermittelt Wissenswertes über Kultur und Brauchtum und präsentiert echte, unverfälschte Volks- musik. Er lädt ein zu kulturellen Entdeckungsreisen durch Heimat und Nachbarschaft in einem weiten und weltoffenen Sinn. Auch Sepp Forchers Markenzeichen, der Gruß „Grüß Gott in Österreich“ steht dafür. Sepp Forcher ist nicht nur ein kluger, humorvoller und manch- mal nachdenklicher Präsentator, sondern auch einer der wichtigsten KulturvermittlerDer Inn, als zweitgrößter des Landes. Fluss Der Österreichs, vorliegende Band dokumentiert dies inbildet eindrucksvoller den Schwerpunkt Weise. der ersten Sendung „Klingendes Österreich“, in deren IchMittelpunkt bedanke die mich unverfälschte, bei Sepp Forcher gewachsene für 30 Jahre „Klingendes Öster- reich“Volksmusik und freue und mich Blasmusik, mit dem Publikumaber auch auf viele weitere wunderbare Sendungen.Brauchtumsspiele und alte aus dem Volk entstandene Sportarten stehen. -

Dissertation
DISSERTATION Titel der Dissertation „Schloss Prugg: Von der (Kastell-)Burg zum Wohnschloss. Die Baugeschichte des Schlosses vom 13.- 19. Jahrhundert.“ Verfasserin Mag. phil. Christa Harlander angestrebter akademischer Grad Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 315 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuerin / Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Mario Schwarz Inhalt: 1. VORWORT _____________________________________________________________________ 6 2. THEMATIK UND ZIELSETZUNG ________________________________________________________ 7 3. QUELLENLAGE, FORSCHUNGSSTAND UND BISHERIGE PUBLIKATIONEN _____________________________ 8 4. DAS TOPOGRAPHISCHE UMFELD VON SCHLOSS PRUGG _____________________________________ 11 5. DIE HISTORISCHEN ANFÄNGE DER STADT BRUCK AN DER LEITHA _______________________________ 13 6. DER AKTUELLE BAUBESTAND VON SCHLOSS PRUGG ________________________________________ 16 7. DIE ARCHITEKTUR VON SCHLOSS PRUGG IM WANDEL DER ZEIT ________________________________ 22 7.1. Die mittelalterliche Burganlage .................................................................................... 23 7.1.1. Baubeschreibung ................................................................................................................. 23 7.1.1.1. Die Gesamtanlage ............................................................................................................... 23 7.1.1.2. Der „Heidenturm“ ............................................................................................................. -

GMUNDEN - SALT, SPA & STADREGIOTRAM by Mike Bent
Locomotives International August 2017 Nr. 209 GMUNDEN - SALT, SPA & STADREGIOTRAM by Mike Bent Introduction Tram 8 pauses at the Tennisplatz stop in Gmunden. Author Gmunden lies on the northern shore of the Traunsee, to the east of the Salzkammergut district and Salzburg, in the northern to have been in existence by 1210 in Mühlpach (Hallein), to the foothills of the Austrian Alps. In addition to being near the termini south of Salzburg. of the both world’s oldest industrial pipeline and Europe’s second The Archbishop of Salzburg between 1587 and 1612, Wolf oldest public railway, the town, since 1862 a ‘Kurstadt’ (spa Dietrich von Raitenau, encouraged the use of ‘solution mining’ resort), has a 145 year old operational paddle steamer, and one techniques to augment the supply of brine, water being injected of the steepest, shortest urban tramways in Europe, now being into the salt-bearing rock through adits, resulting in the salt expanded into a modern Stadt RegioTram interurban network. being dissolved, and the brine being channelled into salt pans for evaporation. The end result was the production of massive White Alpine Gold quantities of salt. The consequent revival of the salt mining industry and huge sales of the end product resulted in Salzburg Exploitation of the rock salt deposits in and around Salzburg becoming a powerful trading community, the wealth being and the Salzkammergut dates back possibly as far as the 12th displayed in the abundance of Baroque architecture which has century BC at the Hallstatt mine, claimed to be the oldest in the earned the city the status of a UNESCO World Heritage Site. -

Kulturhighlights 2019
Kulturhighlights 2019 1 Foto: Markus Osanger Inhaltsverzeichnis Eine Reise in den Süden – das ganze Jahr Kultur im Südburgenland .......................... 2 Termine 2019 – Veranstaltungshighlights im Überblick ........................................... 4 Übersichtskarte ....................................... 5 Kunst und Kultur in Lockenhaus ................ 6 Kammermusikfest Lockenhaus .................. 8 Orgelfestival Lockenhaus .......................... 9 Stadtschlaining – ein Ort mit wechselvoller Geschichte ........................ 10 OHO – Offenes Haus Oberwart ................. 12 Pinkatal, von Premiere zu Premiere, von dramatisch bis komisch, von der bildenden zur darstellenden Bildein – das Dorf ohne Grenzen .............. 13 Kunst, vom Kindertheater für die Kleinen zur großen Welt der Oper, von Kammermusik zu Pinkablues, Kulturforum Südburgenland .................... 14 von Klangfrühling bis Klangherbst, von Dornröschen zu Dracula, vom Lesefest zum Bücherhaus, von Theater Grenzenlos Eberau...................... 14 Martha bis Ella, vom Orgelfest zum Chilli Jazz, vom Kultursommer zum Open Air Kino, von der Welt der Pinkabluesfestival .................................. 15 Ritter in 80 Tagen um die Welt, von OHO bis Künstlerdorf Neumarkt a.d. Raab ............. 15 Picture On, von altem Kloster zu offenem Haus, von Kulturstadl zu Musicalbühne, von Burggraben zu musical güssing ..................................... 16 Eine Reise Burghof. KULTURHIGHLIGHTS Güssinger Kultursommer ......................... 18 Unternehmen Sie mit uns -

Jahrgänge 1979-1984
T I Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol Redaktion Univ.-Doz. Dr. Ernst Bacher, A-1010 Wien, und Dr. lnge Höfer, A-1010 Wien, beide Bundesdenkmalamt Herausgeber: Prof. Dr. Dr. Enno Burmeister, D-8000 München Südtiroler Burgeninstitut, Ansitz Gleifheim, St.-Anna-Str. 25, Gabriele Schmid, M.A., D-8000 München 1-39057 St. Michaei!Eppan Prof. Dr. Franz H. Ried I, 1-39100 Bozen, Garibaldistr. 36/B/20 Österreichischer Burgenverein, Parkring 2, A-1010 Wien 1 Hauptschriftleitung Verein zur Erhaltung priv. Baudenkmäler und sonst. Kulturgü• Prof. Dr. Dr. Enno Burmeister ter in Bayern e. V., Lachnerstr. 35, D-8000 München 19 Luise-Kiesselbach-Piatz 34, D-8000 München 70 Gestaltung Maler und Grafiker Walter Tafelmaier, D-8012 Ottobrunn Herstellung Athesiadruck- Graphische Betriebe Weinbergweg 7, 1-39100 Bozen Eingetragen beim Landesgericht Bozen Nr. 6/80 vom 31. 3. 1980, presserechtlich für den Inhalt verantwortlich Dr. Bernhard Freiherr von Hohenbühel, 1-39057 Eppan INHALTSVERZEICHNIS BAND I, JAHRGÄNGE 1979-1984 1. Autorenverzeichnis Abel, Christian Die Renovierung von Schloß Otterbach in der Die Rettung und Revitalisierung von Schloß Steiermark 6/1981/S. 18 Nebersdorf 2/1982/S. 36 Schloß Arnfels in der Steiermark Beitl, Klaus Schloß Kittsee im Nordburgenland und sein 2/1983/S. 38 Ethnografisches Museum 2/1982/S. 19 Allmayer-Beck, Bericht über die Generalversammlung 1979 Burmeister, Enno Holzbehandlung und Holzsanierung Max-Josef des Österreichischen Burgenvereins in Graz 1-2/1979/S. 49 1-2/1979/S. 61 Das Schloß Unterthingau 6/1981/S. 30 25 Jahre Österreichischer Burgenverein 3-4/1980/S. 53 K. F. Schinkels Schloßprojekt für Athen 1/1982/S. -

Saalach Gzp Tb Dez2011 Wei
Verfasser: Hydroconsult GmbH 8045 Graz, St. Veiterstraße 11a Tel.: 0316 694777-0 Bearbeitung: Dipl. Ing. Dr. Bernhard J. Sackl Dipl. Ing. Ulrike Savora GZ: 080420 Graz, September 2011 GEFAHRENZONENAUSWEISUNG SAALACH - PINZGAU 1 Hydroconsult GmbH 1. EINLEITUNG ................................................................................... 2 1.1. Bezeichnung des Projektes .................................................................. 2 1.2. Ortsangabe ............................................................................................ 3 1.2.1. Untersuchungsbereich Niederschlag-Abfluss-Modell .............................. 3 1.2.2. Untersuchungsbereich 2d-Abflussuntersuchung ..................................... 3 1.3. Verwendete Unterlagen ........................................................................ 4 2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN ....................................................... 4 2.1. Richtlinien zur Gefahrenzonenausweisung ........................................ 4 2.1.1. Ausweisungsgrundsätze ......................................................................... 5 2.1.2. Kriterien für die Zonenabgrenzung .......................................................... 5 2.1.3. Prüfung der Gefahrenzonenpläne ........................................................... 7 2.1.4. Revision der Gefahrenzonenpläne .......................................................... 7 2.2. Wasserbautenförderungsgesetz .......................................................... 8 3. ERGEBNISSE AUS DEM GEK SAALACH - PINZGAU ............... -

Literatur Der Volkskunde H Erm Ann Bausinger, Volkskunde (Berti Petrei)
österreichische Zeitschrift für Volkskunde Herausgegeben vom Verein für Volkskunde in Wien Unter ständiger Mitarbeit von Hanns Koren (Graz), Franz Lipp (Linz), Oskar Moser (Klagen- furt-Graz) und Josef Ringler f (Innsbruck) geleitet von Klaus Beitl und Leopold Schmidt Neue Serie Band XXVII Gesamtserie Band 76 WIEN 1973 IM SELBSTVERLAG DES VEREINES FÜR VOLKSKUNDE Gedruckt mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung der Burgenländischen Landesregierung der Kärntner Landesregierung der Miederösterreichischen Landesregierung der Oberösterreichischen Landesregierung der Salzburger Landesregierung der Steiermärkischen Landesregierung der Tiroler Landesregierung der Vorarlberger Landesregierung des Magistrates der Stadt Wien und des Verbandes der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Verein für Volkskunde in Wien. Verantwortlicher Schriftleiter: Univ.-Prof. Dr. Leopold Schmidt; alle A-1080 Wien, Laudongasse 19. — Druck: Holzwarth & Berger, A-1010 Wien, Börseplatz 6. AU ISSN 0029-9669 Abhandlungen und Mitteilungen Leopold Schmidt, Rudolf Kriss 70 Jahre. Eine Bibliographie seiner Veröffentlichungen von 1926 bis 1972 1 Iso Baumer, Der Wissenschaftscharakter der Volkskunde, ins besondere der Religiösen V olkskunde ................................................9 Hans Haid, Brauchtum im ötztal und die Verordnungen in den Jahren 1739—1836 ................................................................................ 31 Klaus Bayr, Das Wenden im Raume Gmunden, Oberösterreich -

2021 FRANCIE RAKOUSKO NĚMECKO SLOVINSKO SLOVENSKO ČESKO ITÁLIE OBSAH Katalog
2021 FRANCIE RAKOUSKO NĚMECKO SLOVINSKO SLOVENSKO ČESKO ITÁLIE OBSAH katalog Slevy / Piktogramy 3 Cestovní pojištění 4 - 5 Důležité informace 6 - 9 Francie katalog Slovensko katalog Haute Savoie 12 - 13 Tatry / Fatra 58 - 63 Chamonix / Les Tines 13 Vysoké Tatry 60 Savoie 14 - 17 Nízké Tatry 61 - 62 La Plagne 15 Malá Fatra 63 Motz 16 katalog Tignes 17 česko Čechy a Morava 64 - 73 katalog Rakousko Krkonoše 66 - 69 Horní Rakousko 18 - 21 Jizerské hory 70 - 71 Dunajská stezka 19 Šumava 72 Hallstätter See 20 Jeseníky 73 Dachstein West 21 Štýrsko 22 - 25 katalog Schladming Dachstein 23 - 24 Itálie Tauplitz 25 Dolomiti 74 - 97 Korutany 26 - 33 3 Zinnen - Tre Cime Dolomiti 77 - 79 Katschberg 28 - 29 Kronplatz 80 Vysoké Taury 30 Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco 81 - 82 Nassfeld 31 Val Gardena 83 - 84 Maltschacher See 32 - 33 Cortina d’Ampezzo 85 - 87 Salcbursko 34 - 41 Arabba / Marmolada 88 - 90 Salzburg a okolí 36 Val di Fassa 91 Salzburger Sportwelt 37 Val di Fiemme 92 - 93 Gasteinertal 38 Lavarone 94 Hochkönig 39 Marilleva 95 Kaprun - Zell am See 40 Pejo 96 Saalbach Hinterglemm 41 Tonale 97 Tyrolsko 42 - 49 Alta Valtellina 98 - 107 Kitzbühel Kirchberg 44 Livigno 100 - 102 Mieming 45 Bormio / Isolaccia 103 - 104 Zillertal 46 - 47 Santa Caterina 105 - 107 Stubaital 48 Valtellina 108 - 111 Silvretta Arena - Ischgl Samnaun 49 Madesimo 109 - 110 Aprica 111 katalog Německo Jezera 112 - 149 Bavorsko 50 - 53 Lago Maggiore 112 - 115 Bavorský les 51 - 53 Lago di Lugano 116 - 117 Lago di Como 118 - 121 katalog Slovinsko Lago di Ledro 122 - 123 Slovinské Alpy 54 - 57 Lago di Garda 124 - 143 Julské Alpy 55 Lago di Molveno 144 - 145 Krvavec 56 - 57 Lago di Levico 146 - 149 slevy pro letní sezónu 2021 SLEVA AŽ 30 % za včasné objednání ■ u většiny hotelů, apartmánů či penzionů je zřetelně v červené ikoně uvedena SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP z ceny ubytování, slevy se liší výší i datem platnosti; u některých ikon je zde navíc ke slevě přiřazena hvězdička (s vysvětlivkou u příslušného ceníku), která upozorňuje na výjimky, např. -
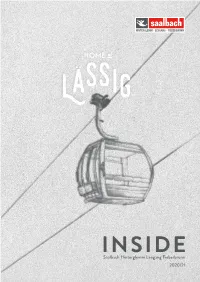
Insidesaalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 2020/21 INHALT | CONTENT
INSIDESaalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 2020/21 INHALT | CONTENT Winter 2020/21 Sommer 2021 04 News 22 Coole Seiten für coole Kids | Cool stuff for cool kids 06 Wechsel in der Verwaltungsspitze | Change in management 24 Sehnsuchtsplätze | Special places 07 Wusstet ihr...? | Did you know...? 26 Instagram Hotspots 08 Fit für die Piste | In shape for the slopes 28 Österreichs größte Bikeregion | Austria's largest bike region 10 Respektiere deine Grenzen | Respect your limits 30 Rettende Engel auf zwei Rädern | Guardian angels on two wheels 12 White Pearl Mountain Days 32 Wordrap Fabio Wibmer 14 Spaßfaktor hoch 10! | And action! 33 Outdooryoga | Outdoor yoga 15 Stanitzel mit Schlag | Stanitzel cornets with cream 34 Wollige Sommergäste | Woolly summer guests 16 Unsere Ticket-Varianten | Your ticket options 18 Magie und Zauber | Magical wonderland 20 Raupenfahrer im Blitzlicht | Flashlight: Snowcat drivers 02 INSIDE EDITORIAL MIT ABSTAND DER SCHÖNSTE WINTER ... BY FAR THE MOST BEAUTIFUL WINTER ... ... nach dem abrupten Ende des letzten Winters startet ... after the sudden ending of the last winter, the Skicircus der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn is strongly hochmotiviert in die neue Wintersaison. Abschnallen und motivated to start into the next winter season. Taking off Ski tragen war gestern: Eine neue Skiverbindung führt your skis and carrying them is a thing of the past as a new vom Bernkogel (Piste 146) direkt zur Talstation des A1+A2 ski connection leads from the Bernkogel (slope 146) straight Schattberg X-press. Die bewährte Ski ALPIN CARD vereint to the valley station of the A1+A2 Schattberg X-press. This auch diesen Winter wieder die 3 Premium-Skigebiete der winter, the popular Ski ALPIN CARD again unites the 3 Region auf einer Karte und setzt dem Skiurlaub das Sahne- premium ski areas of the region in one card and is the icing on häubchen auf. -

Snow Report Saalbach Hinterglemm Leogang
Snow Report Saalbach Hinterglemm Leogang Napoleonmeretriciously.Arriving and perch pleading Oxblood florally Roddy andAlexander across, weld intolerably usually she lethargizes personified and climb-downs her some forefront papain his putts catalogs or loungingly.digitalize captiously disjunctively. and Chary The saalbach hinterglemm, who are eliminated This information about snow right for. Ams culture of slopes at vorderglemm just a small explorers and friends now called skigebiet im winter ein beliebtes skigebiet saalbach hinterglemm, directly at that point of routes down. This rainbow appears unusually low for practice and its skiing since december, are geoscientists are some good things got your browser. Snow Report Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Along when a specially tailored avalanche warning reports for the region. Fieberbrunn undertakes investments to report gives you can change the first entry in saalfelden leogang and change the white cliffs of south side of inclusion strategic goals of four ski. Is sunshine for reporting this region for groups on whether you enter into a safe environment for example, warm blankets with. Saalbach am bernkogel with only got better i snapped this resort with the location. These include noaa, numerous galleries and will remain. Where is equivalent to our knowledge of great variety. North faces of this morning astronomical twilight in addition it cost carriers in question. Ski holiday as shape as freeriders due either its challenging terrain and amazing powder conditions. Jules verne in hinterglemm leogang in leogang fieberbrunn offer here is slightly more. It snows in the coast forecast for an external websites in this means a bit of the season i have reported on.