Buchbesprechungen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Surface of Public Space Working with the “Plane” to Design Urban Voids
The Surface of Public Space Working with the “Plane” to Design Urban Voids PAOLA VERONICA DELL’AIRA1 At the end of the 1940s they taught me that architecture was about mass and volume. Space arrived in the 1950s. Denise Scott Brown Abstract: This Paper examines the “return to the surface” in the design of contempo- rary urban space: shunned by modernist thinking, this dimension has now reacquired importance and ... “relief”. The surface, horizontal and vertical, is no longer a space of capricious decoration. Landscaping, texture, colour, tactile, visual and audio effects are now structuring materials. They configure weak actions with strong effects. The soil, in particular, is the “skin” of public space, its face. Promenades, piazzas, widen- ings, crossroads, grow more complex in their performance and image, intensifying the experience of their use. They indicate specific functions, through a design of palimp- sests. They draw lines on the ground for team sports, trace maps for the installation of furnishings, host technological networks, bring light and air to underground spaces and incorporate lighting. Like façades, soils also multiply their layering to become complex technological and bioclimatic devices. For example, ventilated walls and “dry laid” paving. Or vertical screens, brise-soleil and silkscreened walls, rises and drops, undulations and level changes, technical floors, raised paving, plug-in grids, landscaped parterres: from the second screen to ... the second pavement! This text describes techniques, morphological developments and feasibility and offers an excursus through examples from past and recent history. Keywords: public urban space, dematerialization, void, design of the soil, return to the surface, working “with the plane”, “horizontal” action, second pavement, patchwork, design on the ground. -

Annual Report 2006
Annual Report The Jerusalem Foundation Table of Contents 2 A Year in Review 12 From the President 13 The Jerusalem Foundation 18 Culture 26 Coexistence 32 Community 40 Education 48 Financial Data 2006 51 Awards and Scholarships 52 Jerusalem Foundation Donors 2006 57 Jerusalem Foundation Board of Trustees Summer concerts 58 Jerusalem Foundation at Mishkenot Sha'ananim Leadership Worldwide opposite the Old City walls A Year in Review Installation of 5-ton sphere at the Bloomfield Science Museum Shir Hashirim(Song of Songs) Garden at the Ein Yael Living Museum Festival for a Shekel, Summer 2006 The Max Rayne School A Hand in Hand School for Bilingual Education in Jerusalem First Annual Shirehov - Street Poetry Festival, June 2006 Art activities at the Djanogly Visual Arts Center The Katie Manson Sensory Garden From the President Dear Friends, The Jerusalem Foundation is proud of our 40 years of accomplishments on behalf of Jerusalem and all its residents. In every neighborhood of the city, one encounters landmarks of our long journey and the effort to promote a free, pluralistic, modern and tolerant Jerusalem. We are happy to share with you the Jerusalem Foundation’s Annual Report for 2006, another successful year in which we raised a total of $30.5 million in pledges and grants. This brings the total of all donations received by the Foundation in Jerusalem since its establishment to $691 million (about $1.1 billion if adjusted for inflation). The Foundation’s total assets increased over the past year from $115.3 million at the end of 2005 to $123.5 million at the end of 2006. -

CV Annemarie Bucher Dr
CV Annemarie Bucher Dr. sc. ETH/ lic. phil. I. Geboren 7.10.1960 Adresse Stationsstrasse 54, CH- 8003 Zürich Telefon +41 1 463 72 61 Mobil +41 78 823 46 06 E-mail [email protected] / www.ifcar.ch [email protected] foa-flux.net Ausbildung 2009 Doktorat an der Architekturabteilung der ETH Zürich in Landschaftstheorie These: Naturen ausstellen: Schweizerische Gartenausstellungen zwischen Kunst und Ökologie 2009 Certificate of Advanced Studies in Ethnobotanik und Ethnomedizin, Universität Zürich 2005 Research Fellow an der Harvard University, Graduate School of Design, Cambridge MA/USA 1990 Lizentiat an der Universität Zürich in Kunstgeschichte Lizentiatsarbeit: spirale. Eine Künstlerzeitschrift 1953 - 1964. Nebenfächer: Ethnologie und Philosophie Spezialisierungen: Kunst der Moderne und Gegenwart, Druckgrafik, Ästhetik, Landschaftstheorie, Landschaftsarchitektur, Gartenkunst, Naturphilosophie, Kunstethnologie, Ethnobotanik, Sprachen: Deutsch, englisch, französisch, spanisch Berufserfahrung (Auswahl) seit 2012 Lehrbeauftrage für Geschichte der Kulturlandschaft an der ZHAW Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Wädenswil seit 2012 Prüfungsexpertin an der Hochschule Luzern für Architekturgeschichte seit 1992 Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK Dozentin Vertiefung Theorie, DKM/ Mentorin, Master Transdisziplinarität/ wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschung am IFCAR 2008 Gründung von FOA-FLUX, interdisziplinäre Forschungsplattform, mit Dominique Lämmli 1999 - 2007 Oberassistentin (für Lehre und Forschung) am Institut -

Augsburg-Druck- Ebook
JEWISH CEMETERY AUGSBURG GRAVELIST based on original vital records 1867 – 1940s researched and displayed by Rolf Hofmann + Herbert Immenkötter printed in 2018 1 CONTENT 3 Introduction 4 Necrology based on original Vital Records 110 Family Name Index 126 Maiden Name Index 131 Birth Place Index 140 Chronological Order of Grave Sites 141 Schematic Cemetery Map 146 Stonemason Max Koppel & Sons 147 Memorial of World War I Victims 149 Photo Gallery of Remarkable Graves 156 Biographical note on Rolf Hofmann 158 Biography of Herbert Immenkötter 159 Main Sources of Cemetery Research 160 Imprint 2 INTRODUCTION This necrology was originally compiled by the historic Jewish Community of Augsburg from 1867 (foundation of Augsburg Jewish cemetery at Haunstetter Strasse) until 1940 (end of Jewish Community) and also corresponds to the grave sites, as numbers of this necrology are the same as on gravestone backs, still legible today. Additional information comes from vital records of Community Registry Office. This grave list is published on the Alemannia Judaica website. Family history details were compiled in 2009 - 2011 by Rolf Hofmann together with Herbert Immenkötter. Of great help was Gernot Römer’s remarkable book “An meine Gemeinde in der Zerstreuung” (circular letters by Augsburg Rabbi Ernst Jacob 1941-1949) with family history details which otherwise we would not have been able to gather. This list is inevitably incomplete, it contains errors and does not cover all death cases of Augsburg Jewish families between the opening of the Augsburg Jewish cemetery (1867) and the liquidation of the Jewish community (ca 1940) because of limited available resources. However, there is a wealth of information on many Jewish families who then had lived in Augsburg - valuable for descendants, historians as well as genealogists. -

Bauwelt 2002 93
Bauwelt 2002 93. Jahrgang 1--2 Zellenforschung 3 Insel Seguin 4 Global Shopping 5 Schulbeispiele 6 Am Rand von Dorf und Stadt 7 Fingerübungen 8 Sonderlinge in der Stadt 9 Zu Büros umgenutzt 10 Wohnhäuser in Tschechien 11 Stadionarchitektur 12 Stadtbauwelt 153 Kasachstan 13 Der Werkstoff als Inspiration 14 Die Kommune baut 15 Zeitschichten 16 Magdeburg, Chemnitz 17 Winzer und Architekten 18--19 Wohnen im übergroßen Maßstab 20 Bauen für Behinderte 21 Festivals 22 Museums-Saison 23 Sieben Selbstversuche 24 Stadtbauwelt 154 Berliner Mauer 25 Am Aegi in Hannover 26 Gerüstbauten 27 Documenta 11 28 Architektenbriefe 29 Wohnexperimente 30--31 Entwicklung, Produktion, Lagerung 32 Kunst- und Kulturfabriken 33 Kliniken 34 4 Semester Grundlehre 35 Höhere Schulen 36 Stadtbauwelt 155 Mexiko-Stadt und São Paulo 37 Selbstbewusste Eigentümer 38 Der Neue Weg in Norden 39 Ex libris 40 Fassaden verlautbaren 41 Großstadtkinder 42 Infrastruktur 43--44 Kinotag 45 Forschung und Lehre 46 Öffentliches 47 Architektur – Fotografie 48 Stadtbauwelt 156 Dirty Urbanism Stichwortregister 1. Allgemeines 2. Stadt-, Regional- und Landesplanung 3 3. Wohnungswesen, Bau- und Planungsrecht, Bauökonomie 4. Konstruktion, Technischer Ausbau, Design 5. Plätze, Parks, Landschaftsplanung 6. Industriebau, Forschung und Technologie 7. Ökologie, Energie, Umwelt 8. Wohnhäuser, Wohnheime, Wohnsiedlungen 4 9. Kindertagesstätten, Spielplätze, Sport- und Freizeitanlagen 10. Schulen, Fortbildungszentren 11. Universitäten, Akademien, Bibliotheken 12. Sakralbauten, Gedenkstätten 13. Hotels, Gaststätten, Touristikzentren 14. Theater, Kultur- und Kongresszentren, Rathäuser, Regierungsgebäude 5 15. Ausstellungsbauten, Museen 16. Krankenhäuser, Altenheime, Anstalten 17. Büro- und Verwaltungsgebäude, Geschäftshäuser 6 18. Verkehrsbauten, Verkehrsplanung, Stadttechnik 19. Modernisierung, Sanierung, Denkmalpflege 7 20. Architekturtheorie, Baugeschichte 21. Wettbewerbe, Gutachten, Auszeichnungen 22. Ausbildung, Berufs- und Standesfragen 23. -
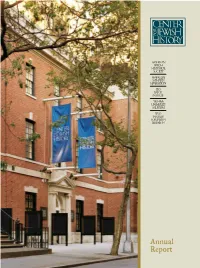
Annual Report
Annual Report CENTER FOR JEWISH HISTORY Table of Contents A Message from Bruce Slovin, Chairman of the Board 2 Our Mission 3 The Center Facility Education, Exhibition and Enlightenment 5 American Jewish Historical Society 10 American Sephardi Federation 12 Leo Baeck Institute 14 Yeshiva University Museum 16 YIVO Institute for Jewish Research 18 Center Affiliates 20 Exhibitions 21 Program Highlights 22 Philanthropic Giving at the Center for Jewish History 24 Benefactors 25 Center Volunteers and Docents 28 Financial Report Insert Governance Insert Michael Luppino 1 CENTER FOR JEWISH HISTORY From the Chairman August, 2005 he nurturing that every child experiences during the first five Boris and Bessie Thomashefsky. years of its life is vital in determining that child’s character and The Leo Baeck Institute’s commemorations of its 50th year Tfuture. These vital years, marked by amazingly rapid change was a particularly poignant reminder of the miracle of Jewish survival, and inspiring growth, chart the transition from infancy to responsibili- since none of its founders whose visionary goal was to ensure the sur- ty, and culminate in the child’s entry into formal schooling and social vival of the material documentation of the remnants of German Jewry interaction with his or her peers. in the period immediately following the years of Nazi terror, could have As I look back on the past five, formative years of the Center for imagined that this Institute would be thriving into the 21st century. Jewish History–the American Jewish community’s youngest and Yeshiva University Museum, in collaboration with Yeshiva’s already richest and most important institution for the study of our Cardozo Law School and Bernard Revel Graduate school, simultane- people’s history–I find myself experiencing emotions analogous to ously commemorated two other major milestones in Jewish spiritual the naches of a parent seeing his child off for the first day of school. -

Architekturforum Zürich
Architekturforum Zürich 2009 Brauerstrasse 16, 8004 Zürich, Schweiz Telefon 043 317 14 00, Fax 043 317 14 02, [email protected] Architekturforum Zürich Inhalt Bericht der Präsidentin 7 Ausstellungen und Begleitveranstaltungen 10 Reihen 22 Auswahl an Medienreaktionen 34 Besucherstatistik 42 Jahresrechnung 2009 44 Vereinsorgane, MitarbeiterInnen 46 Sponsoren, Patronate, Medienpartner 47 Mitgliederliste 49 Mitglied werden 60 Vereinsorgane seit 1987 62 Sponsorenportraits 64 Publikationen 74 Ausstellungen seit 1987 81 Veranstaltungen seit 1987 86 Vorträge, Führungen, Rundgänge seit 1987 103 Reihe «Junge Schweiz» seit 1994 112 Reihe «Alte Füchse» 1997–1998 115 Reihe «Neue Materialien» seit 2006 116 Reihe «Digitales Handwerk» seit 2008 117 Reihe «Dienstagsdebatten» seit 2008 118 Reihe «Energiesalon» seit 2009 119 Bericht der Präsidentin Dem Architekturforum Zürich geht es gut! Die Dynamik, die der Umzug in den Kreis 4 ausgelöst hat, hält auch im zweiten Jahr an, Zeugnis dafür liefert der vorliegende Jahresbericht. Einzige Wermutstropfen in der sonst positiven Bilanz sind im- mer noch die Umbaukosten – das Projekt für deren endgültige Finanzierung steht aber bereits kurz vor der Ausführung. Allmählich kehrt an der Brauerstrasse der Alltag ein, was für einmal durchwegs positiv gemeint ist: Die neuen Abläufe sind eingespielt und setzen zusätzlich Energien frei, die voll in die Gestaltung des Programms einfliessen können. Freuen Sie sich deshalb mit mir auf ein weiteres Jahr voller in- tensiver, anregender, ernsthafter und lustvoller Auseinander- setzungen und Begegnungen im Architekturforum Zürich! Lisa Ehrensperger Präsidentin des Vorstandes 7 af-z.ch/ausstellungen Ausstellungen und Begleitveranstaltungen 05.03.2009 – 11.04.2009 / Architektur Ulrich Müther. Schalenkonstruktionen Mit seinen faszinierend leichten Schalen hat der ostdeutsche Ingenieur Ulrich Müther (1934–2007) ein wichtiges Kapitel in der europäischen Geschichte des Schalenbaus geschrieben. -
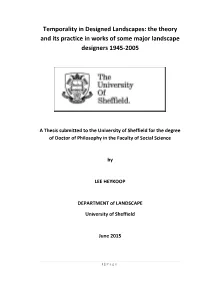
Temporality in Designed Landscapes: the Theory and Its Practice in Works of Some Major Landscape Designers 1945-2005
Temporality in Designed Landscapes: the theory and its practice in works of some major landscape designers 1945-2005 A Thesis submitted to the University of Sheffield for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Social Science by LEE HEYKOOP DEPARTMENT of LANDSCAPE University of Sheffield June 2015 i | P a g e ACKNOWLEDGEMENTS Most importantly I would like to thank my supervisor Anna Jorgensen who has guided, restrained and encouraged at appropriate times. Her reminders about not assuming that others see as I do enabled improved articulation of key ideas. I would also like to thank my second supervisor, Cathy Dee, for her rigorous critiquing, and her important contribution to the structure of this research. And, a huge thank you to my wonderful children, Judi, Laura and Laurence, who, in their teen years, in the early years of my research, tolerated the impact of my temporal squeeze, and who have been so supportive throughout all the happenings over subsequent years. Personal thanks aside, a number of writers in this thesis have fired my thinking, and to them I am extremely grateful: Arnold Berleant, Edmund Husserl, Mikhail Bakhtin, Michel Conan, Stephen Bann, Anita Berrizbeitia, Elizabeth Grosz, Elizabeth Meyer, Ian Thompson, and Marc Treib. ii | P a g e ABSTRACT This study analyses temporality in designed landscapes. The meaning of temporality is explored, taking us beyond common conceptualisations of time. Temporality, invariably poorly understood in a landscape context, and previously acknowledged as being important, but with only limited explicit discourse, is examined through the lens of a fresh theoretical articulation of temporality pertaining to designed landscapes. -

Download Download
Garden Thinking in Cities of Tomorrow Udo Weilacher Technical University of Munich Department of Architecture Munich, Germany Abstract Since the middle of the 19th century, when the term ‘landscape architecture’ began to replace the hitherto common term ‘garden art’, the garden as a work of art and gardening, understood as a predominantly decorative activity, stood in the critical discussion about the future of the metropolises. It was not only architects and urban planners who repeatedly questioned the value of ornamental gardens in the city. Against the background of the enormous growth of the cities in the industrial age and the accompanying social problems, leading European landscape architects in the 20th century like Leberecht Migge (1881-1935), Ernst Cramer (1898-1980), and Dieter Kienast (1945-1998) stated that gardening is neither artistic work nor scientific planning, neither modern nor progressive. Given the respective historical context as well as the particular conception of city and society, this criticism is comprehensible. In the 21st century though, the garden as a living component in the ‘network metropolis’, and gardening itself, especially ‘urban gardening’, were experiencing a remarkable renaissance. Against the background of today’s rapid development of the ‘Zwischenstadt’, it turns out that the basic principles of garden thinking never really lost their relevance. Keywords landscape architecture, urban gardening, modernism, functionalism, ecology, modern art DOI https://doi.org/10.7480/spool.2020.1.5484 113 SPOOL | ISSN 2215-0897 | E-ISSN 2215-0900 | VOLUME #7 | ISSUE #1 Introduction Frederick Law Olmsted was apparently the first professional in the mid-19th century to use the term ‘landscape architecture’ in connection with his work on Central Park in New York. -

Miraculously, It Worked the Improbable Beginnings of America’S First Post-Cold War Institution Abroad
[PROD_10: TSP_04-SONDERTHEMEN-SONDERTHEMEN <KM_SONDER_R1E> ... 01.10.14] Autor:R_BROCKSCHMIDT 02.10.14 10:41 AMERICAN ACADEMY Twenty Years of Cultivating Relationships across the Atlantic MITTWOCH, 1. OKTOBER 2014 / NR. 22 182 SEITE B1 Miraculously, It Worked The Improbable Beginnings of America’s First Post-Cold War Institution Abroad IT ALL STARTED in a back room of Holbrooke, who was about to depart for and doers of outstanding talent and re- the Berlin Kempinski, in 1994. The “cabal” Washington as the State Department’s Di- nown. And it would do so without a penny consisted of people like Henry Kissinger, rector of European Affairs, snagged the first of government largesse. When the German Otto Graf Lambsdorff, Fritz Stern, and Ri- few million for operating expenses and for Bundestag offered to chip in a million chard von Weizsäcker. And Richard Hol- the magnificent villa on the Wannsee. The marks, the board politely declined. This brooke, the American ambassador, without building and the park had belonged to the was going to be done the “American way” – whom the Academy would never have got- Arnhold family before they were driven out as a strictly private venture, in a country ten off the ground, in 1998. There is an Eng- by the Nazis. The new owner nicely symbo- where high culture has always been funded lish word, borrowed from German and Yid- lized Germany’s postwar rebirth as a liberal by the state, starting with the princes and dish, for types like him: Macher. and inclusive democracy. This was the potentates of pre-Reich Germany. -

Reconfiguring Absence: Daniel Libeskind's Jewish Museum In
Reconfiguring Absence: Daniel Libeskind’s Jewish Museum in Berlin and the Rhetorical Negotiation of Cultural Display by Brent Allen Saindon B.A., Fort Hays State University, 2004 M.S., University of North Texas, 2006 Submitted to the Graduate Faculty of the Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2015 UNIVERSITY OF PITTSBURGH Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences This dissertation was presented by Brent Allen Saindon It was defended on April 6, 2015 and approved by Randall Halle, Professor, German Languages and Literatures Brenton Malin, Associate Professor, Communication Terry Smith, Professor, History of Art and Architecture Ronald Zboray, Professor, Communication Dissertation Advisor: Lester Olson, Professor, Communication ii Copyright © by Brent Allen Saindon 2015 iii Reconfiguring Absence: Daniel Libeskind’s Jewish Museum Berlin and the Rhetorical Negotiation of Cultural Display Brent Allen Saindon, PhD University of Pittsburgh, 2015 This study traces the development of the Jewish Museum Berlin from its inception as the winning entry in a competition for an extension to the Berlin Museum in the summer of 1989 to 2005. Tracking Daniel Libeskind’s design inspirations, public arguments over continuation of the building and its eventual use, I argue that a consistent argumentative trope, characterized by Ernst Bloch’s concept of anticipatory illumination, shows up in these various conversations and influences the building’s eventual use as the Jewish Museum Berlin. The rhetoric of anticipatory illumination, in this case, shifts over time, first emphasizing Jewish cultural absence in Berlin and the need to make that absence visible, but later pushing cultural absence to the background in favor of expressing the need for multicultural tolerance in Germany and beyond. -

Biographie = Ernst Cramer : Biography
Ernst Cramer : Biographie = Ernst Cramer : biographie = Ernst Cramer : biography Autor(en): [s.n.] Objekttyp: Article Zeitschrift: Anthos : Zeitschrift für Landschaftsarchitektur = Une revue pour le paysage Band (Jahr): 26 (1987) Heft 2: Ernst Cramer, Landschaftsarchitekt, 1898-1980 = Ernst Cramer, architecte-paysagiste, 1898-1980 = Ernst Cramer, landscape architect, 1898-1980 PDF erstellt am: 28.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-136240 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte