Gemeinnützige Gesellschaft Von Neumünster 2006Chronik
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Statistical Portrait 2009
Statistical portrait Zurich is the capital city of the canton of the same name. It has approximately 380,500 inhabitants and is hence Switzerland’s largest city. People from 166 countries make up 31 per cent of the population, and the town welcomes more than one million visitors every year. Zurich thus offers multicultural diversity and a high-quality experience. Facts and figures ⊲ Resident population ⊲ Buildings and apartments Resident population (31 December 2008) 380,499 No. of buildings (31 December 2008) 54,072 of which foreign 31.0 % No. of apartments (31 December 2008) 206,728 Most-represented foreign nationality Germany of which apartments with 4 or more rooms 29.8 % Population growth 2003 – 2008 + 4.4 % Percentage of apartments owned by cooperatives and Persons living and working in Zurich (2000) 157,009 City of Zurich 28.0 % Metropolitan resident population (2007) 1,132,237 Percentage of freehold apartments 7.0 % No. of municipalities in the metropolitan area 130 Apartments built between 1998 and 2008 14,090 ⊲ Employment ⊲ Tourism Persons employed (4th quarter 2008) 355,300 Number of hotels 112 of which full-time 66.9 % No. of overnight stays (2008) 2.58 Mio. of which part-time 33.1 % of which foreign guests 79.9 % of which employed in 2nd sector No. of arrivals (2008) 1.38 Mio. 9.8 % (manufacturing & industry) Principal countries of origin 1. Germany, 2. USA, of which employed in 3rd sector (services) 90.2 % 3. Great Britain Women 157,800 Men 197,500 ⊲ Geography Unemployment rate (December 2008) 2.7 % Total area including -

Paper Details
1 2 3 4 5 A spatial Bayesian network model to assess the benefits of 6 early warning for urban flood risk to people 7 8 9 Stefano Balbia, Ferdinando Villaa,d, Vahid Mojtahedb, K. Tessa Hegetschweilerc, Carlo Giupponib 10 11 a BC3, Basque Centre for Climate Change 12 ([email protected], [email protected]) 13 b Ca’ Foscari University of Venice, Department of Economics and Venice Centre for Climate Studies 14 ([email protected], [email protected]) 15 c Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research – WSL 16 ([email protected]) 17 d IKERBASQUE, Basque Foundation for Science 18 19 20 21 22 23 24 25 Abstract 26 This article presents a novel methodology to assess flood risk to people by integrating people’s 27 vulnerability and ability to cushion hazards through coping and adapting. The proposed approach 28 extends traditional risk assessments beyond material damages; complements quantitative and semi- 29 quantitative data with subjective and local knowledge, improving the use of commonly available 30 information; produces estimates of model uncertainty by providing probability distributions for all of 31 its outputs. Flood risk to people is modelled using a spatially explicit Bayesian network model 32 calibrated on expert opinion. Risk is assessed in terms of: (1) likelihood of non-fatal physical injury; (2) 33 likelihood of post-traumatic stress disorder; (3) likelihood of death. The study area covers the lower 34 part of the Sihl valley (Switzerland) including the city of Zurich. The model is used to estimate the 35 benefits of improving an existing Early Warning System, taking into account the reliability, lead-time 36 and scope (i.e. -

Zweiter Zürcher Kreativwirtschaftsbericht Inhalt
Kunstmarkt Darstellende Kunst Phonotechnischer Markt Designwirtschaft Rundfunkmarkt Buchmarkt Pressemarkt Architektur Software -/ Games-Industrie Musikwirtschaft Filmwirtschaft Werbemarkt Kunsthandwerk Zweiter Zürcher Kreativwirtschaftsbericht Empirisches Portrait der Kreativwirtschaft Zürich Zahlen und Fakten zum Wirtschaftsjahr 2005 Research Unit Creative Industries (RUCI) der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) Michael Söndermann, Christoph Weckerle Geographie der Kreativwirtschaft Visualisierung und Interpretation der räumlichen Entwicklung der Zürcher Kreativwirtschaft INURA Zürich Institut, Philipp Klaus Statistisches Amt des Kantons Zürich, Dominic Bentz, Claudia Hofstetter t h c i r e b s t f a h c s t r i w v i t a e r K r e h c r ü Z Im Auftrag von: r e Wirtschaftsförderung der Stadt Zürich t i e Standortförderung des Kantons Zürich w Z Mai 2008 Vorwort der Auftraggeber Der erste Bericht zur Kreativwirtschaft Zürich aus dem Jahre 2005 hat Einiges in Bewegung gesetzt. Erstmals wurde die Kreativwirt - schaft Zürich empirisch und qualitativ beschrieben, ihr Potenzial und ihre Bedeutung für den Standort Zürich aufgezeigt und mögliche Handlungsfelder skizziert, diesen zukunftsweisenden Wirtschaftsbereich gegen innen zu stärken und gegen aussen im internationalen Umfeld prominenter zu positionieren. Die Ziele der ersten Studie, eine breitere Diskussion in Gang zu setzen und Entscheidträgerinnen und Entscheidträger auf unter - schiedlichen Ebenen zu sensibilisieren, konnten zu einem guten Teil erreicht werden. So setzte die Thematisierung der Kreativwirt - schaft als Handlungsfeld in den Strategien 2025 der Stadt Zürich einen wichtigen Impuls auf politischer Ebene. Nach dem positiven Befund des ersten Berichtes liegt nun der Zweite Zürcher Kreativwirtschaftsbericht vor. Die Wirtschaftsförderung der Stadt und die Standortförderung des Kantons Zürich haben zwei Studien in Auftrag gegeben, die den Branchenkomplex aus unterschiedlicher Optik beleuchten. -

Urban Audit: Initial Assess- Ment of the Swiss Pilot Phase
Nr.No.No 11 1 AoûtDezember August 2007 2007 2007 NEWS LETTER RäumlicheSpatialAnalyses analyses et Analysen disparités and disparitiesund spatiales Disparitäten Editorial The particular feature of this edition of StatSpace is that it is solely devoted to the European Urban Audit project in which Switzerland has been involved since 2006 as part of a pilot phase. This project has been implemented thanks to close co- operation between the FSO (Federal Statistical Office), ARE (Federal Office for Spatial Development) and the statistical of- fices and services in the cantons of Geneva and Vaud and in the cities of Zurich and Bern. The main purpose of this newsletter is to provide information about the Urban Audit project itself, as well as on the meas- ures taken by Switzerland as part of its involvement. It then presents, by way of illustration, a selection of indicators taken from the initial findings of the Swiss pilot phase, comparing Urban Audit: initial assess- Swiss cities in a European context. It concludes with a brief description of the future measures envisaged in Switzerland ment of the Swiss pilot phase as part of the Urban Audit project. This project, the importance of which is constantly growing Urban Audit in brief 1 within Europe, both from a statistical and regional policy per- spective, provides a major source of information for Switzer- Initial measures taken by Switzerland land, whether for the Confederation as a whole, its cantons with a view to regular participation 2 or cities. The work carried out by Switzerland since 2006 marks a first Sample results from the pilot phase 2 important step towards the country’s regular participation in the Urban Audit. -

Stadtzürcher Bevölkerung Wächst Auch in Zukunft Um Jährlich 5000 Bis 8000 Personen Ergebnisse Der Aktuellen Bevölkerungsszenarien
Stadt Zürich Statistik Napfgasse 6 Postfach 8022 Zürich Tel. 044 412 08 00 Fax 044 270 92 18 www.stadt-zuerich.ch/statistik Ihre Kontaktperson: Andreas Papritz Direktwahl 044 412 08 39 [email protected] Zürich, 9. Mai 2019 Medienmitteilung Stadtzürcher Bevölkerung wächst auch in Zukunft um jährlich 5000 bis 8000 Personen Ergebnisse der aktuellen Bevölkerungsszenarien Die Bevölkerung in der Stadt Zürich wird gemäss neuesten Berechnungen von Statistik Stadt Zürich auch in den nächsten Jahren wachsen. Bis 2035 wird eine Zunahme auf 505 000 Personen erwartet. Die Quartiere Escher Wyss und Altstetten sowie die Stadtkreise 11 und 12 wachsen am kräftigsten. Prozentual nimmt die Anzahl der Kinder und Jugendlichen sowie der Personen im Alter zwischen 40 und 69 Jahren stark zu. Die Stadtzürcher Wohnbevölkerung nimmt nach den Szenarien von Statistik Stadt Zürich bis 2035 um 76 000 Personen zu (2018: 428 737, 2035: 505 000 Einwohnerinnen und Einwohner). Die Bandbreite der Bevölkerungsszenarien für das Jahr 2035 reicht von 476 000 bis 533 000 Personen. Bis 2025 wird die Bevölkerung in der Stadt weiterhin jährlich um 5000 bis 8000 Personen wachsen, danach wird sich die Zunahme vermutlich auf 2000 bis 3000 Personen pro Jahr abschwächen. Der historische Höchststand von 440 180 Einwohnerinnen und Einwohnern aus dem Jahr 1962 wird voraussichtlich im Jahr 2021 übertroffen. Unterschiedliches Wachstum in den Quartieren In allen Quartieren wird bis 2035 mit einem Bevölkerungswachstum gerechnet. Besonders gross ist das prozentuale Wachstum in Saatlen, Hirzenbach, Escher Wyss (je + 38 %) und in Seebach (+ 36 %). Am stärksten wachsen in absoluten Zahlen Seebach (+ 9300 Personen), Altstetten (+ 6800 Personen), Affoltern (+ 5100 Personen) und Hirzenbach (+ 4900 Personen). -
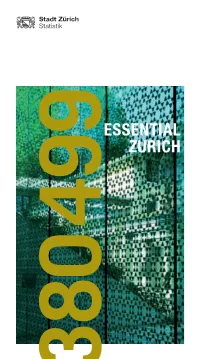
Essential Zurich
ESSENZÜRICHTIAL ZURICHIN ZAHLEN 380 499 380 Publication Data Published, edited and administered by Stadt Zürich, Präsidialdepartement, Statistik Stadt Zürich E-Mail [email protected] Internet www.stadt-zuerich.ch/statistik Ordering Statistik Stadt Zürich, Napfgasse 6, 8001 Zürich Phone 044 250 48 00 Fax 044 250 48 29 Translation Translingua AG Printed by Fotorotar AG Design Marc Droz / Regula Ehrliholzer Statistik Stadt Zürich Cover Photography Museum Rietberg, Photo: Regula Ehrliholzer Published annually in German and English Edition September 2009 © 2009 Statistik Stadt Zürich Reproduction – except for commercial purposes – permitted if sources are quoted Committed to Excellence according EFQM The publisher would like to thank the Zürcher Kantonalbank for its financial support. Its contribution makes the publication and distribution of this brochure possible. Contents Zurich in numbers 2 City of Zurich in comparison 4 Resident population 5 City area and climate 11 Education 12 Work and unemployment 13 Economic structure 15 Zurich as a financial centre 17 Prices and price indices 18 Construction and housing 20 Recreation 24 Tourism 26 Traffic 27 Politics 28 Social security and health 29 Public administration 30 Public finances 31 Crime 32 Glossary 33 Explanation of symbols A dash ( – ) instead of a number means there is no occurrence ( = zero). A zero (0 or 0,0) instead of another number identifies a variable that is less than one half of the unit used. Three dots ( … ) instead of a number mean that the number is unavailable or was omitted because it is insignificant. A forward slash ( / ) between year dates indicates the associated numbers as the annual average, a hyphen ( – ) as sums of the stated period. -

Quartierspiegel Hirslanden
KREIS 1 KREIS 2 KREIS 3 KREIS 4 KREIS 5 KREIS 6 KREIS 7 QUARTIERSPIEGEL 2015 KREIS 8 KREIS 9 KREIS 10 KREIS 11 KREIS 12 HIRSLANDEN IMPRESSUM IMPRESSUM Herausgeberin, Stadt Zürich Redaktion, Präsidialdepartement Administration Statistik Stadt Zürich Napfgasse 6, 8001 Zürich Telefon 044 412 08 00 Fax 044 270 92 18 Internet www.stadt-zuerich.ch/quartierspiegel E-Mail [email protected] Texte Nicola Behrens, Stadtarchiv Zürich Michael Böniger, Statistik Stadt Zürich Nadya Jenal, Statistik Stadt Zürich Judith Riegelnig, Statistik Stadt Zürich Rolf Schenker, Statistik Stadt Zürich Kartografie Reto Wick, Statistik Stadt Zürich Fotografie Titelbild, Bild S. 7 unten, Bild S. 22, Bild S. 23, Bilder S. 29: Micha L. Rieser, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0 unportiert Bild S. 7 oben: Adrian Michael, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0 unportiert Lektorat/Korrektorat Thomas Schlachter Druck FO-Fotorotar, Egg Lizenz Sämtliche Inhalte dieses Quartierspiegels dürfen verändert und in jeglichem For- mat oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter Einhaltung der folgenden vier Bedingungen: Angabe der Urheberin (Statistik Stadt Zürich), An- gabe des Namens des Quartierspiegels, Angabe des Ausgabejahrs und der Lizenz (CC-BY-SA-3.0 unportiert oder CC-BY-SA-4.0 international) im Quellennachweis, als Fussnote oder in der Versionsgeschichte (bei Wikis). Bei Bildern gelten abwei- chende Urheberschaften und Lizenzen (siehe oben). Der genaue Wortlaut der Li- zenzen ist den beiden Links zu entnehmen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de In der Publikationsreihe «Quartierspiegel» stehen Zürichs Stadtquartiere im Mittelpunkt. Jede Ausgabe porträtiert ein einzelnes Quartier und bietet stati s- tische Information aus dem umfangreichen Angebot an kleinräumigen Daten von Statistik Stadt Zürich. -

The Kulturisk Regional Risk Assessment Methodology for Water-Related Natural Hazards – Partapplication 2: to the Zurich Case Study P
Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 11, 7875–7933, 2014 www.hydrol-earth-syst-sci-discuss.net/11/7875/2014/ doi:10.5194/hessd-11-7875-2014 © Author(s) 2014. CC Attribution 3.0 License. This discussion paper is/has been under review for the journal Hydrology and Earth System Sciences (HESS). Please refer to the corresponding final paper in HESS if available. The KULTURisk Regional Risk Assessment methodology for water-related natural hazards – Part 2: Application to the Zurich case study P. Ronco1,2, M. Bullo1, S. Torresan2, A. Critto1,2, R. Olschewski3, M. Zappa4, and A. Marcomini1,2 1Dept. Environmental Sciences, Informatics and Statistics University Ca’Foscari Venice, Venice, Italy 2Centro Euro-Mediterraneo su i Cambiamenti Climatici (CMCC), Impacts on Soil and Coast Division, Lecce, Italy 3Swiss Federal Research Institute WSL, Economics and Social Sciences, Birmensdorf, Switzerland 4Swiss Federal Research Institute WSL, Mountain Hydrology and Mass Movements, Birmensdorf, Switzerland 7875 Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Received: 9 June 2014 – Accepted: 11 June 2014 – Published: 11 July 2014 Correspondence to: A. Marcomini ([email protected]) Published by Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union. 7876 Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Abstract The main objective of the paper is the application of the KULTURisk Regional Risk Assessment (KR-RRA) methodology, presented in the companion paper (Part 1, Ronco et al., 2014), to the Sihl River valley, in Switzerland. Through a tuning process of the 5 methodology to the site-specific context and features, flood related risks have been assessed for different receptors lying on the Sihl River valley including the city of Zurich, which represents a typical case of river flooding in urban area. -

Segregation Und Umzüge in Der Stadt Und Agglomeration Zürich
SEGREGATION UND UMZÜGE IN DER STADT UND AGGLOMERATION ZÜRICH Autoren: Corinna Heye und Heiri Leuthold IMPRESSUM Projektleitung, Auswertung und Bericht Corinna Heye und Heiri Leuthold, Gruppe sotomo, Geographisches Institut Universität Zürich Wissenschaftliche Mitarbeit Markus Baumann Kartografie Nils Krüger Lektorat/Korrektorat Josef Troxler und Martin Annaheim, Statistik Stadt Zürich Layout und Druck Statistik Stadt Zürich Umschlag Regula Ehrliholzer, Statistik Stadt Zürich Herausgeber Fachstelle für interkulturelle Fragen (FiF) Fachstelle für Stadtentwicklung (FSTE) Soziale Dienste Zürich (SOD) Statistik Stadt Zürich (STAT) Statistisches Amt des Kantons Zürich Wirtschaft/Standortmarketing (STOM) Koordination Statistik Stadt Zürich Bezugsquellen Statistik Stadt Zürich Statistisches Amt des Kantons Zürich Napfgasse 6, 8001 Zürich Bleicherweg 5, 8090 Zürich Telefon 01 250 48 00 Telefon 01 225 12 00 Telefax 01 250 48 29 Telefax 01 225 12 99 E-Mail [email protected] E-Mail [email protected] Preis Fr. 40.– 2 Segregation und Umzüge in der Stadt und Agglomeration Zürich Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................. 5 2. Beschreibung der Segregation .......................................................................... 7 2.1. Methodik............................................................................................................... 7 Segregations- und Dissimilaritätsindex ................................................................ -

"Es Ist Überall Erdbebenzeit" Gustav Ammann (1885-1955) Und Die Landschaften Der Moderne in Der Schweiz
Diss. ETH No. "Es ist überall Erdbebenzeit" Gustav Ammann (1885-1955) und die Landschaften der Moderne in der Schweiz Abhandlung zur Erlangung des Titels Doktor der technischen Wissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich vorgelegt von: Johannes Stoffler Dipl.-Ing., Universität Hannover geboren am 8. August 1971 in Freiburg im Breisgau / Deutschland Staatsangehörigkeit: Deutsch Angenommen auf Antrag von: Prof. Christophe Girot, Referent Prof. Dr. Udo Weilacher, Korreferent 2006 i Gustav Ammann und die Landschaften der Moderne in der Schweiz ii Für Gabrielle, Marie und Valentin iii Gustav Ammann und die Landschaften der Moderne in der Schweiz iv Zusammenfassung . ix Summary . xi 1. Einleitung .......................................................................................................1 2. Lehr- und Wanderjahre.................................................................................5 Die Anfänge 5 Ammanns Kindheit und Jugend in Zürich Neue Horizonte Das Büro Hoemann in Düsseldorf 8 Reinhold Hoemann und der Streit um den architektonischen Garten Die Gartenbauausstellung Mannheim 1907 Ausbildungsfragen Kunstschule Magdeburg 13 Ammann und die deutsche Kunstgewerbereform Kunstgewerbe- und Handwerkerschule Magdeburg Vorbild Friedrich Bauer und der wohnliche Hausgarten “Kulturprobleme” und Garten Düsseldorf, London und Berlin im Eiltempo 20 Die Firma Paetz und der Stadtpark in Steele Englische Impressionen Ludwig Lesser und die Villenkolonie Saarow-Pieskow Das Büro Ochs in Hamburg 26 Vorbild Leberecht Migge -

Ausländische Personen in Der Stadt Zürich
14 / 2006 AUSLÄNDISCHE PERSONEN IN DER STADT ZÜRICH Mensch und Gesellschaft Entwicklung und Verteilung Raum und Umwelt Wirtschaft und Arbeit Mustererkennung mit Hilfe von Rasterdaten AUSLÄNDISCHE PERSONEN IN DER STADT ZÜR ICH INHALT Zusammenfassung 3 1 EINLEITUNG 4 2 ENTWICKLUNG DER AUSLÄNDISCHEN WOHNBEVÖLKERUNG 4 2 . 1 Migration 4 2 . 2 Einreisejahr 7 2 . 3 Entwicklung in den letzten 10 Jahren 10 2 . 4 Räumliche Mobilität 12 2 . 5 Aufenthaltskategorien 14 3 VERTEILUNG DER AUSLÄNDISCHEN WOHNBEVÖLKERUNG 17 3 .1 Rasterdaten 17 3 .2 Räumliche Verteilung ausgewählter Nationen 18 3 .3 Kleinräumige Entwicklung des Ausländeranteils 34 3.4 Ausländische Personen und Bevölkerungsdichte 35 3.5 Berufe 38 3 .6 Wie ähnlich sind die hier lebenden ausländischen Personen den Schweizerinnen und Schweizern? 41 Herausgeber, Redaktion und Administration 4 aNHANG 42 Stadt Zürich Präsidialdepartement 4.1 Verzeichnis der Tabellen, Grafiken und Karten 42 Statistik Stadt Zürich Autor Mauro Baster Bezugsquelle Statistik Stadt Zürich Napfgasse 6, 8001 Zürich Telefon 044 250 48 00 Telefax 044 250 48 29 E-Mail [email protected] Internet www.stadt-zuerich.ch/statistik Auskunft Mauro Baster Telefon 044 250 48 90 Preis Einzelausgabe Fr. 10.– Artikel-Nr. 101 301 Jahresabonnement Fr. 45.– Artikel-Nr. 101 300 Reihe Analysen Copyright Statistik Stadt Zürich, Zürich 2006 Zeichenerklärung Abdruck – ausser für kom- Ein Strich ( – ) anstelle einer Zahl bedeutet, dass nichts vorkommt ( = Null ). merzielle Nutzung – unter Eine Null (0 oder 0,0) anstelle einer anderen Zahl bezeichnet eine Grösse, die kleiner ist Quellenangabe gestattet als die Hälfte der kleinsten verwendeten Einheit. 19.7.2006/bam Drei Punkte ( ... ) anstelle einer Zahl bedeuten, dass diese nicht erhältlich ist oder dass sie weggelassen wurde, weil sie keine Aussagekraft hat. -

Abschlussarbeit Mietpreise Im Verhältnis Zu Den Einkommen
Abschlussarbeit zur Erlangung des Master of Advanced Studies in Real Estate Mietpreise im Verhältnis zu den Einkommen Wo die Mieten in der Stadt Zürich relativ teuer sind Verfasser: Schüz Stephen Eingereicht bei: Dr. Fabian Wildenauer Abgabedatum: 28.08.2017 II Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung .................................................................................................. 1 2 Theoretische Grundlagen .......................................................................... 3 Mieten und Immobilienmärkte .................................................................. 3 Hinweise zur Einkommensbildung ......................................................... 11 3 Kontext, Methodik und Datenbeschreibung ............................................ 11 Volkswirtschaft und Bevölkerung der Stadt Zürich ................................ 11 Quartiere und Statistische Zonen ............................................................ 12 Methodik der Datenanalyse der Immobilienwirtschaft im Raum Zürich 14 Gebäude und Wohnungen ....................................................................... 15 Mieten ...................................................................................................... 17 Einkommen ............................................................................................. 19 4 Auswertung und Analyse ........................................................................ 22 Medianmieten und Medianeinkommen ................................................... 22 Rental Cost Ration - RCR ......................................................................