Sachsen Und Anhalt Lld
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Amtsblatt Nr
Amtsblatt Nr. 08/15 | Jahrgang 6 der Stadt Blankenburg (Harz), 29. August 2015 Ministerpräsident zu Besuch im Großen Schloss Lob für „außerordentliches Engagement“ der Schlossretter nutzt wird, ein, um Gedanken für künftige Nutzungsmöglichkeiten des Schlosses an- zusprechen, die Arbeit der engagierten Bürgerinnen und Bürger zu würdigen und eine weitere Zusammenarbeit und Unter- stützung zuzusagen. Stiftungspräsident Hoffmann sagte eine weitere finanzielle Beteiligung bei der Ent- wicklung zu: „Mit der Sanierung und Res- taurierung des Großen Schlosses Blanken- burg fördert die SBK ein für das Braun- schweiger Land und für den Zusammen- halt von Ost- und Westharz bedeutendes Projekt mit großer Symbolkraft. Die SBK wird ihre Förderung in den nächsten Jah- ren noch verstärken.“ Ministerpräsident Haseloff zeigte sich be- eindruckt, was seit 2005 durch den Verein umgesetzt wurde. „Denkmalschutz ist ein kultureller Auftrag. Unser Umgang mit dem gebauten Erbe verrät viel über unser kultu- relles Selbstverständnis. Traditionsbewah- rung und Zukunftsgestaltung sind keine Widersprüche. Sie ergänzen sich vielmehr“, betonte Haseloff. „Die Initiative zur Rettung des Schlosses kam aus der Mitte unserer André Gast, Geschäftsführer der Großes Schloss GmbH überreicht Ministerpräsident Gesellschaft. Sie zeigt, wie wichtig bürger- Haseloff eine mit einer Lasergravur des Schlosses gestaltete Schiefertafel schaftliches Engagement ist.“ In das „Goldene Buch“, welches künftig von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Rei- Buch „Sachsen-Anhalt. 1200 Jahre Ge- Ehrengästen des Schlosses gefüllt werden ner Haseloff traf sich zu einem Gedanken- schichte – Renaissance eines Kulturrau- soll, trug sich der Ministerpräsident als Ers- austausch mit Vertretern der Stiftung mes“ an Reiner Haseloff überreichte, gelei- ter ein: „Dem Verein „Rettung Schloss Blan- Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK) um teten die Schlossführerinnen Reinhilde kenburg“ herzlichen Dank für das außeror- deren Präsident Dr. -

Harzkult Harzliteratur
Literaturauswahlliste zum Harz und Harzvorland (Schwerpunkt Archäologie, Kultstätten, Sagen) Die Anführung von Literatur in dieser Liste erfolgt zur Dokumentation und bedeutet nicht unbedingt, daß die Betreiber von harzkult.de mit dem jeweiligen Inhalt übereinstimmen. Zusammenstellung: Harzsammler, 2. erweiterte und korrigierte Fassung, Juni 2007 Abel, Caspar Saechsische Alterthuemer, 1730 Ackenheil, H.V. Gottheiten und Kultstätten in und um Oldenburg in Wagrien, 1983 (Harzburg u.a.) Allmann, Rudolf Ein germanisches Stammesheiligtum im Südharz?, in: Mitteldeutsche Volkheit, 5, 1938 Der Heiligenborn bei Morungen im Südharz - eine alte Heilquelle, in: Mitteldeutsche Volkheit, 8, 1941 Al-Malazi, Heide Der verschwundene Steinkreis, in: Dennis Krüger (Hg.): Trojaburg Nr. 2, 2005 (Eselstall) Anders, Detlef Christliche Kirche auf heidnischer Kultstätte, MZ, 12.9.1998 (Neinstedt) Ein Stonehenge bei Quedlinburg?, MZ, 9.11.2002 (Eselstall) Anding, Edwin Ein Menhir auf dem Staufenbüttel bei Steina, in: Allgemeiner Harz-Berg-Kalender, 1975 Andree, Richard Braunschweiger Volkskunde, 2. verm. Aufl. 1901 Appuhn, Horst Beiträge zur Geschichte des Herrschersitzes im Mittelalter, T. 2. Der sogenannte Krodo-Altar und der Kaiserstuhl in Goslar, in: Aachener Kunstblätter, Bd. 54/55, 1986/87 Arfert Die Ortsnamen des Kreises Halberstadt, 1917 Asche, Theodor Sagen von Goslar, o.J. Geschichts-Kulturbilder und Sagen aus Goslars Vergangenheit, 1901 Augustin, Christian Abbildungen von mittelalterlichen und vorchristlichen Alterthuemern in den Gauen Friedrich Bernhard; des vormaligen Bisthums Halberstadt, 1872 Friederich, Adolph Augustin, Wilfried Lokaltermin: Die Teufelsmauer bei Weddersleben, in: Synesis-Magazin, Nr. 68, 2005 B. Der Klusfelsen am Petersberge bei Goslar, in: Goslarer Woche, H.11, 1955 Bartens, Werner Der Harz, Reihe: Die Schwarzen Führer, 1997 Bauerfeind, Hans Sagen und Erzählungen vom Regenstein, Hg. -
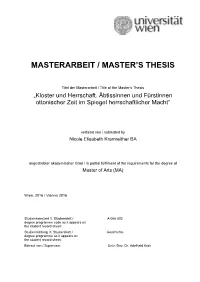
Masterarbeit / Master's Thesis
MASTERARBEIT / MASTER’S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master‘s Thesis „Kloster und Herrschaft. Äbtissinnen und Fürstinnen ottonischer Zeit im Spiegel herrschaftlicher Macht“ verfasst von / submitted by Nicole Elisabeth Kramreither BA angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2016 / Vienna 2016 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 066 803 degree programme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Geschichte degree programme as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Univ.-Doz. Dr. Adelheid Krah Danksagung An dieser Stelle möchte ich meine Dankbarkeit an all jene richten, die mich im Rahmen meines Masterstudiums und auch der Masterarbeit begleitet haben. Ein besonderes Dankeschön gilt meiner Betreuerin, Fr. Univ.-Doz. Dr. Adelheid Krah, die durch ihre Lehrveranstaltungen meine Begeisterung für die mittelalterliche Geschichte geweckt hat und mir in allen Bereichen des Studiums stets eine verständnisvolle und inspirierende Ansprechpartnerin war. Ein besonderer Dank gilt meiner Familie, insbesondere meinem Mann Christian und meiner Tochter Victoria, die mir die Zeit ermöglicht haben, meine Studien zu vollenden. Abschließend möchte ich mich noch bei meiner Chefin, Univ.- Prof. Dr. Andrea Laslop bedanken, die mich stets ermuntert hat, meinen akademischen Weg weiter zu beschreiten. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ...................................................................................................................................................... -

Die Herrschaftsausweitung Der Grafen Von Wernigerode Am Nordharz (1249 - 1369)
JAN HABERMANN DIE HERRSCHAFTSAUSWEITUNG DER GRAFEN VON WERNIGERODE AM NORDHARZ (1249 - 1369) Älteres Siegel des Grafen Friedrich (II) von Wernigerode (1328). Der politisch hervortretende Potentat im Harzburger Herrschaftsraum. INHALTSVERZEICHNIS Einleitung ................................................................................................................. 2 I Die territoriale Ausgangslage der gräflichen Machtstellung 1.1 Vorbemerkung zum Forschungsstand .............................................................. 5 1.2 Zur Entstehung der Burg Wernigerode ........................................................... 7 1.3 Grundriss des gräflichen Herrschaftsraums am Nordharz ............................... 10 II Territorialisierung und Herrschaftsfestigung der Wernigeröder Grafen im 13. Jahrhundert 2.1 Der Erwerb des Allodialguts Wohldsberg (1249) ............................................. 11 2.2 Die politische Entwicklung unter Herzog Albrecht dem Großen 2.2.1 Haltung und Machtstellung der Grafen von Wernigerode während der Asseburger Fehde ................................................................ 13 2.2.2 Die Lehnsauftragung an die Markgrafen von Brandenburg als territorialpolitische Erhaltungsstrategie ............................................. 15 III Die Durchsetzung der gräflichen Landesherrschaftsbildung gegen lokale und reichsfürstliche Potentaten (1269 - 1343) 3.1 Die Bedeutung der Harzburg für die Herrschaft der Grafen von Wernigerode 3.3.1 Der Erwerb der Harzburg (1269) ......................................................... -

De Kwartierstaat Van Theodorus Janssen
een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Theodorus Janssen door Janssen 5 augustus 2021 De kwartierstaat van Theodorus Janssen Janssen De kwartierstaat van Theodorus Janssen Generatie 1 1. Theodorus Janssen, zoon van Michiel Janssen (volg 2) en Anna Maria Cornelia Groothuizen (volg 3), is geboren op 22 februari 1901 in ’s-Hertogenbosch, North Brabant, Netherlands. Theodorus is overleden op 43 jarige leeftijd op 14 januari 1945 in Oosterhout, North Brabant, Netherlands. Generatie 2 2. Michiel Janssen, zoon van Willem Janssen (volg 4) en Anna Maria Wattenberg (volg 5), is geboren op 21 september 1860 in Druten, Gelderland, Nederland. Michiel is overleden op 78 jarige leeftijd op 14 juli 1939 in Dordrecht, South Holland, Netherlands. 3. Anna Maria Cornelia Groothuizen, dochter van Christiaan Groothuizen (volg 6) en Cornelia van Kessel (volg 7), is geboren op 10 september 1862 in Nijmegen, Gelderland, Netherlands en is gedoopt op 11 september 1862 in Nijmegen, Gelderland, Netherlands. Anna Maria Cornelia is overleden op 55 jarige leeftijd op 28 oktober 1917 in Oosterhout, North Brabant, Netherlands. Generatie 3 4. Willem Janssen, zoon van Migchiel Janssen (volg 8) en Christina van den Boogaardt (volg 9), is geboren op 8 april 1829 in Druten, Gelderland, Netherlands. Willem is overleden op 73 jarige leeftijd op 2 juli 1902 in Druten, Gelderland, Netherlands. 5. Anna Maria Wattenberg, dochter van Gerardus Wartenberg (volg 10) en Anna Maria Kroonen (volg 11), is geboren op 8 mei 1825 in Winssen, Gelderland, Netherlands. Anna Maria is overleden op 51 jarige leeftijd op 5 februari 1877 in Ewijk, Gelderland, Netherlands. 6. Christiaan Groothuizen, zoon van Derk Groothuizen (volg 12) en Johanna van den Broek (volg 13), is geboren op 9 oktober 1839 in Nijmegen, Gelderland, Netherlands en is gedoopt in Nijmegen, Gelderland, Netherlands. -

Die Quedlinburger Äbtissinnen Im Hochmittelalter. Das Stift Quedlinburg in Zeiten Der Krise Und Des Wandels Bis 1137. Dissertat
Die Quedlinburger Äbtissinnen im Hochmittelalter. Das Stift Quedlinburg in Zeiten der Krise und des Wandels bis 1137. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. genehmigt durch die Fakultät für Humanwissenschaften der Otto-von -Guericke-Universität Magdeburg von M.A. Christian Marlow geb. am 3. Juli 1985 in Quedlinburg Gutachter: Prof. Dr. Stephan Freund Gutachter: Prof. Dr. Matthias Puhle Verteidigung der Dissertation am: 13. November 2017 Die Quedlinburger Äbtissinnen im Hochmittelalter Das Stift Quedlinburg in Zeiten des Wandels und der Krisen bis 1137 Inhaltsverzeichnis I Krisen und Konflikte – Die Entwicklung Quedlinburgs bis in das erste Drittel des 12. Jahrhunderts hinein...................................................................................……..…………………1 1 Einleitung……………………………………………………………………..……………………1 1.1 Stand der Forschung /Literaturlage……………………………………………………………..4 1.2 Quellenlage……………………………………………………………………………………...8 1.3 Methodik...……………………………………………………………………………………..10 2 Quedlinburgs Aufstieg zum wichtigen Ort der Ottonen ………………………………………….16 2.1 Der Tod Heinrichs I. und die Gründung des Quedlinburger St. Servatius Stifts…......…………19 2.2 Königin Mathilde als Förderin des Quedlinburger Stifts........................…..................….......…25 2.3 Zusammenfassung………………………………………………………………………………33 3 Äbtissin Mathilde von Quedlinburg ………………………………………………………………36 3.1 Herkunft und Äbtissinnen-Weihe……………………………………………………………….36 3.2 Augusta und „funkelnder Edelstein“ – Die Frühzeit der Äbtissin in den diplomatischen -
Die Domkapitel Zu Goslar Und Halberstadt in Ihrer Persönlichen Zusammensetzung Im Mittelalter
VERÖFFENTLICHUNGEN DES MAX-PLANCK-INSTITUTS FÜR GESCHICHTE 5 Studien zur Germania Sacra 1 RUDOLF MEIER Die Domkapitel zu Goslar und Halberstadt in ihrer persönlichen Zusammensetzung im Mittelalter mit Beiträgen über die Standesverhältnisse der bis zum Jahre 1200 nachweisbaren Hildesheimer Domherren VA NDENHOECK & RUPRECHT IN GÖTTINGEN Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 5 VERÖFFENTLICHUNGEN DES MAX-PLANCK-INSTITUTS FÜR GESCHICHTE 5 Studien zur Germania Sacra 1 © Vandenhocck & Ruptecht, Göttingen 1967 - Printed in Germany Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus auf foto- oder akustomechanischcm Wege zu vervielfältigen. - Gesamthef'stellung: Heenemann KG., Berlin 8173 VORWORT Im Mittelpunkt der hier vorgelegten Untersuchungen steht das Ver hältnis von Kirche und Ständewesen in Ostfalen und Ostsachsen. Die Arbeit ist im Februar 1957 von der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen als Dissertation angenommen worden, doch schien es dem Verfasser, der in den Jahren 1957 bis 1962 als Assistent der Abteilung Germania Sacra des Max-Planck-Instituts für Geschichte mit der Bearbei tung der geistlichen Institutionen Goslars beschäftigt war, zweckmäßig, die Arbeit erst dann zu veröffentlichen, nachdem für die Germania Sacra die das Mittelalter betreffende archivalische Überlieferung der Stadt Goslar und der im Bereiche des heutigen Stadtkreises Goslar gelegenen geistlichen Institute aufgearbeitet worden war. Ferner enthält das im September 1962 abgeschlossene Manuskript gegenüber der Dissertation noch einige Er gänzungen auf Grund der nach 1957 erschienenen Veröffentlichungen. Zunächst war vom Verfasser beabskhtigt, in der Dissertation Stand und Herkunft der gesamten mittelalterlichen Goslarer Geistlichkeit zu unter suchen, wie es für den Klerus einer ganzen Stadt bisher nur in der Arbeit von Kothe über Straßburg geschehen ist. -

Na Turschutz
41. Jahrgang 2004 Sonderheft IM LAND ISSN 1436-8757 SACHSEN-ANHALT Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. Sonderheft 2004 Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der auna-lora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der Die Tier- auna-lora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt NATURSCHUTZ Männchen der Grünen Mosaikjungfer (oto: J. Ruddek) Haselmaus (oto: W. Wendt) Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 41. Jahrgang 2004 Sonderheft ISSN 1436-8757 Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der auna-lora-Habitat-Richtlinie im Land Sachsen-Anhalt Seite 1 Vorwort 3 2 Einleitung 4 3 Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der H-Richtlinie 6 3.1 Allgemeine Bemerkungen 6 3.2 Wirbellose 9 3.2.1 Schmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) 9 3.2.2 Libellen (Insecta, Odonata) 23 3.3 Wirbeltiere 31 3.3.1 Lurche (Amphibia) 31 3.3.2 Kriechtiere (Reptilia) 57 3.3.3 Säugetiere (Mammalia) 62 3.4 Blütenpflanzen (Spermatophyta) 108 4 Übersicht 111 5 Monitoring zur Ermittlung der Bestände und Einschätzung der Bestandsentwicklung im Rahmen der Berichtspflichten an die Europäische Union 115 6 Ausblick 133 7 Literatur 134 1 Wasserfledermaus im Winterquartier ($oto: W. Wendt) 2 1 Vorwort Udo Kamm Die Europäische Union erließ im Jahr 1992 die schen und floristischen Arbeit scheint in Zukunft auna-lora-Habitat-(H)Richtlinie, um einen unbedingt notwendig. besseren, grenzübergreifenden Schutz gefähr- Ein wirksamer Habitatschutz bzw. nachhalti- deter Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten als ge artenschutzgerechte Nutzungsformen in Bestandteil des europäischen Naturerbes zu einer Kulturlandschaft sind die entscheiden- gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, den Voraussetzungen für einen guten Erhal- wurde das europaweite Netz von Besonderen tungszustand von auna und lora. -

Verbreitung, Häufigkeit Und Ortstreue Der Fledermäuse in Den
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum Jahr/Year: 1968 Band/Volume: 3_1968 Autor(en)/Author(s): Handtke Kuno Artikel/Article: Verbreitung, Häufigkeit und Ortstreue der Fledermäuse in den Winterquartieren des Harzes und seines nördlichen Vorlandes 124-191 Naturkundliche Jahresberichte III 1968 124-191 Museum Heineanum Verbreitung, Häufigkeit und Ortstreue der Fledermäuse in den Winterquartieren des Harzes und seines nördlichen Vorlandes Kuno Handtke, Halberstadt (mit Tabellen, 2 Figuren, 7 Karten im Text und 4 Abbildungen im Anhang) 1. Einleitung 2. Das Untersuchungsgebiet 3. Die Fledermauswinterquartiere im Harz 3.1. Felsstollen und -höhlen 3.1.1. Das Revier Wernigerode-Hasserode 3.1.2. Der Eisenerzbezirk Königshütte-Elbingerode-Hüttenrode 3.1.3. Das T reseburger Revier 3.1.4. Das Revier Neudorf-Harzgerode 3.2. Keller als Winterquartiere im Harz 4. Die Fledermauswinterquartiere im Harzvorland 4.1. Felshöhlen und -Stollen 4.1.1. Fundplätze in den Klus- und Spiegelsbergen bei Halberstadt 4.1.2. Fundplätze in den Thekenbergen südlich Halberstadt 4.1.3. Fundplätze im Neokomsandstein des Quedlinburger Sattels zwischen Langenstein und Quedlinburg 4.1.4. Fundplätze im Heidelberg-Quadersandstein des Regensteinzuges 4.1.5. Fundplätze in der Harzrandaufrichtungszone 4.1.6. Fundplätze im Plänerkalk des Harzvorlandes 4.1.7. Fundplätze im Buntsandstein des Vorlandes 4.2. Keller als Fledermauswinterquartiere im Harzvorland 4.3. Fundplätze in Gebäuden des Harzvorlandes 4.4. Geröllhaufen als Winterquartiere 5. Die Verbreitung der Fledermausarten in den Winterquartieren, ihre Ansprüche, Ortstreue und ihr Verhalten 5.1. Allgemeines 5.2. Zur Verbreitung der gefundenen Arten 5.2.1. -

Harz) • Börnecke • Cattenstedt • Stadt Derenburg • Heimburg • Hüttenrode • Timmenrode • Wienrode
Amtsblatt Nr. 05/21 | Jahrgang 12 29. Mai 2021 Blankenburg (Harz) • Börnecke • Cattenstedt • Stadt Derenburg • Heimburg • Hüttenrode • Timmenrode • Wienrode Für alle kleinen und großen Blankenburger Neuer Spiel- und Fitnessbereich im Stadtpark ist fertig gestellt Der 30. April 2021 war ein wichtiger Tag für die Stadt Blankenburg (Harz), und wie Bürgermeister Heiko Breithaupt ergänzte „ganz besonders für die Kinder der Stadt“. Das bestätigte auch der Stadt- ratsvorsitzende Klaus Dumeier, der von „einer der besten Entscheidungen des Stadtrates der letzten Jahre“ sprach. Das sahen auch die Jungen und Mädchen der Evangelischen Kindertagesstätte Blankenburg so. Denn nach rund neun- monatiger Bauzeit wurde der komplett neu gestaltete Spielplatz im Stadtpark für die Öffentlichkeit frei gegeben und die Kleinen durften als erstes spielen, toben, klettern rutschen und alles aus- probieren. Nachdem der Bürgermeister zusammen mit dem sechsjährigen Niklas den sym- bolischen Scherenschnitt vollzogen hat- te, gab es für die Kinder kein Halten mehr. Auch der leichte Nieselregen störte nicht dabei, die vielen neuen Spiel- und Sport- möglichkeiten zu entdecken und auszu- Birgit Walsch, Bürgermeister Heiko Breithaupt und der sechsjährige Niklas eröffneten probieren. Während die ganz Kleinen ih- den Spielplatz mit einem symbolischen Scherenschnitt. ren Spaß hatten mussten die Großen noch letzte Arbeiten erledigen. So wurde ten. Auf Sportbegeisterte und Aktive war- hes Bild. Mit ganz viel Liebe zum Detail ist im Sportbereich ein zweites Fußballtor ten Tischtennisplatten, ein Sportfeld für hier ein schöner und moderner Spiel- und ein Basketballkorb montiert. Zuvor verschiedene Sportarten und eine Calis- platz entstanden, der in der Region sei- waren bereits die Bauzäune entfernt wor- thenics-Anlage. nesgleichen sucht. den, damit endlich alle kleinen und gro- ßen Blankenburger das riesige Spiel-, Zahlreiche Sitzmöglichkeiten sorgen da- Zu verdanken ist dies insbesondere Bir- Spaß- und Sportareal entdecken können. -

Vorkommen Der Fledermausarten in Sachsen-Anhalt Mausohr
Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt e.V. (11.2009): Fledermäuse Sachsen-Anhalt 1 Vorkommen der Fledermausarten in Sachsen-Anhalt (Stand: November 2009) Mausohr - Myotis myotis In den wärme getönten Regionen des Saale-Unstrut-Triaslandes befand sich bis in die Mitte der 1990er Jahre der Reproduktionsschwerpunkt der Art. Die höchste Siedlungsdichte in Sachsen-Anhalt wurde hier erreicht. Die Mehrzahl der langjährig bekannten Wochenstuben unterlag seither durch bauliche Veränderungen einer negativen Entwicklung. So wurden kopfstarke Gesellschaften in Freyburg, Thalwinkel, Kleinjena, Schulpforte, Burg Saaleck und Nebra aufgegeben und sind seither verschollen (vgl. LEHMANN 2008, OHLENDORF 2006). Von den zehn langjährig bekannten Reproduktionsquartieren wurden im Jahr 2006 nur noch drei besetzt angetroffen. Demgegenüber steht lediglich der Neunachweis einer kleinen Wochenstube am Wendelstein und in Thalwinkel. Der Fortpflanzungsschwerpunkt in Sachsen-Anhalt hat sich innerhalb nur weniger Jahre in den Bereich des südlichen, östlichen und nördlichen Harzrandes und in westlichen und nordwestlichen Randbereich der Dübener Heide verschoben. Dem Saale-Unstrut-Triasland wird weiterhin eine hohe Bedeutung für den Erhalt der Art in Sachsen-Anhalt zugeschrieben, da sich vermutlich Teile verschollener Kolonien in noch derzeit unbekannten Quartieren im Gebiet reproduzieren. Aktuell sind vom Mausohr in Sachsen-Anhalt 29 Wochenstuben und 153 Winterquartiere, meist Einzelnachweise, bekannt. Winterquartiere bestehen in allen naturräumlichen Haupteinheiten in Sachsen-Anhalt, jedoch mit kopfstärkeren mit dem Schwerpunkt im Harz. Im Winter 2008/09 überwinterten in den bekannten Harzer Winterquartieren zählbar 161 Individuen. Die Wochenstuben sind hauptsächlich in der kontinentalen Klimazone zu finden. Wichtige Wochenstuben in der atlantischen Klimazone befinden sind u.a. in der Kirche in Bülstringen und in der Marktkirche in Quedlinburg. Für die Bereiche der nördlichen Elbtalniederung, des Flämings und der Colbitz-Letzlinger Heide sind keine Wochenstuben der Art bekannt. -

Die Nordgrenze Des Facettierten Hammers Und Ihre Bedeutung. 101
Die Nordgrenze des facettierten Hammers und ihre Bedeutung. 101 Gegenden Nordbrand enburgs, Wittenbergs und Anhalts, so sind diese Bestattungen im Pohlsberg nebst denen im Spitzenhoch und im Wind mühlenberge von Wulfen mit ihren schönen und großen Gefäßen und ihrer kriegerischen Ausstattung gewiß sehr beachtenswert; sie be zeichnen eine nördliche Grenzstellung dieser Bevölkerung, die ein großes fast leerstehendes Gebiet teils von neuem, teils zum erstenmal mit Menschen gefüllt hat.1) Anderseits hat der thrakische Volksstamm sich in verschiedenen Abteilungen südwärts nach Kleinasien aus gedehnt; in Troja geben die Bockelurnen der siebenten, nachmykeni- schen Stadt Kunde von thrakischer Besiedelung.2) So öffnet sich uns bei diesen Gräbern ein weiter Ausblick auf ein mächtig ausgebreitetes Volk in den letzten Jahrhunderten des zweiten vorchristlichen Jahrtausend, auf einen ethnologischen Zusammenhang, der vielleicht zur Erklärung mancher bisher rätselhaften Überein stimmungen nordländischer und mittelländischer Völker in Religion, Mythus und Gebräuchen dienen kann. P. Höfer. Die Nordgrenze des facettierten Hammers und ihre Bedeutung. Vor nunmehr zwanzig Jahren regte der Museumsausschuß an, das Verbreitungsgebiet des Schuhleistenkeils und des facettierten, also vielkantigen Hammers festzustellen. Die Eorscher wendeten sich zwar nach Klopfleisclis Vorgänge hauptsächlich den Gefäßen zu, aber gerade diese beiden Formen wurden dabei auch beachtet, und der Schuhleistenkeil mit der Band Verzierung, der vielkantige Hammer mit der Schnurverzierung zusammengestellt. ’) Die Aufzählung der nördlichen Grenzstationen dieses Typus bei Kossinna (Zeitschr. f. Ethn. 1902, S. 211—212) enthält anstatt der wichtigen Fundstelle von Latdorf die Worte ,.Burg bei Bernburg“ vermutlich ein Druckfehler für „Burg bei Magdeburg, Latdorf bei Bernburg“. Ich füge als westlichere Fund orte dieses Typus noch hinzu: Der Gläserne Mönch bei Halberstadt (Neue Mitt, des thür.-sächs.