ILEK Südsiegerland
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ahsgramerican Historical Society of Germans from Russia
AHSGR American Historical Society of Germans From Russia Germanic Origins Project Legend: BV=a German village near the Black Sea . FN= German family name. FSL= First Settlers’ List. GL= a locality in the Germanies. GS= one of the German states. ML= Marriage List. RN= the name of a researcher who has verified one or more German origins. UC= unconfirmed. VV= a German Volga village. A word in bold indicates there is another entry regarding that word or phrase. Click on the bold word or phrase to go to that other entry. Red text calls attention to information for which verification is completed or well underway. Push the back button on your browser to return to the Germanic Origins Project home page. Bre-Bzz updated Mar 2015 BrechtFN: said by the Kromm version of the Jagodnaja Poljana FSL to be fromUC Redmar, Brunswick Duchy, sent here as an 1812 prisoner of war (p.137). BrechtFN: also see Bracht. BrechenmacherFN: said by the 1816 Glueckstal census (KS:677, 674, 233) to be fromUC Weyer, Elsass, but the GCRA could not find them in those church records. The 1816 census also said they came after a stay in Torschau, Hungary; another source said that the place was Weyer, Hungary. However, the GCRA found evidence they actually may have been in Klein-Ker, Hungary and probably were in Tscherwenka; see their book for detail. Also spelled Brachenmacher. BreckenheimGL, [Hesse-Darmstadt?]: is now a neighborhood some 6 miles E of Wiesbaden city centre, and was said by the Caesarsfeld FSL to be homeUC to a Wenzel family. -

Umweltbericht Gem. § 2 a Baugb
ERFOLG LIEGT IN UNSERER NATUR Anlage zur Begründung der 7. Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen - Umweltbericht gem. § 2 a BauGB - P l a n u n g s b ü r o G e i s l e r Planungsbüro Thannberger-Wittenberg ERFOLG LIEGT IN UNSERER NATUR Projektbetreuung Gemeinde Burbach Eicher Weg 13 Auftraggeber 57299 Burbach Ansprechpartner: Dipl. Ing. Christian Feigs Projektbearbeitung Planungsbüro Geisler Dipl.-Ing. F. Geisler Auftragnehmer Goßfeldener Weg 6 D - 35091 Cölbe Tel.: 0 64 21 - 87 02 07 Fax: 0 64 21 - 87 02 08 Mobil: 01 72 - 6 71 16 91 www.planungsbüro-geisler.de E-mail: [email protected] Planungsbüro Thannberger-Wittenberg - Umwelt & Soziales - Dipl.-Geogr. C. Thannberger-Wittenberg Am Schützenplatz 7 D - 35039 Marburg Tel.: 0 64 21 - 16 81 34 Fax: 0 64 21 - 16 81 35 Mobil: 01 72 - 6 65 58 79 www.orgaplan-mr.de E-mail: [email protected] Stand: Vorentwurf, 13.05.2015 Umweltbericht – 7. Flächennutzungsplanänderung, Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen in der Gemeinde Burbach, Stand: Vorentwurf 13.05.2015 Seite 2 von 61 ERFOLG LIEGT IN UNSERER NATUR Inhaltsverzeichnis 1 Gesetzliche Grundlagen .............................................................................................. 5 1.1 Umweltprüfung (UP) nach BauGB ............................................................................. 5 1.2 Eingriffs-/Ausgleichsregelung ..................................................................................... 6 2 Kurzdarstellung der Ziele -

Burbach Informiert Burbach Informiert
Nr. 44 /2016 Mitteilungen der Gemeinde Burbach Mittwoch, 2. November 2016 Amtliche Bekanntmachungen |Informationen |Vereinsbeiträge BURBACH burBURBAbachiCHnformiINFOerRMIt ERT ERFOLG LIEGT IN UNSERER NATUR AMTSBLATT DERGEMEINDEBURBACH VERBREITUNGSGEBIET: Burbach,Gilsbach,Holzhausen, Lippe, aktuell Lützeln, Niederdresselndorf, Oberdresselndorf, Wahlbach, Würgendorf 9. Jahrgang | Nr. 44 | Mittwoch, 2. November 2016 Bürgerservice der „Burbacher Kaleidoskop“ arbeitet Geschichte auf Gemeinde Burbach Bekanntmachung der Gemeindewerke Anekdoten werden für das Jubiläum zusammengestellt Anregungen, Wünsche, Beschwerden und Nachfragen zu allen Angelegenheiten Bei Störungen im Bereich der „Es soll ein Geschichtenbuch von der Gemeinde können Sie schriftlich an die Wasserversorgung / Abwasserbe- Burbachern für Burbacher werden“, er- Gemeinde Burbach, Bürgerservice, Eicher seitigung ist klären Birgit Meier-Braun, Burbachs Weg 13, 57299 Burbach, und telefonisch • ab Dienstschluss bis zum nächs- Seniorenbeauftragte, Katrin Mehlich unter (0 27 36) 45 10 durchgeben. Auch die ten Dienstbeginn der Telefon-Bereit- vom Kulturbüro Burbach und Gemein- Kontaktaufnahme per E-Mail an die schaftsdienst MIDAS-UDZ / Siegen dearchivarin Patricia Ottilie den Hinter- Adresse [email protected] ist unter der Rufnummer 0271/2 32 42 31 grund für eine große Fragebogenaktion. möglich. zu verständigen. In der vergangenen Woche haben alle Auf den Internetseiten der Gemeinde MIDAS-UDZ informiert unver- Burbacher Haushalte eine kleine Bro- Burbach unter www.burbach-siegerland.de züglich den jeweiligen bereitschafts- habenden Mitarbeiter über die einge- schüre mit Fragen erhalten, die sie be- steht Ihnen außerdem ein entsprechendes antworten sollen. Außerdem ist Platz Formular zur Verfügung. Innerhalb eines gangene Meldung; für eigene Geschichten und Erzählun- Arbeitstages nach Eingang Ihrer Meldung •während der Dienstzeiten erhalten Sie zu Ihrer Angelegenheit eine Montag–Freitag, 8.30–12.00 Uhr, gen, die die Gemeindebewohner mittei- Rückmeldung. -

Western Central Europe1
Gerhard Bosinski 7 The earliest occupation of Europe: Western Central Europe1 holated finds from the Karlich pit indicate a late Early 1.2. VOLCANISM Pleistocene occupation. Excavated assemblages are known Tertiary volcanoes are found in the Hegau region to the from the middle part of the Middle Pleistocene onwards, at west of Lake Constance, and in particular in the Hessian Karlich G and Miesenheim. The Matter mandible roughly depression, with the large volcanic Vogelsberg massif, and dates to that period too. Interglacial occupation is attested, in the Westerwald, where they include the Siebengebirgc white finds from Karlich H (OIS 12) point to occupation of formation near Bonn. The Pleistocene saw the formation cold steppic environments. of the West and East Eifel volcanic fields (Frechen 1976; Schmincke, Lorenz and Seck 1983; Meyer 1986). In the 1. Geographical and geological background West Eifel, close to Daun, are located some 200 1.1. GEOGRAPHICAL OVERVIEW volcanoes. The East Eifel volcanic field, between the Western Central Europe lies between the Alps and the rivers Brohl and Moselle, contains some 100 volcanoes North Sea (Fig. 1). The largest, most westerly part of the (Schmincke 1988). Major explosive volcanic eruptions region is drained by the Rhine and its tributaries. To the occurred in this region some 400,000 years ago (Rieden SOUtheast the region includes the upper drainage basin of caldera), again at ca. 200,000 (Wehr caldera) and finally the Danube, while to the northeast the Weser with its at 11,000 BC cal. (Laacher See caldera) (P. van den tributaries the Fulda and the Werra form the most important Bogaard and Schmincke 1990; Street, Baales and river system. -
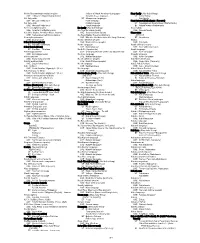
LCSH Section N
N-(3-trifluoromethylphenyl)piperazine Indians of North America—Languages Naar family (Not Subd Geog) USE Trifluoromethylphenylpiperazine West (U.S.)—Languages UF Nahar family N-3 fatty acids NT Athapascan languages Narr family USE Omega-3 fatty acids Eyak language Naardermeer (Netherlands : Reserve) N-6 fatty acids Haida language UF Natuurgebied Naardermeer (Netherlands) USE Omega-6 fatty acids Tlingit language BT Natural areas—Netherlands N.113 (Jet fighter plane) Na family (Not Subd Geog) Naas family USE Scimitar (Jet fighter plane) Na Guardis Island (Spain) USE Nassau family N.A.M.A. (Native American Music Awards) USE Guardia Island (Spain) Naassenes USE Native American Music Awards Na Hang Nature Reserve (Vietnam) [BT1437] N-acetylhomotaurine USE Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang (Vietnam) BT Gnosticism USE Acamprosate Na-hsi (Chinese people) Nāatas N Bar N Ranch (Mont.) USE Naxi (Chinese people) USE Navayats BT Ranches—Montana Na-hsi language Naath (African people) N Bar Ranch (Mont.) USE Naxi language USE Nuer (African people) BT Ranches—Montana Na Ih Es (Apache rite) Naath language N-benzylpiperazine USE Changing Woman Ceremony (Apache rite) USE Nuer language USE Benzylpiperazine Na-Kara language Naaude language n-body problem USE Nakara language USE Ayiwo language USE Many-body problem Na-khi (Chinese people) Nab River (Germany) N-butyl methacrylate USE Naxi (Chinese people) USE Naab River (Germany) USE Butyl methacrylate Na-khi language Nabā, Jabal (Jordan) N.C. 12 (N.C.) USE Naxi language USE Nebo, Mount (Jordan) USE North Carolina -

ABHANDLUNGEN Aus Dem Landesmuseum Der Provinz Westfalen MUSEUM FUR NATURKUNDE
• ABHANDLUNGEN aus dem Landesmuseum der Provinz Westfalen MUSEUM FUR NATURKUNDE Unter Mitwirkung des Westfälischen Naturwissenschaftlichen Vereins e. V. herausgegeben von Dr. Bernhard Rensch und Dr. Paul Graebner Direktor Direktorialassisten t des Landesmuseums für Naturkunde, Münster (vVestf.) 10. JAHRG. · 1939 ·HEFT 2 Erschienen: 1. VIII. 1939 · Druck der 'Vestfälischen Vereinsdruckerei AG Münster (Westf.) ABHANDLUNGEN aus ·dem Landesmuseum der Provinz Westfalen MUSEUM· FUR NATURKUNDE Unter Mitwirkung des Westfälischen 'Naturwissenschaftlichen Vereins e. V. herausgegeben von Dr. Bernhard Rens eh und Dr. Paul Graebner Direktor Direktorialassistent des Landesmuseums für Naturkunde, Münster (Westf.) 10. JAHRG. · 1939 · HEFT 2 Erschienen: 1. VIII. 1939 · Druck der Westfalischen Vereinsdruckerei AG Münster (WestL} Die Moosflora von_J Westfalen III Von Fritz Koppe, Bielefeld. Der 2. Teil der Moosflora von Westfalen, die Lebermoose enthaltend, erschien 1935. Seitdem habe ich noch die Moossammlung des verstorbenen Dr. H. ·WINTER durchsehen können, die sich im Herbar HAUSSKNECHT, \Veimar, befindet. Herrn Professor BORNMÜLLER bin ich für die freund liche Erlaubnis dazu zu großem Dank verpflichtet. WINTER war offenbar schon zur Zeit seines Aufenthaltes in Westfalen, 1879-1886, ein scharf sichtiger Beobachter, der in allen Gegenden \Vestfalens gesammelt hat; doch hat er mit Ausnahme einer kleinen Arbeit 1882 (36) nichts darüber ver öffentlicht. l\foosproben erhielt ich inzwischen noch von den Herren Konrektor i. R. \V. HENNEMANN, Werdohl, und Studien-Assessor TH. PITZ, Arnsberg. An Namensabkürzungen von Beobachtern werden gegenüber Teil II dieser Arbeit noch gebraucht: Piep= Pieper, (1789- 1851) , Arzt in Paderborn, dessen Moossammlung sich im Landesmuseum für Naturkunde Münster befindet. Sehern= Schemmann, t, früher Lehrer in Annen bei Witten. vVes = Wesemann, t, gleichfalls in Annen. -

Gemeinde Neunkirchen Aufgeste[Lt
Neufassung des FlächennutzungspIanes der Gemeinde Neunkirchen .Erläuterungsbericht Inhalt: Seite 1. Änlaß zur Neuaufstellung des FNP‘s 2. Rahmenbedingungen 2.1 Allgemeine Aussagen zum FNP~s 2.2 Übergeordnete Planungsvorgaben 2.2.1 Landesplanung 2.2.2 Grenzüberschreitende. Landesplanung -Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz- 2.2.3 Gebietsehtwicklungsplan -Teilabschnitt Qberbereiöh Siegen- 2.3 Allgemeine Ziele 3. Örtliche Grundlagen 3.1 Entwicklung 3.1.1 Geschichtliche Entwicklung 3.1.2 Siedlungsentwicklung 3.2 Geographische Strükturdaten 3.2.1 Lage und Geländestruktur 3.2.2 Geologie und Boden 3,2.3 Klima. 3.3 Demographische Strukturdaten 3.3.1 Bevölkerungsentwicklung.. 3.3.2 Bevölkerungsverteilung. 3.4 Ökologische Strukturdaten 3.4.1 Boden Wasser 4. Erläuterung von Bestand und Planung 4.1 Wohn- und Mischbaüflä9hen 4.2 . Gewerbeflächen 4.3 Sonderbauflächen 4.4 Gemeindebeda‘rfseinrichtungen .441 Schüten 4.4.2 Kirchen 443 Kindergärten 4.4.4. Offentliche Verwaltung 4•4~5. Post- und Fernmgldewesen 4.4.6. Sporthallen 4.4.7 Soziale Einrichtungen 4.4.8 Verkehrsübungsplatz 4.4.9 Schwimrnbad 45. Ver- ünd Entsorgungseinriähtungen 4.5.1 Wasserversorgung 4.5.2 Stromversorgung 4.5.3 Gasversorgung 4.5.4 Abwasserbeseitigung 4.5.5 Abfallwirtschaft 4.5.6 Altlasten 4.5.7 Bergbau 4.6 Grünflächen 4.6.1 SpielpI~tze 4.6.2 Friedhöfe 4.6.3 Sportplätze 4.7 Verkehr 4.7.1 Klassifiziertes Straßennetz 4.7.2 ÖPNV 4.7.3 SPNV 4.7.4 Schienengebundener Güterverkehr 4.7.5 Siegerland-Flughafen 4.8 Denkmalschutz 4.9 Freiraum 4.9.1 Landwirtschaftlich genutzte FI~chen 4.9.2 Forstwirtschaftlich genutzte Flachen 4.9.3 Erholungsbereiche 4.9.4 Bereiche für den Schutz der Natur 4.9.5 Naturdenkmale und Landschaftsbestandteile 4.9.6 Gewässer und Schutzgebiete 4.10 Eingriffsregelung 4.11 Verträglichkeit zu FFH- und Vogelschutzgebieten 4.12 Darstellung von Vorrangzonen für Windkraftanlagen 5. -

Und Greifvögel Windenergievorrangzonen Neunkirchen 2015
FNP zur Ausweisung von Windvorrangzonen Endbericht Ergänzende Raumnutzungsanalyse Windkraftsensibler Greif- und Großvögel (2015) Auftraggeber: Uwe Meyer Grimbachstr. 9a 57339 Erndtebrück Auftragnehmer: Holger Krafft GIS-Dienstleistungen, Kartographie Auf der Platte 5 57271 Hilchenbach Bearbeitung: Dipl.-Biol. Holger Krafft Dipl.-Ing. (FH) Landespflege Thomas Eickhoff Stand: 16.11.2015 Ergebniszusammenstellung Monitoring Groß- und Greifvögel Windenergievorrangzonen Neunkirchen 2015 Inhaltsverzeichnis 1 Untersuchungsgebiet ....................................................................................................................... 1 2 Untersuchungsmethode ................................................................................................................... 1 2.1 Beobachtung von Flugbewegungen von Greif- und Großvögeln ............................................ 1 2.2 Horstsuche und -kontrolle ........................................................................................................ 6 3 Ergebnisse und Diskussion .............................................................................................................. 6 3.1 Windenergieempfindliche Greif- und Großvögel (gem. des Leitfadens „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung: 12. November 2013)“ des MKULNV und des LANUV) .................... 6 3.2 Windenergieempfindliche Greif- und Großvögel (ausschließlich gem. der „Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen -

Ausgabe Nr. 37/2019
Amtliche Bekanntmachungen|Informationen |Vereinsbeiträge burbach informiertINFORMIERT AMTSBLATT DER GEMEINDE BURBACH VERBREITUNGSGEBIET: Burbach, Gilsbach, Holzhausen, Lippe, Lützeln, Niederdresselndorf, Oberdresselndorf, Wahlbach, Würgendorf 12. Jahrgang | Nr. 37 | Mittwoch, 18. September 2019 Einladung zur Mitgliederversammlung Förderverein Heimhof-Theater e.V. – Pommernstraße 21 – 57299 Burbach An die Mitglieder des Förderver- 5. Aussprache zu den Berichten TOP 11. Sonstiges - Besprechung eins Heimhof-Theater e.V. 3 und TOP 4, Beschlussfassungen zugelassener, Anträge Der Vorstand des Fördervereins 6. Entlastung des Vorstands (Antrag Anträge zur Mitgliederversammlung Heimhof-Theater e.V. lädt alle Mitglie- durch einen Kassenprüfer) sind schriftlich, spätestens bis Donners- der des FVHs e.V. ein, für Donnerstag, 7. Änderungen und Korrekturen tag, dem 19. September 2019, beim 26. September 2019, 18:00 Uhr, zur or- in der Satzung des Vereins Vorsitzenden des Fördervereins Heim- dentlichen Mitgliederversammlung 8. Wahlen – § 7, § 8 und § 9 hof-Theater e.V. einzureichen (An- 2019, im Heimhof-Theater, 57299 Bur- der Satzung schrift s. o.). Wir bitten zur Organisa- bach-Würgendorf, Heimhofstr. 7a. 1. stellvertretender Vorsitzenden tion der Versammlung um Anmeldung / Tagesordnung – Kurzinformation 2. Schatzmeister Absage bis 19. September 2019. der Einladung nach Satzung, vom 10. Die Mitgliederversammlung ist eine September 2019 3. Schriftführung 4. Geschäftsführung vereinsinterne Veranstaltung. 1. Begrüßung, Eröffnung der Mit freundlichem Gruß Versammlung 5. Berufung von Beratern 2. Beschlussfassung über die 9. Informationen zu Instandhaltungen Förderverein Heimhof-Theater e.V. Zulassung eingegangener Anträge des Theaters innen und außen gez. Theodor Petera, Vorsitzender 3. Berichte der Vorstandsmitglieder 10. Informationen zur laufenden Christoph Ewers,Stellv. Vorsitzender Erneuerung der Fuß- und Radwegbrücke 4. Kassenprüfungsbericht Spielzeit Burbach, den 12. September 2019 zwischen Burbach und Wahlbach Erfolgreiche Zertifizierung des „Trödelsteinpfades“ Ab dem 23. -

Washington, Tuesday, January 23, 1951
VOLUME 16 NUMBER 15 Washington, Tuesday, January 23, 1951 TITLE 6— AGRICULTURAL CREDIT as herein set forth. The average value CONTENTS and the investment limit heretofore es Chapter III-—Farmers Home-Adminis tablished for said county, which appear Agriculture Department Pa&e tration, Department of Agriculture in the tabulations of average values and investment limits under § 311.30, Chap See also Commodity Credit Corpo Subchapter B— Farm Ownership Loans ter HI, Title 6 of the Code of Federal ration; Farmers Home Adminis tration; Federal Crop Insur P art 311— B asic R e g u lat io n s Regulations (13 F. R. 9381), are hereby ance Corporation; Forest Serv superseded by the average value and S ubpart B— L o a n L im it a t io n s ice. the investment limit set forth below for AVERAGE VALUES OF FARMS AND INVESTMENT said county. Notices ; LIMITS; PENNSYLVANIA N ew Jersey Disaster areas-having need for agricultural credit, designa For the purposes of title I of the Average Investment tion__________________________- 590 County Bankhead-Jones Farm Tenant Act, as value limit amended, average values of efficient fam Rules and regulations: W ar food orders; agriculture- ily-type farm-management units and Ocean__ _____ . $16,500 $12,000 investment limits for the counties identi import order------------------------ 579 fied below are determined to be as herein Alien Property, Office of set forth. The average values and in (Sec. 41, 60 Stat. 1066; 7 U. S. C., 1015. In terprets or applies secs. 3, 44, 60 Stat. 1074, Notices: vestment limits heretofore established 1069; 7 U. -
Der Westerwald Touristik-Service
Tourismus Strategie 2015.qxp 05.06.2011 15:28 Seite 1 UnsereDer Region: Westerwald Wertschöpfung im Tourismus & Tourismus Strategie 2015 Tourismus Strategie 2015.qxp 05.06.2011 15:28 Seite 2 Inhalt Vorwort 3 Hintergründe zum Tourismus Westerwald 4 Die Region Westerwald 5 Auszüge aus der Situationsanalyse 6 Marktsegmente des Tourismus im Westerwald 8 Der touristische Gesamtmarkt im Westerwald 9 Vom Tourismus profitierende Branchen 10 Touristische Wertschöpfung im Westerwald 11 Wirtschaftsfaktor Tourismus im Westerwald 12 Touristische Profilierung der Region 14 Stärken / Schwächen - Chancen / Risiken 15 Zielsystem 16 Wir Westerwälder - natürlich entdecken 17 Maßnahmen 2 Tourismus Strategie 2015.qxp 05.06.2011 15:28 Seite 3 Vorwort Werte Gäste und Freunde des Westerwaldes, liebe Tourismus-Akteure, der Tourismus trägt zur erfolgreichen Entwicklung unseres Ihnen gebührt ein herzliches Dankeschön: Westerwaldes bei. Dies soll auch in Zukunft so sein! Um Für die Zeit, die sie für die gemeinsame Sache aufge- auch weiterhin nachhaltigen Erfolg am stark ausdifferen- wendet, die Ideen und Anregungen, die sie eingebracht zierten und hart umkämpften Tourismusmarkt zu haben, haben, für die offene, mitunter lebhafte Diskussion, die ist es unerlässlich, sich die Relevanz des Wirtschafts- äußerst konstruktive Mitarbeit und die positive zweiges für die eigene Region zu verdeutlichen. Ebenso Atmosphäre, zu der sie beigetragen haben. gilt es einen klaren Weg mit einer Vision sowie mit Zielen, Strategien und Maßnahmen zu definieren. Dies ist Fakten, Zahlen und Strategien bilden eine wertvolle und nun im Westerwald geschehen! unverzichtbare Grundlage. Nun jedoch folgt der schwierigste Teil, nämlich die Die Bedeutung, die dem Tourismus im Westerwald Umsetzung der vorliegenden Ideen in die touristische zukommt, spiegelt sich eindrucksvoll in statistischen Praxis. -

Phenolic Compounds in Needles of Norway Spruce Trees in Relation to Novel Forest Decline
Phenolic Compounds in Needles of Norway Spruce Trees in Relation to Novel Forest Decline. II. Studies on Trees from Two Sites in Middle Western Germany Christine M. Richter and Aloysius Wild Institut für Allgemeine Botanik der Johannes Gutenberg-Universität, Saarstraße 21, D-55099 Mainz, Bundesrepublik Deutschland Z. Naturforsch. 49c, 619-627 (1994); received January 31/June 16, 1994 Phenolic Compounds, Picea abies, Novel Forest Decline, Picein, Catechin The content of several phenolic compounds in needles of 20- to 30-year-old Norway spruce trees (Picea abies) was measured using HPLC. The results of two forestry sites in middle western Germany are reported in this paper. They are part of a research programme on novel forest decline which was carried out in various regions of Germany. Distinct amounts of picein, catechin, piceatannol glucoside, and other phenolic compounds were detected in the studied spruce needles. Additionally, their contents changed in relation to damage. Some compounds, especially catechin, showed increased levels in the needles of the damaged trees compared to the undamaged ones. Here, the values for the undamaged trees of the different sites were similar. Concerning the changes in picein contents, however, there was a great difference between the sites. p-Hydroxyacetophenone was detected in very low amounts only and did not correlate with damage. These results are compared with earlier findings from another site that shows severe dam age. The role of phenolic compounds as indicators of tree damage is discussed. Introduction ances are considered among others as decisive fac An enhanced production of phenolic com tors for the occurrence of novel forest decline pounds and other biologically active substances (Cowling et al., 1988).