Nordwestdeutsche Hefte“ Zu Kristall
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Knut Døscher Master.Pdf (1.728Mb)
Knut Kristian Langva Døscher German Reprisals in Norway During the Second World War Master’s thesis in Historie Supervisor: Jonas Scherner Trondheim, May 2017 Norwegian University of Science and Technology Preface and acknowledgements The process for finding the topic I wanted to write about for my master's thesis was a long one. It began with narrowing down my wide field of interests to the Norwegian resistance movement. This was done through several discussions with professors at the historical institute of NTNU. Via further discussions with Frode Færøy, associate professor at The Norwegian Home Front Museum, I got it narrowed down to reprisals, and the cases and questions this thesis tackles. First, I would like to thank my supervisor, Jonas Scherner, for his guidance throughout the process of writing my thesis. I wish also to thank Frode Færøy, Ivar Kraglund and the other helpful people at the Norwegian Home Front Museum for their help in seeking out previous research and sources, and providing opportunity to discuss my findings. I would like to thank my mother, Gunvor, for her good help in reading through the thesis, helping me spot repetitions, and providing a helpful discussion partner. Thanks go also to my girlfriend, Sigrid, for being supportive during the entire process, and especially towards the end. I would also like to thank her for her help with form and syntax. I would like to thank Joachim Rønneberg, for helping me establish the source of some of the information regarding the aftermath of the heavy water raid. I also thank Berit Nøkleby for her help with making sense of some contradictory claims by various sources. -

2018 • Vol. 2 • No. 2
THE JOURNAL OF REGIONAL HISTORY The world of the historian: ‘The 70th anniversary of Boris Petelin’ Online scientific journal 2018 Vol. 2 No. 2 Cherepovets 2018 Publication: 2018 Vol. 2 No. 2 JUNE. Issued four times a year. FOUNDER: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education ‘Cherepovets State University’ The mass media registration certificate is issued by the Federal Service for Supervi- sion of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor). Эл №ФС77-70013 dated 31.05.2017 EDITOR-IN-CHIEF: O.Y. Solodyankina, Doctor of Historical Sciences (Cherepovets State University) DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF: A.N. Egorov, Doctor of Historical Sciences (Cherepovets State University) E.A. Markov, Doctor of Political Sciences (Cherepovets State University) B.V. Petelin, Doctor of Historical Sciences (Cherepovets State University) A.L. Kuzminykh, Doctor of Historical Sciences (Vologda Institute of Law and Economics, Federal Penitentiary Service of Russia) EDITOR: N.G. MELNIKOVA COMPUTER DESIGN LAYOUT: M.N. AVDYUKHOVA EXECUTIVE EDITOR: N.A. TIKHOMIROVA (8202) 51-72-40 PROOFREADER (ENGLISH): N. KONEVA, PhD, MITI, DPSI, SFHEA (King’s College London, UK) Address of the publisher, editorial office and printing-office: 162600 Russia, Vologda region, Cherepovets, Prospekt Lunacharskogo, 5. OPEN PRICE ISSN 2587-8352 Online media 12 standard published sheets Publication: 15.06.2018 © Federal State Budgetary Educational 1 Format 60 84 /8. Institution of Higher Education Font style Times. ‘Cherepovets State University’, 2018 Contents Strelets М. B.V. Petelin: Scientist, educator and citizen ............................................ 4 RESEARCH Evdokimova Т. Walter Rathenau – a man ahead of time ............................................ 14 Ermakov A. ‘A blood czar of Franconia’: Gauleiter Julius Streicher ...................... -

Gilbert Molinier Lorsqu'alain Badiou Se Fait Historien : Heidegger, La
Texto ! Textes et cultures, vol. XXIV, n°3 (2019) Gilbert Molinier Lorsqu’Alain Badiou se fait historien : Heidegger, la Deuxième Guerre mondiale, et coetera « [L]e spectacle que m’a offert l’université a contribué à m’exorciser complètement, à me délivrer d’une catharsis qui s’est achevée à la Sorbonne quand j’ai vu mes collègues, tous ces singes qui lisaient Heidegger et le citaient en allemand. »1 Vladimir Jankélévitch Résumé. — Cette étude traite d’une dénégation collective. Situant ses recherches au niveau et dans la lignée des prestigieux penseurs de la question de l’Être, Parménide, Aristote, Malebranche…, Alain Badiou rencontre Martin Heidegger. Or, celui-ci est soupçonné d’avoir été et/ou d’avoir toujours été un nazi inconditionnel. Souhaitant effacer une telle tache, Alain Badiou affirme, d’une part : « [Il] n’y a absolument pas besoin de chercher dans sa philosophie des preuves qu’il était nazi, puisqu’il était nazi, voilà ! […] » ; d’autre part et en même temps, il infirme : « C’est bien plutôt dans ce qu’il a fait, ce qu’il a dit, etc. » Cet « etc. » contient donc « ce qu’il a pensé, ce qu’il a écrit » . C’est sur une telle dénégation collective que s’appuient encore l’enseignement et la recherche universitaires dans de nombreux pays, en particulier en France. Or, une dénégation si marquée ne va pas sans produire des effets négatifs. Resümee. — Ursprung der folgenden Bemerkungen ist eine kollektive Verneinung. Alain Badiou, der es liebt, seine Forschungen auf die Ebene und in Übereinstimmung mit den angesehenen Denkern zur Frage des Seins, Parménides, Aristoteles, Malebranche… zu stellen, trifft einen gewissen Martin Heidegger. -

Außenpolitik, Öffentlichkeit, Öffentliche Meinung Deutsche Streitfälle in Den „Langen 1960Er Jahren“ Vo N Peter Hoeres
Außenpolitik, Öffentlichkeit, öffentliche Meinung Deutsche Streitfälle in den „langen 1960er Jahren“ Vo n Peter Hoeres Am 17. März 1966 legte der Leiter des Pressereferats Hans Jörg Kastl sei- nem Dienstherrn, Außenminister Gerhard Schröder, einen Vermerk über ein Gespräch zwischen Axel Springer und Ludwig Erhard vor: „Axel Springer habe im Verlauf dieses Gesprächs geäußert, er werde die Politik des Herrn Bundeskanzlers solange nicht unterstützen, wie Dr. Schröder Bundesaußenminister sei. Der Bundeskanzler habe geantwortet, dann müs- se er eben auf die Unterstützung des Springer-Konzerns verzichten.“1 Der angeblich so mächtige Medienzar konnte seine Personalvorstellun- gen also selbst bei „Ludwig, dem Kind“, wie der weiche Erhard in Adenau- ers Umgebung genannt wurde2, nicht ansatzweise zur Geltung bringen. Er hatte es aber in aller Deutlichkeit versucht, sogar mit diesem offenen Junk- tim. Man könnte viele weitere Beispiele für die versuchte Steuerung der Politik durch die Medien aus dieser Zeit anführen, bekannt ist Rudolf Aug- steins Maxime, Strauß dürfe es niemals ins Kanzleramt schaffen.3 Die Politiker waren aber nicht nur tatsächliche oder vermeintliche Opfer anmaßender Großpublizisten. Sie spielten das Spiel auch mit, und zwar nicht nur Adenauer, der es mit seiner „Off the Record“-Technik schaffte, in- und ausländische Journalisten ungefragt zu Verbündeten zu machen.4 Trotz der Schröder-Feindschaft des Springer-Verlages hielt auch der Au- 1 Vermerk Kastl 17.3.1966, in: Archiv für Christlich-Demokratische Politik (ACDP), 01–483/214–1. 2 Vgl. Franz Josef Strauß, Die Erinnerungen. Berlin 1989, 414. 3 Vgl. Rudolf Augstein über Franz Josef Strauß in seiner Zeit, in: Der Spiegel 10.10.1988, 18–27. -

Verlag C. H. Beck München Mit 22 Abbildungen
Verlag C. H. Beck München Mit 22 Abbildungen Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme Hach meist er, Lutz: Der Gegnerforscher: die Karriere des SS-Führers Franz Alfred Six / Lutz Hachmeister. – München: Beck, 1998 ISBN 3-406-43507-6 ISBN 3 406 43507 6 © C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), München 1998 Satz: Janss, Pfungstadt. Druck und Bindung: Ebner, Ulm Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier (Hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff) Printed in Germany Eingescannt mit OCR-Software ABBYY Fine Reader Inhalt I. Vorbemerkung ........................................................................... 7 II. «Durch Tod erledigt» Das «Einsatzkommando Österreich»: Wien 1938 ................................................................................... 10 III. «Als gäb’ es nichts Gemeines auf der Welt» Die Studentenzeit des Gegnerforschers: Heidelberg 1930-1934................................................................. 38 IV. «Abends Zusammensein im ,Bhitgericht‘» Von der Zeitungskunde zur politischen Geistesgeschichte: Königsberg und Berlin 1934-1940 ............................................. 77 V. «Der Todfeind aller rassisch gesunden Völker» Franz Alfred Six im SD-Hauptamt: Berlin 1933-1939 144 VI. «Möglichst als Erster in Moskau» Von der Gründung des RSHA bis zum «Osteinsatz»: 1939-1941 .................................................................................. 199 VII. «Ad majorem Sixi gloriam» Im Auswärtigen Amt: 1942-1943 239 VIII. «In a state of chronic tension» Die Verhöre -

Matters of Taste: the Politics of Food and Hunger in Divided Germany 1945-1971
Matters of Taste: The Politics of Food and Hunger in Divided Germany 1945-1971 by Alice Autumn Weinreb A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (History) in the University of Michigan 2009 Doctoral Committee: Professor Kathleen M. Canning, Co-Chair Associate Professor Scott D. Spector, Co-Chair Professor Geoff Eley Associate Professor Alaina M. Lemon Acknowledgements The fact that I would become a German historian had never crossed my mind ten years ago – that the past decade has made me one is entirely due to the remarkable number of people who have helped me in ways that even now I cannot fully grasp. Nonetheless, I suppose that these acknowledgements are as good a place as any to start a lifetime's worth of thanking. It all began at Columbia, where Professor Lisa Tiersten suggested that I go abroad, a suggestion that sent me for the first time to Germany. Five years later, when I first considered going to graduate school, she was the person I turned to for advice; her advice, as always, was excellent – and resulted in my becoming a German historian. During my first chaotic and bizarre years in Berlin, Professors Christina von Braun and Renate Brosch went out of their way to help a confused and hapless young American integrate herself into Humboldt University and get a job to pay the admittedly ridiculously low rent of my coal-heated Kreuzberg apartment. Looking back, it still amazes me how their generosity and willingness to help completely transformed my future. -
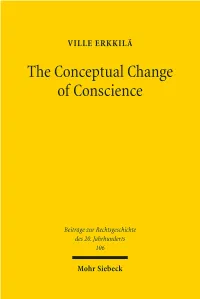
The Conceptual Change of Conscience
Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts edited by Thomas Duve, Hans-Peter Haferkamp, Joachim Rückert und Christoph Schönberger 106 Ville Erkkilä The Conceptual Change of Conscience Franz Wieacker and German Legal Historiography 1933–1968 Mohr Siebeck Ville Erkkilä, born 1978; post-doctoral researcher at the Center for European Studies, Univer- sity of Helsinki. ISBN 978-3-16-156691-2 / eISBN 978-3-16-156692-9 DOI 10.1628/978-3-16-156692-9 ISSN 0934-0955 / eISSN 2569-3875 (Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts) The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data are available at http://dnb.dnb.de. © 2019 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohrsiebeck.com This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form (beyond that permitted by copyright law) without the publisher’s written permission. This applies particularly to reproductions, translations, microfilms and storage and processing in electronicsystems. The book was printed on non-aging paper and bound by Gulde-Druck in Tübingen. Printed in Germany. Abstract This is a history of the ideas of German legal historian Franz Wieacker. The broader aim of this study is to analyze the intellectual context in which Wieack- er’s texts were situated, thus the German legal scientific discourse from 1933 to 1968. In this study Franz Wieacker’s texts are analyzed in the light of his corre- spondence and the broader social historical change of the twentieth century Ger- many. The study concentrates on the intertwinement of his scientific works with the contemporary society, as well as on the development of his personal percep- tion of continuity and meaning in history. -
Avhandling+TVHH-Edit.Pdf (5.125Mb)
Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand 2 Thomas V.H. Hagen Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand Kino i Norge 1940–1945 Avhandling for graden philosophiae doctor Universitetet i Agder Fakultet for humaniora og pedagogikk 2018 3 Doktoravhandlinger ved Universitetet i Agder 184 ISSN: 1504-9272 ISBN: 978-82-7117-883-3 Thomas V.H. Hagen, 2018 Trykk: Wittusen & Jensen Oslo 4 Innhold Abstract ................................................................................................................................................. 11 Forord .................................................................................................................................................... 12 Forkortelser m.v. ................................................................................................................................... 14 Liste over tabeller og figurer ................................................................................................................. 16 Illustrasjoner .......................................................................................................................................... 18 INTRODUKSJON .......................................................................................................................... 19 I. I begynnelsen var filmen ................................................................................................................ 19 II. Problemstilling og forskningsspørsmål ......................................................................................... -

Die Naumann Affäre 1953 Text
Episode oder Gefahr? Die Naumann-Affäre Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades eingereicht am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin im November 2012. vorgelegt von Beate Baldow 1. Gutachter: Prof. Dr. Wolfgang Wippermann 2. Gutachter: Prof. Dr. Arnd Bauerkämper Disputation: 20.02.2013 Inhalt Einleitung 2 I. Die Formierung des Naumann-Netzwerkes 1. Naumanns NS-Blitzkarriere, das Untertauchen und der Neustart (1908-1950) 17 2. Der Kontaktausbau in der Bruderschaft (1950-1951) 34 3. Die Einflussnahme durch die Soldatenbünde (1950-1952) 55 4. Innenpolitische Konzeption, „Innerer-“ und „Äußerer Kreis“ (1950-1953) 83 5. Außenpolitische Konzeption, Auslandskontakte und „Nation Europa“ (1951-1953) 102 II. Die Aktivitäten des Naumann-Netzwerkes in den Parteien 1. Die Unterwanderung und Einflussnahme in der FDP (1950-1952) 123 2. Die Verhandlungen mit dem BHE und der DP (1952) 160 3. Der Kampf gegen die SRP und ihre Nachfolgeorganisationen (1952) 169 4. Die Verhandlungen mit der DRP und der DG (1951-1953) 184 III: Die Zerschlagung des Naumann-Netzwerkes 1. Die Vorbereitung und der Zugriff (Nov. 1952-Jan. 1953) 197 2. In britischer Haft (Jan.-März 1953 ) 211 3. In deutscher Haft (April-Juli 1953) 247 4. Die Haftentlassung, der Freispruch und die Nachwirkungen (1953-1956) 277 Fazit 303 Anhang Liste: Personen im Naumann-Netzwerk 311 Quellen und Literatur 333 Einleitung „Gesammelt werden sollte das Landvolk auf einer Standesebene. Die Soldatenbünde in einer Dachorganisation, der Einzelhandel oder die Flüchtlinge oder die Steuerzahler, wir sollten uns in den Gemeinden zu Wort melden, dort um die Bürger- und Oberbürgermeisterpositionen ringen […]. Vielleicht auch [um] den einen oder anderen Landesverband dieser oder jener Partei, – kurz – durchdringen wir das Gemeinwesen in allen seinen Verästelungen und wenn diese alle oder auch nur ein Teil von ihnen bereit sind, dann ist die Stunde gekommen zu erklären, es gibt außer den Lizenzparteien auch ein unabhängiges Deutschland. -

Dukt: Kaffee Im Schatten Der Nachkriegsjahre 1948–1959
I. Das heiße Verlangen nach einem Luxuspro- dukt: Kaffee im Schatten der Nachkriegsjahre 1948–1959 1. Mangel und Wohlstandssehnsucht: Der Kaffee konsument zwischen westdeutscher Nachkriegswirklichkeit und „Wirtschaftswunder“ Die Konsumentwicklung in Westdeutschland 1948/49 Das gemeinsame Plakat von CDU und FDP zur Bundestagswahl 1949 war außer- gewöhnlich: Es nahm die spätere Koalition der beiden bürgerlichen Parteien vor- weg, indem es die Erfolge der Währungsreform als deren direktes und aus- schließliches Verdienst darstellte. Eine dynamische Kurve teilte das Plakat in eine dunkle und eine helle Seite. Die dunkle Seite – überschrieben mit „1948“ – sym- bolisierte die Not der unmittelbaren Nachkriegszeit vor der Währungsreform. Düster, deprimierend und trostlos war die Stimmung gezeichnet, mit einigen Aussagen, die typisch für diese Krisenzeit standen: „Keine Kohlen“, „Monat Januar 50 gr. Fett“, „Tausche Anzug gegen Essbares!“, „5 kg Kartoffeln“, „Nachfrage zwecklos!“, „Rauchwaren ausverkauft!“ und „Kaffee-Ersatz“. Ganz anders die hel- le Seite „1949“: Wenn auch nicht im maßlosen Überfluss, so waren die Waren- körbe doch alle gut gefüllt mit Brot, Kartoffeln, heimischem Gemüse und mit Obst (darunter auch Südfrüchte wie Zitronen oder Bananen). Es gab Tabak- erzeugnisse in einiger Auswahl, Würste und Schinken, Alkoholika und sogar glän- zende Schuhe, ebenso schick wie die darüber abgebildete Anzugjacke. Das Plakat verhieß eine wunderbare Warenwelt des geordneten Konsums. Doch Kaffee suchte der Betrachter vergebens. Hätten die Plakatgestalter die Lebensumstände der Bevölkerung 1949 tatsächlich widerspiegeln wollen, sie hätten den „Kaffee- Ersatz“ auf der hellen Seite wiederholen müssen, denn 1949 befand man sich weiterhin im „Lande des Muckefucks“1. Mit echtem Bohnenkaffee konnten CDU und FDP noch nicht werben, wenn sie glaubwürdig bleiben wollten. -
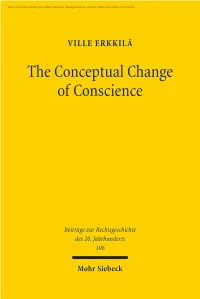
The Conceptual Change of Conscience
Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: Helsinki University Library, 23.04.2019 Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: Helsinki University Library, 23.04.2019 Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts edited by Thomas Duve, Hans-Peter Haferkamp, Joachim Rückert und Christoph Schönberger 106 Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: Helsinki University Library, 23.04.2019 Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: Helsinki University Library, 23.04.2019 Ville Erkkilä The Conceptual Change of Conscience Franz Wieacker and German Legal Historiography 1933–1968 Mohr Siebeck Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: Helsinki University Library, 23.04.2019 Ville Erkkilä, born 1978; post-doctoral researcher at the Center for European Studies, Univer- sity of Helsinki. ISBN 978-3-16-156691-2 / eISBN 978-3-16-156692-9 DOI 10.1628/978-3-16-156692-9 ISSN 0934-0955 / eISSN 2569-3875 (Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts) The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data are available at http://dnb.dnb.de. © 2019 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohrsiebeck.com This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form (beyond that permitted by copyright law) without the publisher’s written permission. This applies particularly to reproductions, translations, microfilms and storage and processing in electronicsystems. The book was printed on non-aging paper and bound by Gulde-Druck in Tübingen. Printed in Germany. Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: Helsinki University Library, 23.04.2019 Abstract This is a history of the ideas of German legal historian Franz Wieacker. -

V0 / Intellectuals and National
379 /V0 / AO. 7 IB Q INTELLECTUALS AND NATIONAL SOCIALISM: THE CASES OF JUNG, HEIDEGGER, AND FISCHER THESIS Presented to the Graduate Council of the University of North Texas in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF ARTS By Richard M. Stewart, B.A. Denton, Texas August, 1995 379 /V0 / AO. 7 IB Q INTELLECTUALS AND NATIONAL SOCIALISM: THE CASES OF JUNG, HEIDEGGER, AND FISCHER THESIS Presented to the Graduate Council of the University of North Texas in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF ARTS By Richard M. Stewart, B.A. Denton, Texas August, 1995 Stewart, Richard M., Intellectuals and National Socialism: The Cases of Jung, Heidegger, and Fischer. Master of Arts (History), August, 1995, 119 pp., bibliography, 91 titles. This thesis discusses three intellectuals, each from a distinct academic background, and their relationship with National Socialism. Persons covered are Carl Gustav Jung, Martin Heidegger, and Eugen Fischer. This thesis aims at discovering something common and fundamental about the intellectuals' relationship to politics as such. Major sources include the writings, scholastic and apologetic, of the three principals. Following a brief introduction, each person is discussed in a separate chapter. The relationship each had with National Socialism is evaluated with an eye to their distinct academic backgrounds. The conclusion of this thesis is that intellectuals succumb all too easily to political and cultural extremism; none of these three scholars saw themselves as National Socialists, yet each through his anti-Semitism and willingness to cooperate assisted the regime. TABLE OF CONTENTS Page Chapter I.