21 Tankumsee
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Commission Decision of 10 January 2011 Adopting, Pursuant to Council
L 33/52 EN Official Journal of the European Union 8.2.2011 COMMISSION DECISION of 10 January 2011 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, a fourth updated list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region (notified under document C(2010) 9666) (2011/63/EU) THE EUROPEAN COMMISSION, (5) On the one hand, the fourth update of the list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region is necessary in order to include additional sites Having regard to the Treaty on the Functioning of the European that have been proposed since 2008 by the Member Union, States as sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC. The obligations Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 resulting from Articles 4(4) and 6(1) of Directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and 92/43/EEC are applicable as soon as possible and flora ( 1), and in particular the third subparagraph of Article 4(2) within six years at most from the adoption of the thereof, fourth updated list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region. Whereas: (6) On the other hand, the fourth update of the list of sites of Community importance for the Atlantic biogeo (1) The Atlantic biogeographical region referred to in graphical region is necessary in order to reflect any Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the changes in site related information submitted by the territories of Ireland, the Netherlands and the United Member States following the adoption of the initial and Kingdom, and parts of Belgium, Denmark, France, the first three updated Community lists. -

Wendschotter Und Vorsfelder Drömling Mit Kötherwiesen“ Auswertung Der Beteiligung Der Träger Öffentlicher Belange (TÖB-Beteiligung)
Neuausweisung und Erweiterung NSG „Wendschotter und Vorsfelder Drömling mit Kötherwiesen“ Auswertung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB-Beteiligung) Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Bearbeitungsvermerk Aller-Ohre-Verband / Unterhaltungsverband Oberaller vom 12.7.19: Folgende Punkte bitte ich Sie, herauszunehmen bzw. zu ergänzen: => der Einwand ist gegenstandslos, weil gem. § 4 (7) NSG-VO die ordnungs- §3 (2) 5. Verbote der Wasserfahrzeuge…. bitte ich zu ergänzen: „ ausgenom- gemäße Gewässerunterhaltung freigestellt ist, dazu gehört auch das Betreten men Fahrzeuge der Gewässerunterhaltung“. sowie das Befahren (u.a. mit Wasserfahrzeugen), daher ist weder eine Aus- §4 (2) c) Betreten und Befahren des Gebietes ist für die Aufgabenerledigung nahme in § 3 (2) 5. NSG-VO noch eine Ergänzung in § 4 (2) c) notwendig; zur des Verbandes jederzeit und kurzfristig für die Aufgabenwahrnehmung erforder- Klarstellung wurde ein entsprechenden Hinweis in die Begründung eingefügt lich. Ich bitte Sie, dies entsprechend zu ergänzen. §4 (7) bitte ich folgende nachstehende Vorgabe zu ändern: a) In „nur abschnittsweise oder einseitig“, wo möglich. => die Formulierung „wo möglich“ ist zu unkonkret (unbestimmter Rechtsbe- griff) Begründung: Der Steekgraben und die Wipperaller, um nur 2 Gewässer zu benennen, sind => m.E. sollte für das NSG ein Unterhaltungsrahmenplan aufgestellt werden, für den Wasserabfluss größerer Einzugsgebiete, insbesondere für die Abfüh- worin die konkreten Regelungen für einzelne Gewässerstrecken im Vorfeld im rung von Stark- und Hochwasserereignissen, von hervorgehobener Bedeutung. Einvernehmen mit der UNB festgelegt werden Die Abschnittsdefinition sollte nach den örtlichen Begebenheiten und Vegetati- => die Abschnittsdefinition nach den örtlichen Begebenheiten und Vegetati- onsbildern und nicht nach fixierten Längen in der zweiten Ordnung der Gewäs- onsbildern (wie vom AOV gefordert) bzw. -

AVES Braunschweig
AVES Braunschweig Mitteilungen der Avifaunistischen Arbeitsgemeinschaft Südostniedersachsen – AviSON im NABU-Landesverband Niedersachsen 3. Jahrgang (2012) ISSN 2190-3808 AVES Braunschweig Mitteilungen der Avifaunistischen Arbeitsgemeinschaft Südostniedersachsen – AviSON im NABU-Landesverband Niedersachsen 3. Jahrgang (2012) Herausgeber: Avifaunistische Arbeitsgemeinschaft Südostniedersachsen – AviSON. c/o Prof. Dr.-Ing. Ulrich Reimers, Kollwitzstraße 28, 38159 Vechelde, [email protected] Schriftleitung: Prof. em. Dr. Werner Oldekop, Bergiusstraße 2, 38116 Braun- schweig, [email protected] Redaktion: Hans-Martin Arnoldt, Gerstäckerstraße 8, 38102 Braun- schweig, [email protected] Günter Brombach, Heidelbergstraße 51, 38112 Braun- schweig, [email protected] Bernd Hermenau, Am Schwarzen Berge 57, 38112 Braun- schweig, Bernd.Hermenau@t-online. de Peter Velten, Im Mohngarten 10, 38162 Cremlingen, [email protected] Titelbild: Sumpfohreule in den Braunschweiger Rieselfeldern. Foto von David Taylor im Dezember 2011 Druck: Beyrich Digitaldruck Bültenweg 73, 38106 Braunschweig www.beyrich.de, [email protected] Bezug: Avifaunistische Arbeitsgemeinschaft Südostniedersachsen – AviSON. c/o Werner Oldekop, Bergiusstraße 2, 38116 Braun- schweig, [email protected] Preis: € 9,00 (zzgl. Porto) ISSN 2190-3808 Wir danken der Stadt Braunschweig, Abteilung Umweltschutz für einen Druckkostenzuschuss AVES Braunschweig 3 (2012) 1 Avifaunistischer Jahresrückblick auf 2011 für die Umgebung Braunschweigs von Helge -

2010 Für Den Kreis Celle Stabiler Paarbestand, Jungenrekord Und „Adi“ Als Übernachtungsgast in Eversen
Hans Jürgen Behrmann Weißstorchbetreuer für den Kreis Celle Altenceller Weg 58 - 29331 Lachendorf Telefon 05145-284289 und Fax 05145-278697 e-mail: [email protected] Weißstorchbericht 2010 für den Kreis Celle Stabiler Paarbestand, Jungenrekord und „Adi“ als Übernachtungsgast in Eversen 1. Jahresübersicht 2010 Sie müssen rechtzeitig, zahlreich und in guter Verfassung bei uns ankommen. In allen Phasen der Jungenaufzucht muss genügend Nahrung vorhanden sein. Von extremen Temperaturen, Unwettern und kaltem Dauerregen müssen sie verschont bleiben, ebenfalls von Unglücksfällen größeren Ausmaßes. Treffen alle diese Voraussetzungen und Bedingungen ein, dann kann es ein optimales Storchenjahr werden. 2010 war so ein optimales Storchenjahr – nicht nur im Kreis Celle, sondern weitgehend im ge- samten nordwestdeutschen Raum und auch in den angrenzenden neuen Bundesländern. Zeitige Ankunft von West- und Ostziehern - Zahl der Paare bleibt mit elf konstant - Fast durchgehend gute Nahrungsbedingungen in der Brutzeit – Insgesamt vierundzwanzig Junge werden flügge- Rätselhafte Jungenverletzungen im Nest - Zusammensetzung von Storchentrupps - „Adi“ als Übernachtungsgast in Eversen Zeitige Ankunft von West- und Ostziehern Die Faustregel lautet: Je zeitiger die Ankunft, desto größer die Aussicht auf eine erfolgreiche Storchenbrut. Nach dem 1.Mai wird die Chance von Tag zu Tag geringer. Im Kreis Celle sind etwa ein 40% aller Weißstörche Westzieher und 60% Ostzieher. Die Westzieher erschienen wie gewohnt ab Ende Februar. Bereits ab dem 24.März trafen dann die ersten Ostzieher ein. Mitte April waren elf Nester besetzt - zeitiger als in vielen Jahren zuvor und somit eine gute Voraussetzung für ein erfolgreiches Storchenjahr. Zahl der Paare bleibt mit elf konstant Alle elf Paare –und damit eins weniger als im Vorjahr- schritten zur Brut. -

Herzogin Clara – Eine Frau an Der Schwelle Zur Neuzeit
Herzogin Clara – eine Frau an der Schwelle zur Neuzeit Clara war eine starke und kluge Frau im ausklingenden Mittelalter – ein Kind der Erneuerung. Etwa 1521, zu Beginn der Reformation, wurde sie als Tochter des Herzogs zu Sachsen-Lauenburg geboren. Es war ein katholisches Stift, in dem sie Lesen und Schreiben, Handarbeit und Haushaltsführung lernte und sich mit Heilkräutern vertraut machte. Im Alter von 15 Jahren wurde sie aus machtpolitischen Erwägungen mit Herzog Franz von Braunschweig-Lüneburg verlobt. Nachdem ihre Familie zum Protestan- tismus übergetreten war, zog sie zu ihrer Schwester Dorothea an den dänischen Königshof, um die Grundsätze des neuen Glaubens kennenzulernen. Nach fast 11 Jahren Verlobungszeit heirateten Clara und Franz. Das Schloss in Gifhorn wurde zur fürstlichen Residenz des Herzogtums Gifhorn. Das Volk schätzte Clara als mildtätige Landesmutter. Als zwei Jahre später Franz mit nur 41 Jahren starb, blieb sie als Witwe mit zwei Töchtern zurück. Aufgrund der Erbfolgeregeln der Welfen fiel das Herzogtum ohne männlichen Stammhalter zurück an das Celler Stammhaus. Clara musste das Schloss verlassen und in Fallersleben ihren Witwensitz beziehen. Dank eines Ehevertrages konnte sie Einkünfte aus Gütern beziehen und Herrschaftsgewalt ausüben. Trotz Vormund blieb sie eine souveräne Frau, die sich mit Hilfe ihrer einflussrei- chen Familie durchsetzen konnte. Bis zu ihrem Tod im Jahre 1576 wirkte sie sozial und verhalf dem Flecken Fallersleben zu wirtschaftlichem Aufschwung. Herzogin Clara Geburt ClaraErziehung VerlobungHöfische Franz Bildung HochzeitGeburt FranzTod Katharina FranzGeburtWitwenschaft Clara II Tod Clara ca. 1521 1528 1536 1547 1548 1549 1550 1550 1576 Augustinerinnenstift Schloss Schloss Barth Steterburg Gifhorn Fallersleben Hof König Lauenburg von Dänemark 1 AllerHoheit – Auf den Spuren der Welfenherzogin Clara Liebe Radfahrerin, lieber Radfahrer, auf diesem Teilstück des Aller-Radweges, den Sie sich für Ihre Tour ausgewählt haben, steht eine überaus bemerkenswerte Frau ihm Mittelpunkt: Herzogin Clara von Braunschweig-Lüneburg, geb. -

Allertal Zwischen Gifhorn Und Wolfsburg“ in D
ABL Nr. 10/2014 A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES Verordnung über das Naturschutzgebiet "Allertal zwischen Gifhorn und Wolfsburg“ in der Stadt Gifhorn, der Gemeinde Sassenburg und den Samtgemeinden Boldecker Land und Isenbüttel, Landkreis Gifhorn sowie in der Stadt Wolfsburg vom 08.09.2014 Aufgrund der §§ 23, 32 und 33 BNatSchG vom 29.07.2009 (BGBl. Ι Nr. 51) in Verbindung mit § 16 NAGBNatSchG vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) wird verordnet: § 1 Naturschutzgebiet (1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet (NSG) "Allertal zwischen Gifhorn und Wolfsburg“ erklärt. (2) Das NSG liegt im Landkreis Gifhorn und in der Stadt Wolfsburg. Im Bereich des Landkreises Gifhorn befindet es sich in der Stadt Gifhorn, der Gemeinde Sassenburg, den Gemeinden Osloß und Weyhausen, Samtgemeinde Boldecker Land und der Gemeinde Calberlah, Samtgemeinde Isenbüttel. (3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgeblichen Karte im Maßstab 1 : 5.000 und aus der mit veröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25.000 (Anlagen). 1 Sie verläuft auf der Innenseite des dort dargestellten grauen Rasterbandes. Im Bereich des Maikampsees (Karte 1 Blatt 1) ist die dem See abgewandte Seite des Uferrandweges die NSG-Grenze. Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie können von jedermann während der Dienststunden bei der Stadt Gifhorn, den Gemeinden Sassenburg, Osloß, Weyhausen und Calberlah, den Samtgemeinden Boldecker Land und Isenbüttel sowie dem LK Gifhorn – Untere Naturschutzbehörde – und bei der Stadt Wolfsburg – Untere Naturschutzbehörde - unentgeltlich eingesehen werden. (4) Das NSG „Allertal zwischen Gifhorn und Wolfsburg“ liegt im Fauna-Flora- Habitat-(FFH-)Gebiet „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker“ sowie östlich des Elbe-Seitenkanals im EU-Vogelschutzgebiet „Barnbruch“. -
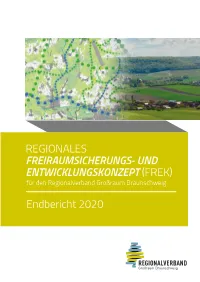
2020 12 FREK Endbericht.Pdf
REGIONALES FREIRAUMSICHERUNGS- UND ENTWICKLUNGSKONZEPT (FREK) für den Regionalverband Großraum Braunschweig Endbericht 2020 Planungsgruppe Umwelt Herausgeber Regionalverband Großraum Braunschweig Frankfurter Straße 2 38112 Braunschweig Koordination: Dipl.-Ing André Menzel Bearbeitung Planungsgruppe Umwelt Stiftstraße 12 30159 Hannover Projektleitung: Dipl.-Ing. Dietrich Kraetzschmer Bearbeiter*innen: M. Sc. Anika Flörke Dipl.-Ing. Dietrich Kraetzschmer Dipl.-Geogr. Jan-Christoph Sicard BTE Tourismusmanagement Regionalentwicklung Stiftstraße 12 30159 Hannover Bearbeiterin: Dipl.-Ing. Ulrike Franke KoRiS Kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung Bödekerstraße 11 30161 Hannover Bearbeiter*innen: Dipl.-Ing. Dieter Frauenholz Hannover, im Dezember 2020 I Planungsgruppe Umwelt Inhalt Verzeichnisse ............................................................................................................. IV 1. Aufgabenstellung des Fachbeitrags .......................................................... 1 1.1 Aufgabenstellung ......................................................................................... 1 1.2 Genereller Handlungsauftrag und inhaltliche Schwerpunkte der regionalen Freiraumentwicklung ................................................................... 2 1.3 Arbeitsschritte und inhaltliche Schwerpunkte des FREK 3.0 ......................... 5 1.4 Informationsgrundlagen des FREK 3.0 und Vorgehen bei der Entwicklung der Flächenkulissen .................................................................. 9 1.4.1 Informationsgrundlagen -

20200723 Abwägungstabelle Barnbruch Wald Prüfung Durch 30 Ausstehend.Xlsx
Nr. Nr.2 Sachargument Abwägung Änderung Einwender Sachargumente der TÖBs Allgemein: Fehlende Gespräche im Vorfeld der Dem Einwand wird nicht gefolgt. Anglerverband T 1 Schutzgebietsverordnung werden kritisiert. Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung, entsprechende Vorab-Gespräche zu führen, so dass der Verzicht auf entsprechende Niedersachsen e.V. Gespräche keinen Verfahrensfehler darstellt. Organisierte Angelveranstaltungen seien von den Dem Einwand wird nicht gefolgt. Anglerverband T 2 Verboten freizustellen. Tätigkeiten im Rahmen der ordnungsgemäßen fischereilichen Bewirtschaftung stellen keine organisierten Veranstaltungen im Niedersachsen e.V. Sinne des § 3 (2) Nr. 7 dar. Gleiches gilt für Aktivitäten im Rahmen des Jagdbetriebes. Das Einbringen von Futtermitteln zum Anfüttern im Dem Einwand wird nicht gefolgt. Anglerverband Rahmen des Angelbetriebes sei freizustellen, da der Das Einbringen von Futtermitteln verändert die Wassereigenschaften und damit die Lebensraum- und Habitatbedingungen und Niedersachsen e.V. T 3 Angelbetrieb den Gewässern mehr als doppelt so viele fördert alle Wassertiere, wodurch ein Nachteil für die besonders schützenswerten Arten gegenüber anderen Arten durch die Nährstoffe entziehe wie sie eingebracht würden. Besetzung ökologischer Nischen zu befürchten ist (vgl. NuR 2020-42 S. 136-140 zum Urteil des VGH München vom 1.10.2019- 14 N 18.389) Das pauschale Verbot, feste Angelplätze einzurichten Dem Einwand wird nicht gefolgt. Anglerverband und neue Pfade zu schaffen, werde abgelehnt. Entgegen der Aussage des Einwendenden beziehen sich die Regelungen nicht auf "feste" sondern auf "befestigte" Angelplätze, Niedersachsen e.V. Stattdessen sollte im Rahmen der Managementplanung so dass sie als hinreichend bestimmt einzustufen sind. Der Begriff "neuer Pfad" ist hinreichend bestimmt, da ein "Pfad" nur ein Konzept entwickelt werden. vorliegen kann, wenn dort eine wiederholte und regelmäßige Nutzung erfolgt. -

Der Drömling-Bote Weihnachten 2018
Der Drömling-Bote Weihnachten 2018 2 © rrice - stock.adobe.com Liebe Leserinnen, lieber Leser, Der verkaufsoffene Sonntag, mit bestem Herbstwetter, attraktivem Rahmenprogramm Sie halten die 51. Jahreschronik der Vorsfelder und tollen Angeboten der Geschäftswelt sorgte Vereinswelt und der Institutionen unserer Hei- für reichlich Andrang. matstadt in Händen. Sehr viel Wissenswertes Dazu kommen die vielen kleinen und großen über das Jahr 2018 und selbstverständlich Veranstaltungen der Vorsfelder Vereinswelt, auch Ausblicke auf das kommende Jahr sind die wir tatkräftig begleitet haben. in dieser Ausgabe miteinander verbunden. Und mittlerweile werfen die Vorbereitung für die Drömlingmesse 2019 ihre Schatten voraus. Wieder einmal war der Jahresverlauf 2018 Darum allen Organisatoren und Mitstreitern geprägt von den Herausforderungen einer von uns ein herzliches Dankeschön für die neuen Zeit. Die zunehmende Digitalisierung, geleistete Arbeit, ohne die das Alles nicht zu Fluch und Segen für unsere Gesellschaft, muss realisieren ist. beherrscht werden. Dringt sie doch immer tiefer in die Privatsphäre der Bevölkerung ein. Zum winterlichen Abschluss des Jahres steht Intelligente Verkehrskonzepte sind notwendig, unser kleiner Weihnachtsmarkt am Uetschen- wollen wir den Kollaps unseres Individualver- paul auf dem Programm. Gute Gespräche kehrs vermeiden. Die E-Mobilität schafft nach Feierabend lassen sich hier wunderbar neue, infrastrukturelle Anforderungen. Diese führen, das Ganze illuminiert durch die fest- Beispiele, stellvertretend für eine Vielzahl von liche Weihnachtsbeleuchtung der Vorsfelder notwendigen Maßnahmen, um unsere Stadt Innenstadt. Und täglich präsentieren sich die und unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu ma- Vorsfelder Vereine mit ihren Mitgliedern und chen, fordert alle Beteiligten. Ob die Stadt, die sorgen gleichzeitig für Belebung der weih- Unternehmen, Investoren und Konsumenten. nachtlichen Szene. Wir sind gespannt und schauen optimistisch in die Zukunft! Lassen Sie sich verzaubern und genießen Sie das Ambiente des Vorsfelder Weihnachtsmarktes. -

Zustand Von Lebensraumtypen Am Beispiel Der Allerniederung
Braunschweiger Geobotanische Arbeiten 11: 61–75, März 2015 Pflanzen als Zeiger für die Verbreitung und den Erhaltungs- zustand von Lebensraumtypen am Beispiel der Allerniederung Thomas Kaiser Herrn Prof. Dr. Dietmar Brandes zum 65. Geburtstag gewidmet. Zusammenfassung Floristische Erhebungen im Rahmen der Basiserfassung für das FFH-Gebiet „Aller (mit Barnbruch), untere Oker, untere Leine“ werden exemplarisch zur Charakterisierung der Verbreitung und des Erhaltungszustandes von Lebensraumtypen als Beispiel für die Vegetationsökologie linearer Strukturen analysiert. Großlaichkräuter wie Potamogeton lucens und P. perfoliatus traten bis vor kurzem in der Aller fast nur oberhalb von Langlingen auf. Das Fehlen in anderen Abschnitten war vermutlich ein Ergebnis mangelnder Sohlenstabilität und Wasserqualität im Fließgewässer. Zahlreiche Altgewässer unter anderem mit Stratiotes aloides begleiten den Fluss. Für die uferbegleiten- den Staudenfluren sind Veronica maritima, Thalictrum flavum und Angelica archangelica typisch. Insbesondere die zuerst genannte Art ist in der Lage, über die Verbreitung von Diasporen mit dem Hochwasser neue Standorte in der Aue schnell zu besiedeln. Impatiens glandulifera zeigt an der unteren Oker starke Ausbreitungstendenzen. Besonders kennzeichnend für die Mähwiesen ist Centaurea jacea, die vor allem an der Unteraller verbreitet ist. Sandtrockenrasen haben ihren Verbreitungsschwerpunkt in den Landkreisen Heidekreis und Celle. Unter den kennzeichnenden Arten der Auenwälder ist das Verbreitungsareal von Stellaria nemorum besonders erwähnenswert, weil diese Sippe nur im Mündungsbereich der Lachte bei Celle vorkommt. Abstract Plants inform about the distribution and the conservation status of habitats at the Aller lowland The floristical inventory of the SAC „Aller (mit Barnbruch), untere Oker, untere Leine“ informs about the distribution and the conservation status of habitats as an example of the vegetation ecology of linear textures. -

Entwurf Stand: 12.10.2020 Begründung Zur
Anlage 3 Entwurf Stand: 12.10.2020 Begründung zur Neufassung der Verordnung für das NSG Barnbruch Wald Begründung zur Naturschutzgebietsverordnung „Barnbruch Wald“ In der Begründung wird eine Auswahl der Neuregelungen in der Verordnung erläutert, die über den Verordnungstext hinaus einer Ausführung bedürfen. Zur Präambel: Die „Richtlinie über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten“ (EU-Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG des Rates vom 30. November 2009), deren erste Fassung bereits 1979 erlassen wurde, ist das Instru- ment der Europäischen Gemeinschaft, um die Vogelarten Europas in ihrer Gesamtheit als Teil der eu- ropäischen Artenvielfalt zu schützen. Ziel dieser Richtlinie ist, sämtliche in der Gemeinschaft heimischen wild lebenden Vogelarten in ihren natürlichen Verbreitungsgebieten und Lebensräumen zu erhalten. Dazu werden nach Artikel 3 und 4 der EU-Vogelschutzrichtlinie EU-Vogelschutzgebiete eingerichtet. Gemeinsam mit den nach der Fauna-Flora-Habitat(FFH-)Richtlinie ausgewiesenen FFH-Gebieten zum Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumtypen bilden die EU-Vogelschutzgebiete das europaweite Schutzgebietsnetz „Natura 2000“. Im Zuge der Umsetzung der Vogelschutz-Richtlinie und der FFH-Richtlinie sind die unteren Naturschutzbehörden verpflichtet, die von der EU anerkannten Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären (§ 32 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)) und in einem für den Schutzzweck günstigen Zustand zu erhalten. Durch geeignete Ge- und Verbote sowie Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ist sicher- zustellen, dass den Anforderungen der Vogelschutz-Richtlinie und der FFH-Richtlinie entsprochen wird (§ 32 Abs. 3 BNatSchG). Die Erklärung der Natura 2000-Gebiete zu einem geschützten Teil von Natur und Landschaft gemäß § 22 BNatSchG und hier konkret durch die Sicherung als Naturschutzgebiet (NSG) gemäß § 23 BNatSchG in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 Abs.1 Nds. -

Amtsblatt Für Den Landkreis Gifhorn
Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn XXXVII. Jahrgang Nr. 9 Ausgegeben in Gifhorn am 30.09.10 Inhaltsverzeichnis Seite A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 2. Satzung zur Änderung der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Gifhorn vom 14.12.2007 347 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) vom 16.12.2005 347 9. Änderung der Anlage zur Rettungsdienst- 348 Gebührensatzung vom 27.09.1995, in Kraft Getreten am 01.10.1995 Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschafts- schutzgebiet „Allertal-Barnbruch und angrenzende Landschaftsteile“ 348 Verordnung über die Festsetzung des Überschwemmungsgebietes der Aller im Bereich Gifhorn von der Osttangente Gifhorn (K 114) bis zum Pegel Brennecken- brück und der Ise von der B 188 am Mühlenmuseum bis zur Mündung in die Aller im Stadtgebiet Gifhorn (ÜSG-VO Aller-Ise) 349 B. BEKANNTMACHUNGEN DER STÄDTE, GEMEINDEN UND SAMTGEMEINDEN STADT GIFHORN - - - STADT WITTINGEN - - - GEMEINDE SASSENBURG Bebauungsplan „Grundschule Westerbeck“ 351 Herausgeber: Landkreis Gifhorn, Postfach 13 60, 38516 Gifhorn, Ruf (05371) 820 345 ABL Nr. 9/2010 SAMTGEMEINDE BOLDECKER LAND Gemeinde Weyhausen 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 352 SAMTGEMEINDE BROME Gemeinde Ehra-Lessien Bebauungsplan Grundfeld, II. Abschnitt, Neufassung für den Teilbereich westlich der Straße Grundfeld im Ortsteil Lessien 353 SAMTGEMEINDE HANKENSBÜTTEL - - - SAMTGEMEINDE ISENBÜTTEL - - - SAMTGEMEINDE MEINERSEN Gemeinde Meinersen Bebauungsplan „Ahleken II“ mit ÖBV, 2. Änderung, im Gemeindeteil Seershausen 353 Satzung über die Festlegung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles im Gemeindeteil Ahnsen (Erweiterung der bestehenden Satzung Müdener Straße/ Okerring) 354 SAMTGEMEINDE PAPENTEICH - - - SAMTGEMEINDE WESENDORF - - - C. BEKANNTMACHUNGEN DER ZWECKVERBÄNDE - - - D. SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN - - - 346 ABL Nr. 9/2010 A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 2.