Allertal Zwischen Gifhorn Und Wolfsburg“ in D
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
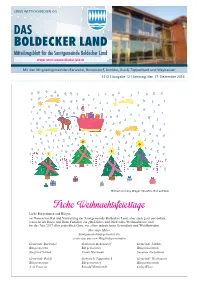
Frohe Weihnachtsfeiertage
LINUS WITTICH MEDIEN KG DAS BOLDECKER LAND Mitteilungsblatt für die Samtgemeinde Boldecker Land ePaper unter: www.boldecker-land.de Mit den Mitgliedsgemeinden Barwedel, Bokensdorf, Jembke, Osloß, Tappenbeck und Weyhausen 5312 | Ausgabe 12 | Samstag, den 17. Dezember 2016 Gemalt von Leny Dreger (10 Jahre, Hort Jembke) Frohe Weihnachtsfeiertage Liebe Bürgerinnen und Bürger, im Namen von Rat und Verwaltung der Samtgemeinde Boldecker Land, aber auch ganz persönlich, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein glückliches und friedvolles Weihnachtsfest und für das Jahr 2017 alles erdenklich Gute, vor allem jedoch beste Gesundheit und Wohlbefi nden. Ihre Anja Meier Samtgemeindebürgermeisterin sowie aus unseren Mitgliedsgemeinden Gemeinde Barwedel Gemeinde Bokensdorf Gemeinde Jembke Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeisterin Siegfried Schink Frank Niermann Susanne Ziegenbein Gemeinde Osloß Gemeinde Tappenbeck Gemeinde Weyhausen Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeisterin Axel Passeier Ronald Mittelstädt Gaby Klose Boldecker Land – 2 – Nr. 12/2016 Aus der Samtgemeinde ❱〉 28 Hort-Kinder malten um die Wette: Erste Weihnachtsbilder-Ausstellung im Rathaus des Boldecker Landes Das Thema war „Weihnachten“ - und der Kreati- vität waren keine Grenzen gesetzt. 28 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren in den Kinderhorten Jembke und Weyhausen griffen begeistert zu bunten Stiften und malten um die Wette, was ihnen dazu einfi el. Weih- nachtsbäume, Schlitten, Rentiere, Zuckerstan- gen, Geschenke und natürlich immer wieder den Weihnachtsmann. Zwei -

Bus Linie 146 Fahrpläne & Karten
Bus Linie 146 Fahrpläne & Netzkarten 146 Hillerse(Kr Gifhorn) Rathaus Im Website-Modus Anzeigen Die Bus Linie 146 (Hillerse(Kr Gifhorn) Rathaus) hat 7 Routen (1) Hillerse(kr Gifhorn) rathaus: 11:15 (2) Leiferde(kr Gifhorn) bahnhofstraße: 12:15 - 16:30 (3) Leiferde(kr Gifhorn) kampweg: 07:05 - 07:45 (4) Leiferde(kr Gifhorn) kampweg: 12:58 (5) Meinersen Schulzentrum: 06:56 (6) Meinersen Schulzentrum: 06:42 - 07:36 (7) Ohof Eltzer Straße: 12:20 - 15:30 Verwende Moovit, um die nächste Station der Bus Linie 146 zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste Bus Linie 146 kommt. Richtung: Hillerse(Kr Gifhorn) Rathaus Bus Linie 146 Fahrpläne 18 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Hillerse(kr Gifhorn) rathaus LINIENPLAN ANZEIGEN Montag Kein Betrieb Dienstag Kein Betrieb Meinersen Schulzentrum Mittwoch Kein Betrieb Meinersen Feldstraße Feldstraße 25, Meinersen Donnerstag 11:15 Meinersen Petersburg Freitag 11:15 Dalldorfer Straße 19, Meinersen Samstag Kein Betrieb Meinersen Schäferkamp Sonntag Kein Betrieb Dalldorfer Straße 35, Meinersen Meinersen Maschhop Maschhop 75a, Meinersen Bus Linie 146 Info Meinersen Dalldorf/Hühnerfarm Richtung: Hillerse(Kr Gifhorn) Rathaus Stationen: 18 Leiferde-Dalldorf Meinerser Straße Fahrtdauer: 39 Min Meinerser Straße 23, Germany Linien Informationen: Meinersen Schulzentrum, Meinersen Feldstraße, Meinersen Petersburg, Leiferde-Dalldorf Ortsmitte Meinersen Schäferkamp, Meinersen Maschhop, Hillerser Straße 8, Germany Meinersen Dalldorf/Hühnerfarm, Leiferde-Dalldorf Meinerser Straße, Leiferde-Dalldorf Ortsmitte, Leiferde(Kr -

Ausgabe Oktober 2015
VerlAg + Druck lINuS WITTIcH kg DAS BOLDECKER LAND Mitteilungsblatt für die Samtgemeinde Boldecker Land Mit den Mitgliedsgemeinden Barwedel, Bokensdorf, Jembke, Osloß, Tappenbeck und Weyhausen 5312 | Ausgabe 11/2015 | Samstag, den 17. Oktober 2015 Richtfest beim Mensa-Bau der Oberschule „Unsere Schule wird ein Schmuckstück“ Im Glas des Zimmer- manns-Gesellen war Mineralwasser statt Schnaps, wie es sich beim Richtfest in einer Schule gehört. Aber sonst hatte alles „seine Ordnung“, als Olaf Niemann den tra- ditionellen Richtspruch zum Bau der OBS- Mensa in Weyhausen hervorbrachte. Damit ist der erste Schritt zur Sanierung und Erweiterung der Oberschule getan und Rektorin Cornelia Hoff- mann ist ganz fest über- zeugt: „Unsere Schule wird ein Schmuckstück!“ Lesen Sie weiter auf Seite 4! - Anzeige - STEINSCHLAG? KEIN GRUND GLEICH ZU VERZWEIFELN! Scheiben-Doktor Wolfsburg Scheiben-Doktor Gifhorn STEINSCHLAGREPARATUR MOBILER SERVICE Dieselstraße 36 Braunschweiger Straße 9 38518 Wolfsburg 38518 Gifhorn AUTOGLAS-SOFORTEINBAU HOL- UND BRINGDIENST Telefon: 05361-85600 Telefon: 05371-941844 KFZ- UND GEBÄUDEFOLIEN KUNDENERSATZFAHRZEUG SCHEIBENVERSIEGELUNG VERSICHERUNGSPARTNER BoldeckerLand -2- Nr.11/2015 Anschrift Samtgemeindeverwaltung Sprechzeiten der Verwaltung: Mo., Di., Do.,Fr.09:00 –12:00 Uhr Eichenweg 1, 38554Weyhausen Di.14:00 -17:00 Uhr •Do. 14:00 –17:30 Uhr •Mittwoch geschlossen Telefon 05362/9781–0(Zentrale) Sprechzeiten der Gleichstellungsbeauftragten: Telefax 05362/9781–81(Obergeschoss) jeden 1. Do.imMonat 16:00 –17:30 Uhr sowienach Vereinbarung -

Mb60 Manzke.Pdf (6.564
Article, Published Version Manzke, Diethardt Erd- und grundbauliche Beratung beim Bau des Elbeseitenkanals Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Wasserbau Verfügbar unter/Available at: https://hdl.handle.net/20.500.11970/102883 Vorgeschlagene Zitierweise/Suggested citation: Manzke, Diethardt (1987): Erd- und grundbauliche Beratung beim Bau des Elbeseitenkanals. In: Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Wasserbau 60. Karlsruhe: Bundesanstalt für Wasserbau. S. 115-130. Standardnutzungsbedingungen/Terms of Use: Die Dokumente in HENRY stehen unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0, sofern keine abweichenden Nutzungsbedingungen getroffen wurden. Damit ist sowohl die kommerzielle Nutzung als auch das Teilen, die Weiterbearbeitung und Speicherung erlaubt. Das Verwenden und das Bearbeiten stehen unter der Bedingung der Namensnennung. Im Einzelfall kann eine restriktivere Lizenz gelten; dann gelten abweichend von den obigen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. Documents in HENRY are made available under the Creative Commons License CC BY 4.0, if no other license is applicable. Under CC BY 4.0 commercial use and sharing, remixing, transforming, and building upon the material of the work is permitted. In some cases a different, more restrictive license may apply; if applicable the terms of the restrictive license will be binding. Dipl.-Ing. Diethardt M a n z k e ERD- UND GRUNDBAULICHE BERATUNG BEIM BAU DES ELBESEITENKANALS Consultation on earthwork and foundation practice during the construction of the Elbe Lateral Canal Diethardt Manzke, Dipl.-Ing., Wissen schaftlicher Angestellter in der Bundes anstalt für Wasserbau (BAW). Geboren 1935. Studium des Bauingenieur wesens an der Technischen Hochschule Braunschweig von 1956 bis 1964. Seit 1966 in der Bundesanstalt für Wasserbau Außenstelle Küste und dort Sachbearbei-' ter im Referat Erd- ·und Grundbau. -

Interessenbekundung Breitbandausbau Im Landkreis
Nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren 1. Kommunale Gebietskörperschaft 1.1. Name, Adresse, Kontaktstelle Landkreis Gifhorn Fachbereich 1 – Zentrale Dienste Abteilung 1.4 – Finanzen und Wirtschaft Schlossplatz 1 38518 Gifhorn Herr Jens Wurthmann Telefon: 05371/ 82 479 Telefax: 05371/ 82 478 eMail: [email protected] 1.2. Verfahrensgrund/ Gegenstand des öffentlichen Interesses Schaffung einer zuverlässigen, kostengünstigen sowie technologisch nachhaltigen und skalierbaren Breitbandinfrastruktur in den nachfolgend benannten und nicht ausreichend versorgten Gebieten im Landkreis Gifhorn. 2. Gegenstand der Dienstleistung 2.1. Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Der Landkreis Gifhorn bittet um die Einreichung von Interessenbekundungen zur Schließung der bestehenden Breitband- Versorgungslücken. Es ist vorgesehen, die eingereichten Interessenbekundungen auszuwerten und als Grundlage für die erforderliche politische Entscheidung zu nutzen. Es handelt sich um ein nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren in Anlehnung an § 7 Abs. 2 (BHO) und keine Vorabinformation im Sinne der Richtlinie 18/2004/EG: Freiwillige Bekanntmachung zum Zwecke der Aufforderung zur Abgabe einer Interessenbekundung. 2.2. Kurze Beschreibung der Art und Menge oder des Wertes der Dienstleistungen Installation, bzw. Ausbau einer leitungsgebundenen und / oder nicht leitungsgebundenen Breitbandinfrastruktur nach der Richtlinie Breitbandversorgung (RdErl. d. ML. v. 26.6.2009 – VORIS 78350) in den Gebieten: 1 (a) Gemeinde Ribbesbüttel (Samtgemeinde -

Gemeinsam Für Unser Boldecker Land Liebe Bürger*Innen Des Boldecker Landes, Schule / Beruf
Gemeinsam für unser Boldecker Land Liebe Bürger*innen des Boldecker Landes, Schule / Beruf mein Name ist Ralf Prinke und ich möchte Ihr/ • Grundschule Osloß Euer Samtgemeinde-Bürgermeister werden. • Gymnasium Wolfsburg-Kreuzheide • Architektur-Studium TU Braunschweig Ich wurde 1961 in Osloß geboren und bin seit über 30 Jahren mit meiner Frau Petra verheiratet. Über 30 Jahre Berufserfahrung als selbstständiger Wir wohnen in Osloß und haben 3 erwachsene bzw. leitend angestellter Architekt. Kinder und eine Enkeltochter. Aktuell bin ich freiberuflich als Planer und Bau- Der Vorstand der SPD Boldecker Land träger für Ein- und Mehrfamilienhäuser tätig. Ralf Prinke hat mich im Dezember 2020 als Kandidat nominiert. Vor über 40 Jahren bin ich in die SPD eingetreten. Sie ist meine „politische Heimat“. Besonders schätze ich die gute Arbeit auf kom- munaler Ebene. Seit 2016 bin ich direkt gewähltes Mitglied des Samtgemeinderats und arbeite im Haushalts- und Finanzausschuss sowie im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss. Ihr/Euer Ehrenamt Kommunalwahl 12.9.21 • Seit 16 Jahren 1. Vorsitzender und Platzwart des Reitvereins Osloß • 20 Jahre aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr Ihr SPD-Kandidat als Dienstgrad: Oberlöschmeister • Ehrenmitglied des SV Osloß und aktiv beim Samtgemeinde-Bürgermeister Training der Alten Herren im Boldecker Land • Vorträge zur Dorfgeschichte, Umwelttage, Beach-Soccer, Dorffeste, Kirchenjugend Sie haben Fragen, Anregungen, Kritik? Meine politischen Ziele mit der SPD Bitte sprechen Sie mich gerne an: A Kitas (aktuell fehlen ca. 250 -

Metropolregion Hannover – Braunschweig – Göttingen – Wolfsburg
Metropolregion Hannover – Braunschweig – Göttingen – Wolfsburg Ausgewählte erste Ergebnisse des Zensus vom 9. Mai 2011 Metropolregion Hannover – Braunschweig – Göttingen – Wolfsburg Ausgewählte erste Ergebnisse des Zensus vom 9. Mai 2011 Impressum Metropolregion Hannover – Braunschweig – Göttingen – Wolfsburg Ausgewählte erste Ergebnisse des Zensus vom 9. Mai 2011 ISSN 2197-6295 Herausgeber: Statistisches Landesamt Bremen Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern Landesamt für Statistik Niedersachsen Herstellung und Redaktion: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) Postfach 91 07 64 30427 Hannover Telefon: 0511 9898-0 Fax: 0511 9898-4132 E-Mail: [email protected] Internet: www.statistik.niedersachsen.de Auskünfte: Landesamt für Statistik Niedersachsen Telefon: 0511 9898 - 1132 0511 9898 - 1134 Fax: 0511 9898 - 4132 E-Mail: [email protected] Internet: www.statistik.niedersachsen.de Download als PDF unter: http://www.statistik.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=25706&article_id=118375&_psmand=40 Zu den norddeutschen Metropolregionen erscheinen folgende vergleichbare Broschüren: Metropolregion Hamburg. Ausgewählte erste Ergebnisse des Zensus vom 9. Mai 2011 Metropolregion Bremen-Oldenburg. Ausgewählte erste Ergebnisse des Zensus vom 9. Mai 2011 Titelbilder: Oben rechts: Fotograf: Zeppelin, Some rights reserved. Quelle: www.piqs.de Oben links: Fotograf: Ilagam, Some rights reserved. Quelle: www.piqs.de Unten rechts: Fotograf: Daniel Schwen, -

DAS BOLDECKER LAND Mitteilungsblatt Für Die Samtgemeinde Boldecker Land Epaper Unter: Archiv.Wittich.De/5312
LINUS WITTICH Medien KG DAS BOLDECKER LAND Mitteilungsblatt für die Samtgemeinde Boldecker Land ePaper unter: archiv.wittich.de/5312 Post aktuell an alle Mit den Mitgliedsgemeinden Barwedel, Bokensdorf, Jembke, Osloß, Tappenbeck und Weyhausen Haushalte 5312 /Jahrgang 13 | Ausgabe 07 | Samstag, den 17. Juli 2021 Liebe Bürgerinnen und Bürger, im Namen von Rat und Verwaltung, aber auch ganz persönlich, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame Urlaubs- und Sommertage. Genießen Sie die Abwechslung vom Alltag, passen Sie gut auf sich auf und vor allem, kommen Sie gesund nach Hause zurück. Mit herzlichen Grüßen Ihre Anja Meier Samtgemeindebürgermeisterin sowie aus unseren Mitgliedsgemeinden Bürgermeister Siegfried Schink Bürgermeister Axel Passeier Gemeinde Barwedel Gemeinde Osloß Bürgermeisterin Jennifer Georg Bürgermeister Ronald Mittelstädt Gemeinde Bokensdorf Gemeinde Tappenbeck Bürgermeisterin Susanne Ziegenbein Bürgermeisterin Gaby Klose Gemeinde Jembke Gemeinde Weyhausen Boldecker Land – 2 – Nr. 07/2021 Liebe Leserinnen, liebe Leser, in wenigen Tagen beginnen die Unsere Senioren*innen können Sommerferien und der Werks- sich nun endlich wieder in Prä- urlaub. Zeit, die Sommer- und senz treffen. Es tut wirklich gut, Urlaubstage zu genießen. Viele die lieb gewonnenen Treffen un- von uns werden aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte verrei- serer „Generation 60Plus“ wie- sen, um abzuschalten, um sich der veranstalten zu dürfen. zu erholen und die Seele bau- Während der Ferienzeit wird meln zu lassen. unser Bauamt tatkräftig im Unsere Schulabgänger*innen Einsatz sein, um die Moderni- haben ihre Schulzeit erfolgreich sierungsoffensive in den Grund- beendet, sie starten gut aus- schulen umzusetzen. Außerdem gebildet in eine neue Lebens- phase. Ich wünsche ihnen viel wird die Schaffung von weiteren Erfolg dabei. Betreuungsplätzen im Kita-Be- Für unsere Kinder und Jugend- reich mit Hochdruck verfolgt. -

Commission Decision of 10 January 2011 Adopting, Pursuant to Council
L 33/52 EN Official Journal of the European Union 8.2.2011 COMMISSION DECISION of 10 January 2011 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, a fourth updated list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region (notified under document C(2010) 9666) (2011/63/EU) THE EUROPEAN COMMISSION, (5) On the one hand, the fourth update of the list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region is necessary in order to include additional sites Having regard to the Treaty on the Functioning of the European that have been proposed since 2008 by the Member Union, States as sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC. The obligations Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 resulting from Articles 4(4) and 6(1) of Directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and 92/43/EEC are applicable as soon as possible and flora ( 1), and in particular the third subparagraph of Article 4(2) within six years at most from the adoption of the thereof, fourth updated list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region. Whereas: (6) On the other hand, the fourth update of the list of sites of Community importance for the Atlantic biogeo (1) The Atlantic biogeographical region referred to in graphical region is necessary in order to reflect any Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the changes in site related information submitted by the territories of Ireland, the Netherlands and the United Member States following the adoption of the initial and Kingdom, and parts of Belgium, Denmark, France, the first three updated Community lists. -

Niedersächsisches Justizministerium
Neuwerk (zu Hamburg) Bezirk des Oberlandesgerichts und der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein Celle Balje Krummen- Flecken deich Freiburg - Organisation der ordentlichen Gerichte Nordkehdingen (Elbe) CUXHAVEN OTTERNDORF Belum und Staatsanwaltschaften - Flecken Neuhaus Geversdorf Oederquart (Oste) Neuen- Minsener Oog Cadenberge kirchen Oster- Wisch- Nordleda bruch hafen Stand: 1. September 2015 BülkauAm Dobrock Oberndorf Mellum Land Hadeln Wurster Nordseeküste Ihlienworth Wingst Wanna Osten Drochtersen Odis- Hemmoor heim HEMMOOR Großenwörden Steinau Stinstedt Mittelsten- Engelschoff ahe Hansestadt GEESTLAND Lamstedt Hechthausen STADE Börde Lamstedt Himmel- Burweg pforten Hammah Kranen-Oldendorf-Himmelpforten Hollern- burg Düden- Twielenfleth Armstorf Hollnseth büttel WILHELMS- Oldendorf Grünen- (Stade) Stade Stein-deich Fries- Bremer- kirchen HAVEN Cuxhaven Estorf Heinbockel Agathen- Hamburg (Stade) burg Lühe Alfstedt Mitteln- Butjadingen haven (Geestequelle) Guder- kirchen hand- Schiffdorf Dollern viertel (zu Bremen) Ebersdorf Neuen- Fredenbeck Horneburg kirchen Jork Deinste (Lühe) Flecken Hipstedt Fredenbeck Horneburg NORDENHAM Geestequelle Nottens- BREMERVÖRDE Kutenholz dorf Mecklenburg-Vorpommern Bargstedt Oerel Blieders- dorf BUXTEHUDE Loxstedt Flecken Farven Harsefeld Basdahl Beverstedt Apensen Brest Neu Wulmstorf Harsefeld (Harburg) land Stadland Deinstedt Apensen Drage Marschacht Beckdorf Moisburg Sandbostel Rosengarten Elbmarsch Anderlingen Seevetal VAREL Ahlerstedt Reges- Appel Tespe Sauensiek bostel Stelle Gnarrenburg -

Wendschotter Und Vorsfelder Drömling Mit Kötherwiesen“ Auswertung Der Beteiligung Der Träger Öffentlicher Belange (TÖB-Beteiligung)
Neuausweisung und Erweiterung NSG „Wendschotter und Vorsfelder Drömling mit Kötherwiesen“ Auswertung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB-Beteiligung) Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Bearbeitungsvermerk Aller-Ohre-Verband / Unterhaltungsverband Oberaller vom 12.7.19: Folgende Punkte bitte ich Sie, herauszunehmen bzw. zu ergänzen: => der Einwand ist gegenstandslos, weil gem. § 4 (7) NSG-VO die ordnungs- §3 (2) 5. Verbote der Wasserfahrzeuge…. bitte ich zu ergänzen: „ ausgenom- gemäße Gewässerunterhaltung freigestellt ist, dazu gehört auch das Betreten men Fahrzeuge der Gewässerunterhaltung“. sowie das Befahren (u.a. mit Wasserfahrzeugen), daher ist weder eine Aus- §4 (2) c) Betreten und Befahren des Gebietes ist für die Aufgabenerledigung nahme in § 3 (2) 5. NSG-VO noch eine Ergänzung in § 4 (2) c) notwendig; zur des Verbandes jederzeit und kurzfristig für die Aufgabenwahrnehmung erforder- Klarstellung wurde ein entsprechenden Hinweis in die Begründung eingefügt lich. Ich bitte Sie, dies entsprechend zu ergänzen. §4 (7) bitte ich folgende nachstehende Vorgabe zu ändern: a) In „nur abschnittsweise oder einseitig“, wo möglich. => die Formulierung „wo möglich“ ist zu unkonkret (unbestimmter Rechtsbe- griff) Begründung: Der Steekgraben und die Wipperaller, um nur 2 Gewässer zu benennen, sind => m.E. sollte für das NSG ein Unterhaltungsrahmenplan aufgestellt werden, für den Wasserabfluss größerer Einzugsgebiete, insbesondere für die Abfüh- worin die konkreten Regelungen für einzelne Gewässerstrecken im Vorfeld im rung von Stark- und Hochwasserereignissen, von hervorgehobener Bedeutung. Einvernehmen mit der UNB festgelegt werden Die Abschnittsdefinition sollte nach den örtlichen Begebenheiten und Vegetati- => die Abschnittsdefinition nach den örtlichen Begebenheiten und Vegetati- onsbildern und nicht nach fixierten Längen in der zweiten Ordnung der Gewäs- onsbildern (wie vom AOV gefordert) bzw. -

Detaillierte Karte (PDF, 4,0 MB, Nicht
Neuwerk (zu Hamburg) Niedersachsen NORDSEE Schleswig-Holstein Organisation der ordentlichen Gerichte Balje Krummen- Flecken deich Freiburg Nordseebad Nordkehdingen (Elbe) Wangerooge CUXHAVEN OTTERNDORF Belum Spiekeroog Flecken und Staatsanwaltschaften Neuhaus Oederquart Langeoog (Oste) Cadenberge Minsener Oog Neuen- kirchen Oster- Wisch- Nordleda bruch Baltrum hafen NORDERNEY Bülkau Oberndorf Stand: 1. Juli 2017 Mellum Land Hadeln Wurster Nordseeküste Ihlienworth Wingst Osten Inselgemeinde Wanna Juist Drochtersen Odis- Hemmoor Neuharlingersiel heim HEMMOOR Großenwörden Steinau Hager- Werdum ESENS Stinstedt marsch Dornum Mittelsten- Memmert Wangerland Engelschoff Esens ahe Holtgast Hansestadt Stedesdorf BORKUM GEESTLAND Lamstedt Hechthausen STADE Flecken Börde Lamstedt Utarp Himmel- Hage Ochtersum Burweg pforten Hammah Moorweg Lütets- Hage Schwein- Lütje Hörn burg Berum- dorf Nenn- Wittmund Kranen-Oldendorf-Himmelpforten Hollern- bur NORDEN dorf Holtriem Dunum burg Düden- Twielenfleth Großheide Armstorf Hollnseth büttel Halbemond Wester- Neu- WITTMUND WILHELMS- Oldendorf Grünen- Blomberg holt schoo (Stade) Stade Stein-deich Fries- Bremer- kirchen Evers- HAVEN Cuxhaven Heinbockel Agathen- Leezdorf Estorf Hamburg Mecklenburg-Vorpommern meer JEVER (Stade) burg Lühe Osteel Alfstedt Mitteln- zum Landkreis Leer Butjadingen haven (Geestequelle) Guder- kirchen Flecken Rechts- hand- Marienhafe SCHORTENS upweg Schiffdorf Dollern viertel (zu Bremen) Ebersdorf Neuen- Brookmerland AURICH Fredenbeck Horneburg kirchen Jork Deinste (Lühe) Upgant- (Ostfriesland)