Vor Allem Torquato Tassos)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Unterhã¤Ndler Auslã¤Ndischer Dichterâ•Œ
pen Zeitschrift für Germanistik | Neue Folge XXIX (2019), Peter Lang, Bern | H. 2, S. 304–327 HÉCTOR CANAL „Unterhändler ausländischer Dichter“. Johann Diederich Gries’ Calderón-Übersetzungen I. Der Übersetzer Gries. Im Gegensatz zu anderen berühmten zeitgenössischen Übersetzern, wie August Wilhelm Schlegel oder Johann Heinrich Voß, machte Johann Diederich Gries (1775–1842) das Übersetzen zum (fast) ausschließlichen Gegenstand seines literarischen Schaffens. Sein Verzicht auf übersetzungstheoretische Ansprüche und sein spärlicher Um- gang mit Paratexten zu seinen Übersetzungen trugen trotz strenger und fundierter Kriterien sowie eines ausgesprochenen Sprachtalents zur stiefmütterlichen Behandlung Gries’ in der literaturwissenschaftlichen Forschung bei.1 Seine dichterische Produktion mit einem Übergewicht von Gelegenheitsgedichten, die, im Gegensatz etwa zu Friedrich und A. W. Schlegels Dichtungen,2 keine selbstreflexiven und avantgardistischen Ansprüche erhoben, stieß ebenfalls auf wenig Resonanz in der Forschung. Von seinen Zeitgenossen durchweg anerkannt, in seinen Anfängen von Wieland, Schiller oder A. W. Schlegel gefördert, später von Goethe gelobt,3 war Gries einer der wichtigsten Vermittler romanischer Literaturen und insbesondere des italienischen Epos im deutschsprachigen Raum. Seinen Ruf verdankte er zunächst den Übertragungen von Tasso4 und Ariosto5, die wiederaufgelegt (und nach- gedruckt!) wurden und zu kanonischen Versionen avancierten. Außerdem übersetzte er Fortiguerri6 und Boiardo7. Neben den italienischen Epen widmete sich Gries dem spanischen Theater. Seine Calderón-Übersetzungen,8 die sich im Lesekanon etablierten und bis ins 20. Jahrhundert abgedruckt wurden und als Vorlage für Theaterbearbeitungen dienten, stehen im Mittel- punkt dieses Beitrags. Er ist als archivalische Spurensuche durch den verstreuten Nachlass konzipiert, die Gries’ Netzwerke sichtbar werden lässt, und konzentriert sich aus Platz- und Zeitgründen auf die beiden ersten Stücke: Die Große Zenobia und Das Leben ein Traum. -

Alltägliches Leben
Quellen zur Geschichte Thüringens Alltägliches Leben „Gestern Abend schlief er auf dem Sofa ein ...“ Quellen zur Geschichte Thüringens „Gestern Abend schlief er auf dem Sofa ein ...“ Alltägliches Leben Herausgegeben von Heidi-Melanie Maier Titelabbildung: Journal des Luxus und der Moden. Titelzitat aus: Dorothea Michaelis-Veit-Schlegel an August Wil- helm Schlegel, 28. Oktober 1800 (Text 39). Text Rückseite: Friedrich Christian Laukhard: Bordelle in Halle, in: Friedrich Christian Laukhard: Leben und Schicksale; von ihm selbst beschrieben, und zur Warnung für Eltern und studierende Jünglinge herausgegeben. Halle 1792, 2. Theil, S. 119-120. Landeszentrale für politische Bildung Thüringen Regierungsstraße 73, 99084 Erfurt www.thueringen.de/de/lzt 2004 ISBN 3-931426-80-7 Inhalt Alltägliches Leben Inhalt Einführung Die „Künste der Geselligkeit zu lehren“ – Zwischen Alltag und Poesie . 13 Geselligkeit und Romantik . 15 Der Alltag romantischer Geselligkeit . 19 Prinzipien der Textauswahl und Textwiedergabe . 24 Alltag 1. Johann Christoph Adelung: Alltag . 27 2. Joachim Heinrich Campe: Der Alltag . 29 Thüringen 3. Fürstenthum Weimar, nebst der jenaischen Landesportion . 31 4. Fürstenthum Eisenach . 33 5. Herzogthum Gotha . 34 6. Fürstenthum Altenburg . 35 7. Grafschaft Schwarzburg . 36 8. Grafschaft Hohnstein . 37 9. Die Grafschaften Wernigerode und Stolberg . 38 10. Thüringen in Zahlen . 39 Häusliches Leben 11. Wie bey einer ungeschickten, säuischen und unordentlichen Hausfrau immer alles kränkelt und elend ist . 43 12. Herrn Flinks Haus- und Gesinde-Ordnung . 47 13. Caroline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling an Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer, 29. Juli 1792 . 52 14. Lebenshaltung in Jena 1798 . 58 15. A. W. Schlegels Kreis . 60 16. Ein Monat im Leben der Sophie Mereau-Brentano . 61 17. -

Katalog 39, Februar 2021
Antiquariat Schaper Dammtordamm 4 20354 Hamburg antiquariat-schaper.de [email protected] Telefon +49 (0)40 34 50 16 Mobil +49 (0)172 52 303 74 IMPRESSUM Antiquariat Dietrich und Brigitte Schaper oHG Dammtordamm 4 20354 Hamburg Deutschland Telefon +49 (0) 40 34 50 16 antiquariat-schaper.de [email protected] Handelsregister Hamburg: HRA 89388 UstID-Nr. DE 254 269 796 Mitglied im Verband deutscher Antiquare und der International League of Antiquarian Booksellers GESCHÄFTSBEDINGUNGEN Das Angebot des Kataloges ist freibleibend. Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des Einganges ausgeführt. Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Sendung besteht für uns die Verpflichtung zur Rücknahme, nicht aber zur Ersatzlieferung. Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer (7%). Eigentumsvorbehalt gemäß § 449 BGB bis zur vollständigen Bezahlung. Die Geschäftsbedingungen werden mit Aufgabe einer Bestellung anerkannt. Umschlagabbildungen: C[hristoffer] Suhr. Hamburgische Trachten, Seite 5 Hamburg, Februar 2021 SCHÖNE UND SELTENE BÜCHER KATALOG FEBRUAR 2021 Carl Lang. Kindestreue, Geschwister- liebe, Dankbarkeit und Edelmuth. In merkwürdigen Scenen aus der neuesten Zeitge- schichte. Ein Sittenspiegel für Deutschlands Jugend. Karl Tauchnitz, Leipzig [1806]. 15,5 x 10,5 cm. 8, 136 S. Mit 6 color. Kupfern nach franz. Originalen. Pappband der Zeit ( Einband beschabt. Rücken- und Deckelbezug fehlt stellenweise. Papier gebräunt und teils stockfleckig). Die hübschen Kupfer sauber. 220,00 € (1309) Biblia, Das ist:, Heilige Schrifft des Alten und Neuen Testaments. [...]. Samt einer Vorrede Herrn J. M. Dilherrns. Mit 6 gestochenen Zwischentiteln, 12 gestochenen Portraits und zahlreichen Textholzschnitten. 2 Teile in 1 Band. Johann Andreas Endter, Nürnberg 1755. 39,5 x 27 cm. 46 Blatt, 1.181 S., 11 Blatt. -
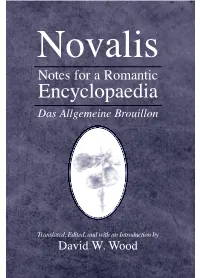
Notes for a Romantic Encyclopaedia Das Allgemeine Brouillon
Novalis Notes for a Romantic Encyclopaedia Das Allgemeine Brouillon Translated, Edited, and with an Introduction by David W. Wood Notes for a Romantic Encyclopaedia SUNY series, Intersections: Philosophy and Critical Theory Rodolphe Gasché, editor Notes for a Romantic Encyclopaedia Das Allgemeine Brouillon Novalis Translated, Edited, and with an Introduction by David W. Wood State University of New York Press Published by State University of New York Press, Albany © 2007 State University of New York All rights reserved Printed in the United States of America No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission. No part of this book may be stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means including electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior permission in writing of the publisher. For information, address State University of New York Press, 194 Washington Avenue, Suite 305, Albany, NY 12210-2384 Production by Judith Block Marketing by Michael Campochiaro Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Novalis, 1772–1801. [Allgemeine Brouillon. English] Notes for a Romantic Encyclopaedia : Das Allgemeine Brouillon / Novalis ; translated, edited, and with an introduction by David W. Wood. p. cm. — (SUNY series, intersections: philosophy and critical theory) Includes bibliographical references and index. Translation of: Das Allgemeine Brouillon : Materialien zur Enzyklopäedistik 1798/99. ISBN-13: 978-0-7914-6973-6 -

Wielands Autorität Bei Tasso-Übersetzern Um 1800
Dieter Martin Der „große Kenner der Deutschen Ottave Rime“ Wielands Autorität bei Tasso-Übersetzern um 1800 Vorblatt Publikation Erstpublikation: Wieland-Studien 3 (1996), 194–215. Neupublikation im Goethezeitportal Vorlage: Datei des Autors URL: <http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/wieland/martin_uebersetzer.pdf> Eingestellt am 08.04.2004 Autor PD Dr. Dieter Martin Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Deutsches Seminar II Institut für neuere deutsche Literatur 79085 Freiburg Emailadresse: <[email protected]> Homepage: <http://www.germanistik.uni-freiburg.de/ds2/persds2.php> Empfohlene Zitierweise Beim Zitieren empfehlen wir hinter den Titel das Datum der Einstellung oder des letzten Updates und nach der URL-Angabe das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse anzugeben: Dieter Martin: Der „große Kenner der Deutschen Ottave Rime“. Wielands Autorität bei Tasso-Übersetzern um 1800 (08.04.2004). In: Goethezeitportal. URL: <http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/wieland/martin_uebersetzer.pdf> (Datum Ihres letzten Besuches). Martin: Wielands Autorität bei Tasso-Übersetzern, S. 1 Dieter Martin Der „große Kenner der Deutschen Ottave Rime“ Wielands Autorität bei Tasso-Übersetzern um 1800 Christoph Martin Wielands literarisches Ansehen hat unter den Attacken der Brüder Schlegel nachhaltig gelitten. Das in den Jahren vor 1800 planmäßig durchgeführte „Autodafé über Wieland“ erschütterte seine Position auf dem deutschen Parnaß.1 Allerdings sollte die „Wielandische Hinrichtung“ in ihrer literarhistorischen Wirkung nicht überschätzt werden. Denn Wielands Wort zählt bei seinen romantischen Zeitgenossen mehr, als es die abschätzigen Urteile im ‘Athenaeum’ vermuten lassen. Dies zeigen wenig bekannte Quellen aus einem Gebiet, in dem Wielands Interesse mit dem der romantischen Generation zusammentrifft. Denn wie seine Shakespeare-Übersetzung den Übertragungen der Romantiker vorangeht, so antizipiert und beeinflußt Wieland auch die romantische Aneignung der großen italienischen Epen. -

NOVALIS Schriften
NOVALIS Schriften Die Werke von Friedrich von Hardenbergs Begründet von Paul Kluckhohn und Richard Samue Herausgegeben von RICHARD SAMUEL (f) in Zusammenarbeit mit HANS JOACHIM MÄI1L und GERHARD SCHULZ Historisch-kritische Ausgabe in vier Bänden, einem Materialienband und einem Ergänzungsband in vier Teilbänden mit dem dichterischen Jugendnachlaß und weiteren neu aufgetauchten Handschriften VKRLAG W. KOHLHAMMKR STUTTGART BKRLIN KÖLN 1998 NOVALIS Schriften VIERTER RAND Tagebücher, Briefwechsel, Zeitgenössische Zeugnisse Herausgegeben von RICHARD SAMUEL in Zusammenarbeit mit HANS JOACHIM MÄHE und GERHARD SCHULZ Mit einem Anhang Bibliographische Notizen und Bücherlisten bearbeitet von DIRK SCHRÖDER Zweite, unveränderte Auflage V KRLA(i W . KUHLHA MMER STUTTGART BERLIN KÖLN 1998 INHALT Einleitung von Richard Samuel I. Einführendes 1* II. Die landschaftliche Umgehung 4* III. Der gesellschaftliche Umkreis 6* 1. Familiensinn 6* 2. Das Elternhaus 7* 3. Tennstedt — Grüningen 10* 4. Freiberg und Dresden 17* 5. Aufklärung und Rokoko 22* 6. Weimar (Schiller, Goethe, Herder, Jean Paul) 24* 7. Romantiker 25* 8. Der Berufskreis 29* IV. Die Form der Briefe 32* V. Die Tagebücher 40* VI. Zeitgenössische Zeugnisse 43 VII. Hardenbergs äußere Erscheinung 43* Abteilung I: Tagebücher Die mit * bezeichneten Stücke der Abteilungen I—IV waren bisher ganz oder teil- weise unveröffentlicht. Nr. Titel Ort Datum Seite 1 Tagebuchblatt Weißenfels 1790 3 2 Abrechnung Weißenfels 1790, Herbst 4 3 Notiz Jena 1791 4 4 Reisejournal 1793,15.-19.4. 6 5 Tagebuchblatt Tennstedt 1794, Dez. 22 6 Klarisse Weißenfels 1796, Aug./Sept. 24 7 Kalendereintragungen 1797, Jan.—Apr. 26 8 Journal Tennstedt/ 1797,18.4.-6.7. 29 Grüningen 9 An Erasmus Weißenfels 1797,9. 8. 50 10 Betrachtung Freiberg 1798, Juli? 50 11 Notiz Weißenfels 1799, Juni 51 12 Notizen und Pläne Weißenfels 1799, August 52 13 Tagebuch Weißenfels 1800, 15.4.-6.9. -
The Habsburg Monarchy's Many-Languaged Soul. Translating
The Habsburg Monarchy’s Many-Languaged Soul Benjamins Translation Library (BTL) issn 0929-7316 The Benjamins Translation Library (BTL) aims to stimulate research and training in Translation & Interpreting Studies – taken very broadly to encompass the many different forms and manifestations of translational phenomena, among them cultural translation, localization, adaptation, literary translation, specialized translation, audiovisual translation, audio-description, transcreation, transediting, conference interpreting, and interpreting in community settings in the spoken and signed modalities. For an overview of all books published in this series, please see www.benjamins.com/catalog/btl EST Subseries The European Society for Translation Studies (EST) Subseries is a publication channel within the Library to optimize EST’s function as a forum for the translation and interpreting research community. It promotes new trends in research, gives more visibility to young scholars’ work, publicizes new research methods, makes available documents from EST, and reissues classical works in translation studies which do not exist in English or which are now out of print. General Editor Associate Editor Honorary Editor Yves Gambier Franz Pöchhacker Gideon Toury University of Turku University of Vienna Tel Aviv University Advisory Board Rosemary Arrojo Zuzana Jettmarová Şehnaz Tahir Gürçaglar Binghamton University Charles University of Prague Bogaziçi University Michael Cronin Alet Kruger Maria Tymoczko Dublin City University UNISA, South Africa University of Massachusetts Dirk Delabastita John Milton Amherst FUNDP (University of Namur) University of São Paulo Lawrence Venuti Daniel Gile Anthony Pym Temple University Université Paris 3 - Sorbonne Universitat Rovira i Virgili Michaela Wolf Nouvelle Rosa Rabadán University of Graz Amparo Hurtado Albir University of León Universitat Autònoma de Sherry Simon Barcelona Concordia University Volume 116 The Habsburg Monarchy’s Many-Languaged Soul. -
Metrik Und Nationalismus Im 19. Jahrhundert
pen Zeitschrift für Germanistik | Neue Folge XXIX (2019), Peter Lang, Bern | H. 2, S. 265–281 JOHANNES SCHMIDT Im Rhythmus der Nation? Metrik und Nationalismus im 19. Jahrhundert I. Metrik und nationale Tradition. Nachdem der zweite Band seiner Calderón-Übersetzung erschienen war,1 bekam Johann Diederich Gries (1775–1842) einen Brief von seinem guten Freund Johann Georg Rist (1775–1847), der einige Zeit in Spanien verbracht hatte und für den Übersetzer wegen der so erworbenen Sprachkenntnisse eine wichtige Beurteilungsin- stanz darstellte. Rist lobte die Übersetzung im Allgemeinen, kritisierte aber die vierhebi- gen Trochäen, die Gries für sie gewählt hatte, weil es sich bei ihnen um „kein deutsches“ Versmaß handelte.2 Der Übersetzer konterte den Vorwurf mit einer kleinen Genealogie der gängigsten Versarten: Aber welches ist, möchte ich nun fragen, das ursprünglich deutsche Versmaß, dessen man sich unbedenklich bedienen kann und soll? Dies möchte wol schwerlich auszumachen sein, wenn man auch bis in die älteste Zeit der deutschen Poesie zurückgehen wollte. Ob das Versmaß des „Niebelungenliedes“ ursprünglich deutsch sei, darüber lassen sich bedeutende Zweifel erheben, die Minnesänger borgten ihre Versmaße bekanntlich von den Provenzalen. Die leidigen Alexan- driner haben wir von den Franzosen bekommen, die fünffüßigen Jamben von den Italienern und Engländern, die Hexameter und andere antike Metra von den Griechen und Römern. Warum sollten wir uns denn weigern, die vierfüßigen Trochäen von den Spaniern anzunehmen? Aber wir brauchen deswegen -

The Life of August Wilhelm Schlegel, Cosmopolitan of Art and Poetry
The Life of August Wilhelm Schlegel, Cosmopolitan of Art and Poetry ROGER PAULIN THE LIFE OF AUGUST WILHELM SCHLEGEL The Life of August Wilhelm Schlegel Cosmopolitan of Art and Poetry Roger Paulin http://www.openbookpublishers.com © 2016 Roger Paulin This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the text; to adapt the text and to make commercial use of the text providing attribution is made to the author (but not in any way that suggests that he endorses you or your use of the work). Attribution should include the following information: Paulin, Roger, The Life of August Wilhelm Schlegel, Cosmopolitan of Art and Poetry. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2016. http://dx.doi.org/10.11647/OBP.0069 Further details about CC BY licenses are available at http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Please see the list of illustrations for attribution relating to individual images. Every effort has been made to identify and contact copyright holders and any omission or error will be corrected if notification is made to the publisher. For information about the rights of the Wikimedia Commons images, please refer to the Wikimedia website (the relevant links are listed in the list of illustrations). In order to access detailed and updated information on the license, please visit http://www. openbookpublishers.com/isbn/9781909254954#copyright All external links were active on 12/01/2016 and archived via the Internet Archive Wayback Machine: https://archive.org/web/ Digital material and resources associated with this volume are available at http://www. -

Helmut Walser Smith, Ph.D. Celia S. Applegate, Ph.D. David G
Germany and the Question of Slavery, 1750-1850 By Christopher David Mapes Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in History August 31, 2018 Nashville, Tennessee Approved: Helmut Walser Smith, Ph.D. Celia S. Applegate, Ph.D. David G. Blackbourn, Ph.D. Alexander Joskowicz, Ph.D. Copyright © 2018 by Christopher Mapes All Rights Reserved ii ACKNOWLEDGEMENTS I owe a great deal to many generous people. First and foremost, I owe a substantial debt to my advisor Dr. Helmut Walser-Smith, the Chairman of my committee, for his mentorship, close reading of my work, and tireless effort. My committee members, Celia Applegate, David Blackbourn, and Ari Joskowicz, have all given me the support and guidance necessary to complete the project. Their intellectual rigor, commitment to scholarship, and devotion to the craft of history provide an endless source of inspiration. Their willingness to serve on my committee and to donate their time has been invaluable to the development of this project. This work would never have been completed without the financial support of the Vanderbilt University’s History Department, the German-American Fulbright Kommission, and the Herzog Ernst Scholarship program provided by the Fritz Thyssen Stiftung. Their generous funding has allowed me the time to delve into the archives and produce this work. I also am indebted to the archival staff and fellow researchers at archives in Berlin, including the Geheimes Staatsarchiv, the Bundesarchiv, the Evangelisches Zentralarchiv, the Politisches Archiv des Auswärtigen Amts in Berlin, as well as the Archiv der Landeshauptstadt Potsdam, the Perhes Sammlung Gotha, and the city archives of Hanover, Hamburg, and Bremen. -
Modernity, Nation, and the Baroque
Benjamin’s Library Series editor: Peter Uwe Hohendahl, Cornell University Signale: Modern German Letters, Cultures, and Thought publishes new English- language books in literary studies, criticism, cultural studies, and intellectual history pertaining to the German-speaking world, as well as translations of im- portant German-language works. Signale construes “modern” in the broadest terms: the series covers topics ranging from the early modern period to the present. Signale books are published under a joint imprint of Cornell University Press and Cornell University Library in electronic and print formats. Please see http://signale.cornell.edu/. Benjamin’s Library Modernity, Nation, and the Baroque Jane O. Newman A Signale Book Cornell University Press and Cornell University Library Ithaca, New York Cornell University Press and Cornell University Library gratefully acknowledge the support of The Andrew W. Mellon Foundation for the publication of this volume. Copyright © 2011 by Cornell University All rights reserved. Except for brief quotations in a review, this book, or parts thereof, must not be reproduced in any form without permission in writing from the publisher. For information, address Cornell University Press, Sage House, 512 East State Street, Ithaca, New York 14850. First published 2011 by Cornell University Press and Cornell University Library Printed in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Newman, Jane O. Benjamin’s library : modernity, nation, and the Baroque / Jane O. Newman. p. cm. — (Signale : modern German letters, cultures, and thought) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8014-7659-4 (pbk. : alk. paper) 1. Benjamin, Walter, 1892–1940—Criticism and interpretation. -

August Wilhelm Von Schlegel an Johann Georg Zimmer, Mohr & Zimmer (Heidelberg) Coppet, 11.12.1809
August Wilhelm von Schlegel an Johann Georg Zimmer, Mohr & Zimmer (Heidelberg) Coppet, 11.12.1809 Empfangsort Heidelberg Anmerkung Empfangsort erschlossen. Handschriften- Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Datengeber Signatur Mscr.Dresd.e.90,XX,Bd.8,Nr.79(2) Blatt-/Seitenzahl 4 S. auf Doppelbl., hs. m. U. Format 20,5 x 12,9 cm Jenisch, Erich (Hg.): August Wilhelm Schlegels Briefwechsel mit seinen Heidelberger Verlegern. Bibliographische Festschrift zur Jahrhundert-Feier des Verlags Carl Winters Universitätsbuchhandlung in Angabe Heidelberg 1822‒1922. Heidelberg 1922, S. 55‒59. Editionsstatus Einmal kollationierter Druckvolltext mit Registerauszeichnung August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der Korrespondenz [Version-07-21];https://august- Zitierempfehlung wilhelm-schlegel.de/version-07-21/briefid/4597. [1] Coppet d[en] 11 Dec[ember] 1809 Endlich, mein werthgeschätzter Herr und Freund, mache ich den Anfang damit, Ihnen mein Versprechen in Ansehung der Heidelb[ergischen] Jahrbücher zu halten. Ich wünsche von Herzen, daß Sie den Spruch bewährt finden mögen, was lange währt, wird gut.Die Anzeige von Gries übersetztem Ariost liegt schon halb fertig auf dem Ambos, und in kurzem hoffe ich auch die übrigen Sachen, die ich übernommen oder selbst vorgeschlagen zu liefern. Ich weiß nicht, ob das Buch der Liebe ausdrücklich darunter war. Wäre mir jemand damit zuvorgekommen, so würde ich Sie bitten,die Anzeige an H[er]rn Hofr[ath] Eichstädt für die Jenaische Lit[eratur] Zeitung zu schicken, doch wäre es mir nicht lieb. Den Roman von Goethe würde ich liebermeinem Bruder zuweisen, der ja wohl noch mit 8 Bänden von dessen sämtlichen Werken im Rückstande ist. Falls er ihn nicht übernehmen wollte oder könnte, thäte ich es wohl, jedoch müßte ich mir dabey die strengste Anonymität vorbehalten, was überhaupt für die Bücher gilt, bey deren Beurtheilung ich mich nicht ohne Unbequemlichkeit nennen zu können glaube.