Insecta, Plecoptera
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Strukturerfassung in Ausgewählten Waldgesellschaften Im Nationalpark Harz (Sachsen-Anhalt)
Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt (Halle 2005) 10: 3-28 3 Strukturerfassung in ausgewählten Waldgesellschaften im Nationalpark Harz (Sachsen-Anhalt) Gunter Karste, Rudolf Schubert, Hans-Ulrich Kison und Uwe Wegener 1 Einleitung Die Ausweisung von Nationalparken innerhalb der mitteleuropäischen Kulturlandschaft bietet die einmalige Chance, Strukturveränderungen in anthropogen überprägten aber auch in den Resten naturnaher Lebensräume zu erfassen. Vor allem Pflanzengesellschaften als wichtige Strukturkomponenten der Ökosysteme geben wichtige Hinweise zum Zustand der verschiedenen Lebensraumtypen (Ellenberg 1996). Re gelmäßige pflanzensoziologische Untersuchungen können somit quantitative wie qualitative Veränderungen in den Lebensräumen aufzeigen. Dazu wurden zunächst die Farn- und Blüten pflanzen des Nationalparks Hochharz erfasst (K iso n & W e rn e c k e 2004) und darüber hinaus flächendeckend die Pflanzengesellschaften. Im Ergebnis der Vegetationskartierung konnte u. a. festgestellt werden, dass ein Nebeneinan der von großflächigen Fichtenmonokulturen und einer Vielzahl kleinflächiger Relikte der natür lichen Waldgesellschaften existiert. Die im Zuge der Vegetationskartierung erfassten Reste naturnaher Pflanzengesellschaften können als Leitgesellschaften gesehen werden, die Prog nosen zu einer möglichen Naturdynamik erlauben. Auch wenn wir annehmen, dass die Reste naturnaher Pflanzengesellschaften optimal an ihren Standort angepasst sind und damit möglicherweise einen gewissen Konkurrenzvorteil gegen über den anthropogen geprägten -

WANDERN IM HARZ WANDERN (Hier Fehlt N Ch Die
WANDERN IM HARZ WANDERN (hier fehlt n ch die Harzklub Tanne) IM HARZ Wander e Wanderungen für fürjedermann jederma 2019/20205 Fe ruar 20 is Dezem er von März 20195 bis März 2020 5 mit Wan erf rer mit Wanderführern derder Harzklub-ZweigvereineHarzkl -Zwei erei e WanWanderungenderungen unter fachkundigerf chkundi er Führung Führung Herausgeber: Harzklub e.V. HerAmausge Alten er: Bahnhof Harzkl 5a e V 38678Ba Clausthal-Zellerfeldfstraße 5a Cla st al-Zellerfeld Tel. 0 53 23 / 8 17 58 • Fax 0 53 23 / 8 12 21 Tel : 0 53 23 / 8 17 58 • Fax 0 53 23 / 8 12 21 Homepage: www.harzklub.de HomE-Mail:epage: ttp://[email protected] arz lu e E-Mail: i f @ arzkl de Titelfoto: Zweigverein Lamspringe Wo steht was? Vorwort 4 Allgemeine Harzklub-Termine 8 Tipps für alle 13 Mehrtages- und Wochenendwanderungen 17 Regelmäßig wiederkehrende Wanderungen 17 Wanderungen am Grünen Band 19 Tageswanderungen 20 Sonntagswanderungen im Karstgebiet 112 Was bietet und leistet der Harzklub? 121 Hinweise und Auskünfte 124 Orientierung 128 UTM-Daten 129 Wanderheime des Harzklubs 131 Wander-Fitness-Pass und Deutsches Wanderabzeichen 133 Harzklub-Hauptverein 134 Ansprechpartner der Zweigvereine 137 Wandergaststätten 143 Beitrittserklärung mit Abo-Bestellung "Der Harz" 153 Wanderheft „Wanderungen für jedermann 2019“ mit dem Harzklub e.V. Vorwort des Präsidenten - 30 Jahre „Freier Brocken“ Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, sehr geehrte Freunde des Harzes, der Harzklub e.V. ist mit seinen 87 Zweigvereinen und 13.000 ehrenamtlichen Mitgliedern flächendeckend im gesamten Harz, in den drei Bundesländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aktiv. Seit der Gründung im Jahre 1886 war und ist es der Harzklub, welcher die Grundlagen dafür geschaffen hat, dass der Harz zu einer attraktiven Wanderregion wurde. -

Moosgesellschaf Ten Von Fließgewässern Im Nationalpark
Hercynia N. F. 38 (2005): 209–232 209 Moosgesellschaf ten von Fließgewässern im Nationalpark Hochharz (Sachsen-Anhalt)∗) Rudolf SCHUBERT 4 Abbildungen und 15 Tabellen ABSTRACT SCHUBERT, R.: Bryophyte communities of rivers in the national park of Hochharz (Sachsen-Anhalt). – Hercynia N.F 38 (2005): 209–232. In the national park of Hochharz in and on the river of Kalte Bode, Ilse, Wormke, Schwarzes Schluftwasser, Steinbach and Wormkegraben 8 aquatic bryophyte commu ni ties and 7 bryophyte communities of the riverbanks have been described. Their structure, ecology, distribu tion, endangerment and the necessity of management for protection are represented. Key words: bryophyte communities, national park Hochharz, nature protec tion 1 EINFÜHRUNG 1.1 Moosgesellschaften Nachdem im Jahre 2003 die Moosgesellschaften der Fließgewässer Oder und Sieber im Nationalpark Harz untersucht werden konnten (SCHUBERT 2004b), war es 2004 möglich, auch entsprechende Analysen im Bereich des Nationalparks Hochharz vorzunehmen. Gegenstand der Untersuchungen waren die Fließgewässer-Moosgesellschaften der Kalten Bode, Ilse, Wormke, des Schwarzen Schluftwassers und Steinbaches mit ihren Nebengewässern sowie des Wormkegrabens. Mit ihrer pflanzensoziologischen Erfassung soll ihre Struktur, Dynamik, Verbreitung, ökologische Bedeutung und gegebenenfalls Gefährdung erfasst werden (Abb. 1), wobei die Angaben von DREHWALD et PREISING (1991) bestätigt werden konnten. An Standorten, an denen die Umweltfakto ren ein Wachstum von Farn- und Blütenpflanzen verhindern oder doch wenigstens stark einschränken, können sich Flechten und Moose stärker entwickeln. Bei geeigneten Standortsbedingungen bilden sich Lebens ge meinschaften, in denen die Moose dominieren. Diese Ge mein schaften spiegeln in ihrer cha rakteristischen Artenkombina tion den jeweiligen Standortskomplex sehr gut wider und können deshalb ausgezeichnet als Bioindikatoren verwendet werden (ARNDT et al. -
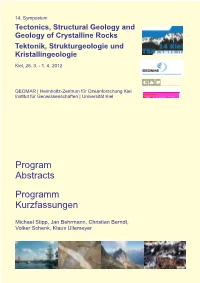
Program Abstracts Programm Kurzfassungen
14.Symposium Tectonics,StructuralGeologyand GeologyofCrystallineRocks Tektonik,Strukturgeologieund Kristallingeologie Kiel,26.3.-1.4.2012 GEOMAR|Helmholtz-ZentrumfürOzeanforschungKiel InstitutfürGeowissenschaften|UniversitätKiel Program Abstracts Programm Kurzfassungen MichaelStipp,JanBehrmann,ChristianBerndt, VolkerSchenk,KlausUllemeyer Contents PREFACE.............................................................................................................................3 PROGRAM ..........................................................................................................................5 Workshops Symposium Field trip POSTER CONTRIBUTIONS............................................................................................13 ABSTRACTS.....................................................................................................................19 MAILING LIST ...............................................................................................................113 2 Preface The 14 th Symposium on Tectonics, Structural Geology and Geology of Crystalline Rocks (TSK14) is the first TSK meeting to be held on the coast. Northern Germany is void of metamorphic and structural geology outcrops and study of their processes requires going underground into salt mines or driving as far as the Harz Mountains. This is precisely what we will do for the field trip. Nevertheless, marine research is much closer to the TSK topics than might be expected. The plate tectonics revolution in the end of the 60s of last century -

Schaumburg, J., Schranz, C, Foerster, J., Gutowski
Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft Auftraggeber: Erarbeitung eines Bundesministerium für Bildung und Forschung (FKZ 0330033) ökologischen Bewertungs- Länderarbeitsgemeinschaft verfahrens für Fließgewässer Wasser (O 11.03) und Seen im Teilbereich Auftragnehmer: Makrophyten und Phyto- Bayerisches Landesamt für benthos zur Umsetzung der Wasserwirtschaft EU-Wasserrahmenrichtlinie Schlussbericht (Januar 2004) Dr. Jochen Schaumburg, Dr. Ursula Schmedtje, Christine Schranz, Barbara Köpf, Dr. Susanne Schneider, Dr. Petra Meilinger, Dr. Doris Stelzer, Dr. Gabriele Hofmann, Dr. Antje Gutowski, Julia Foerster Auftraggeber Bundesministerium für Bildung und Forschung (FKZ 0330033) Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (O 11.03) Auftragnehmer Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft Projektleitung Dr. Jochen Schaumburg, Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft Dr. Ursula Schmedtje, Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft Koordination Dipl.-Biol. Christine Schranz, Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft Dipl.-Biol. Barbara Köpf, Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft Makrophyten Dr. Susanne Schneider, Limnologische Station Iffeldorf Dr. Petra Meilinger, Limnologische Station Iffeldorf (Fließgewässer) Dr. Doris Stelzer, Limnologische Station Iffeldorf (Seen) Diatomeen Dr. Gabriele Hofmann, Glashütten-Schloßborn Dipl.-Biol. Christine Schranz, Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft Phytobenthos Dr. Antje Gutowski, Bremen Dipl.-Biol. Julia Foerster, Universität Bremen, FB 02, AG Meeresbotanik Layout, Redaktion Dipl.-Biol. Friederike Bleckmann, Bayer. Landesamt -

Sten På Sten
Sten på sten På Hexentanzplatz, regionens største turist- E11 hzns, etape 1: mål, er der som sædvanligt et mylder af små . km: 14,7 og store, især da i det fine vejr. Hexentanzplatz . Thale Vi går ned mod den gode tovbanes Bergsta- . Benneckerode tion og fortsætter til bygningerne ved . Eggerode Bergtheater. Her begynder den hårde ned- . Timmenrode stigning mod Thale. Stien slynger sig i ser- . Blankenburg pentiner ned ad skrænten, og den er anlagt af . 2020-07-12/14 store og små sten, der nogle steder er kastet højdeprofil: lidt meget rundt, så man skal hele tiden se sig . ele: 447-308 m grundigt for. Undervejs er der fine udsigter . ^/v: 447/178 m mod Bode-dalen. Efter to km's strabadser kommer der endelig en grusvej med et moderat fald. Jeg krydser broen over Bode-floden, går hen til Roßtrappe Sessellift Talstation og kører op til Bergstation. Jeg hopper af og går hen ad asfaltvejen mod Treseburg. Ved første kryds drejer jeg mod Thale og fortsætter ned ad en 14% stigning. Et stykke nede ad vejen drejer jeg ind på en skovsti, og kort efter ad skovvejen, Alte Roßtrappenstraße langs med Kottbach til Benneckenrode. Jeg går gennem byens udkant mod Jugendbildstätte Forsthaus Eggerode, hvor der er flere huse og en stor teltplads til udlejning. Her krydser jeg Silberbach og går op ad en knoldet markvej til Küsterberg, hvor der er et stort solcelleanlæg og ned mod Timmenrode, hvor vejen igen hedder Roßtrappenstraße. Jeg går tværs gen- nem byen og ad grusvejen op til Hamburger Wappen, som er en del af klipperan- Thale den Teufelsmauer. -

Die Moosgesellschaften Des Nationalparks Harz Des Nationalparks Rudolf Schubert • Die Moosgesellschaften
Cyan Magenta Yellow Schwarz Mitteilungen zur floristischen Kartierung Sachsen-Anhalt Sonderheft 5 (2008) Mitteilungen zur floristischen Kartierung Sachsen-Anhalt Sonderheft 5 (2008) Die Auswertung der in den Jahren 2002–2007 erarbeiteten Vegetationsaufnahmen Rudolf Schubert Die Moosgesellschaften im Nationalpark Harz ergab ihre Einordnung in 77 unterschiedliche Moos- gesellschaften. 17 Moosgesellschaften gehören zu den bedrohten Lebensgemein- des Nationalparks Harz schaften der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, womit die Bedeutung des Nationalparks Harz für die Erhaltung und den Schutz der Moosflora des Harzes deutlich wird. Rudolf Schubert • Die Moosgesellschaften des Nationalparks Harz des Nationalparks Rudolf Schubert • Die Moosgesellschaften Herausgegeben vom ISSN 1432-8038 Botanischen Verein Sachsen-Anhalt e.V. Halle (Saale) Cyan Magenta Yellow Schwarz Impressum Für die Überlassung von Beiträgen zur Floristik, Geobotanik, Systematik und Taxonomie sind wir dankbar. Insbesondere sind Beiträge zur Erleichterung der praktischen Geländearbeit (neue, regionale oder ergänzende Schlüssel zum Erkennen bestimmungs- Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt kritischer Sippen bzw. sonstige hilfreiche Anregungen zur Artansprache) sowie die Mitteilung von überregional bedeutsamen Artvorkommen willkommen. Sonderheft 5 (2008) Manuskripte sind einzureichen beim Botanischen Verein Sachsen-Anhalt e.V., Am Rudolf Schubert Dorfrand 3, 06193 Frößnitz. Die Moosgesellschaften des Nationalparks Harz Für die Veröffentlichung der Beiträge -

Rohstoffbericht Sachsen-Anhalt 2002
MITTEILUNGEN ZUR GEOLOGIE VON SACHSEN-ANHALT Beiheft 5 ROHSTOFFBERICHT 2002 Verbreitung, Gewinnung und Sicherung mineralischer Rohstoffe in Sachsen-Anhalt Schematischer geologischer Schnitt mit den wichtigsten Minerallagerstätten Sachsen-Anhalts (siehe auch Kap. 2, Abb. 2). Das stark ver- einfachte Bild spiegelt den komplexen erdgeschichtlichen Werdegang dieser Region über rund 500 Millionen Jahre wider. In diesem lan- gen Zeitintervall bildeten sich zahlreiche auch heute noch wirtschaftlich wichtige Lagerstätten. Im Grundgebirgsstockwerk finden wir z.B. die hochwertigen devonischen Kalksteine von Elbingerode/Rübeland. Von großer wirtschaftlicher Bedeutung sind im Tafeldeckgebirge die Salzablagerungen des Zechsteins, deren Potenzial noch weit in die Zukunft reicht. Auch das Lockergesteinsstockwerk enthält eine breite Palette nutzbarer Bodenschätze, die z.B. Braunkohle, Quarzsand und Massenbaurohstoffe umfasst. MITTEILUNGEN ZUR GEOLOGIE VON SACHSEN-ANHALT • Beiheft 5 Rohstoffbericht 2002 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt Mitteilung zur Geologie von Sachsen-Anhalt – Beiheft 5 Rohstoffbericht 2002 Verbreitung, Gewinnung und Sicherung mineralischer Rohstoffe in Sachsen-Anhalt Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt Mitteilungen zur Geologie von Sachsen-Anhalt, Beiheft 5, 2002 Herausgeber: Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt Köthener Str. 34, 06118 Halle (Saale) Postfach 156, 06035 Halle (Saale) Tel. (0345) 5212-0, Fax. (0345) 522 99 10 e-mail: [email protected] Internet: www.mw.sachsen-anhalt.de/gla Präsident: ARMIN FORKER Schriftleitung: GRIT BALZER, DR. BODO-CARLO EHLING, ARMIN FORKER, PETER KARPE, WOLFGANG PAPKE, DR. KLAUS STEDINGK Verantwortlicher Redakteur: DR. KLAUS STEDINGK Redaktionsschluß: 11. November 2002 Druck: Grafisches Centrum Cuno, Gewerbering West 27, 39240 Calbe Titelbild: Rückbau der Halde des 1917 wegen Erschöpfung der Erzvorräte stillgelegten Freiesleben-Schachtes (Gebäude unten rechts) im Mansfelder Revier. -

Amtsblatt Nr
Amtsblatt Nr. 01/21 | Jahrgang 12 30. Januar 2021 Blankenburg (Harz) • Börnecke • Cattenstedt • Stadt Derenburg • Heimburg • Hüttenrode • Timmenrode • Wienrode Beitrag zum Klimaschutz Blankenburger Stadtwerke errichten sieben öffentliche E-Ladesäulen Mit einem symbolischen Scherenschnitt haben Bürgermeister Heiko Breithaupt und Stadtwerke-Geschäftsführer Tim Schlenkermann die Ladesäule am Schnappelberg in Betrieb genommen. Die Stadt Blankenburg (Harz) wird der ste- Parkplatz an der Burg und Festung Regen- land – im Vergleich zum Vorjahr – nahezu tig steigenden Nachfrage nach öffentli- stein, dem Kloster Michaelstein, am Thie- verdoppelt. „Durch die Corona-bedingten chen Ladestationen für E-Autos gerecht park oder gegenüber der neuen Regen- Reisebeschränkungen erlebte auch Blan- und setzt ein deutliches Zeichen für mehr stein-Turnhalle. An allen E-Tankstellen kenburg einen regelrechten Besucheran- Klimaschutz. Die Blankenburger Stadtwer- stehen jeweils zwei Ladepunkte mit 22 KW sturm im Sommer und Herbst 2020, damit ke GmbH haben in den vergangenen Wo- Leistung zur Verfügung, diese wurden auch stieg auch der Anteil der Besucher mit chen insgesamt sieben Ladesäulen für bereits gut genutzt. Laut Tim Schlenker- Elektrofahrzeugen“, erläutert Bürgermeis- E-Autos im gesamten Stadtgebiet errichtet. mann wurden an der Ladesäule am ter Heiko Breithaupt. Die Ladestationen Diese sind seit Oktober in Betrieb, eine Schnappelberg bereits 600 Kilowattstun- werden ausschließlich mit Ökostrom be- Säule auf dem Parkplatz am Schnappel- den getankt. „Dabei hatten wir noch gar trieben. Die Errichtung wurde durch För- berg „ging im Dezember symbolisch ans keine Werbung für unsere neuen Ladesta- dermittel des Landes unterstützt, eine en- Netz“, damit geht die Stadt auch einen tionen gemacht“, ergänzt der Stadtwer- ge Zusammenarbeit gab es mit der Lan- wichtigen Schritt, wenn es um E-Mobilität ke-Geschäftsführer. -
Bodetal- Teufelsmauer
9 ® Site 9 Bodetal- Teufelsmauer www.harzregion.de Le socle du massif du Harz Le légendaire rocher Rosstrappe 1 (empreinte de cheval) près de Thale Les alentours de la gare de Thale offrent tous les jours suffisamment de places de stationnement. De là , quelques minutes nous suffiront pour atteindre la station inférieure du télésiège. C’est le moyen le plus commode pour accéder au rocher Rosstrappe (N51°44.131’ , E011° 01. 071’). Aux amateurs de randonnées , nous recommandons toutefois l’itinéraire suivant : Prä si- dentenweg – Eselsteig – Ross- trappe. Le Präsidenten weg (chemin du président) part de la vallée de la Bode , juste derrière la station inférieure L’auberge Königsruhe vue depuis le Rosstrappe du téléférique. Après notre passage sous les câbles du télésiège au cours de notre ascension , seuls quelques lacets d’un chemin serpentant nous séparent encore des 32 marches conduisant au rocher granitique de la colline Bülowhöhe. De là , ou du belvédère aménagé au Berghotel Rosstrappe , nous avons par beau temps une vue imprenable sur l’avant-pays du massif du Harz. Notre but est toutefois le Rosstrappe lui-même , que nous atteignons depuis l’hôtel en suivant un chemin de randonnée bien balisé. Une légende du royaume des Géants raconte que Brunhilde , la fille du roi , était poursuivie par Bodo , un prince de Bohême. Elle put lui échapper grâce à un bond téméraire de son cheval qui , de l’aire de danse des sorcières (Hexentanzplatz) , franchit la vallée de la Bode. Le cheval de Bodo ne put en faire autant. Cheval et cavalier s’écrasèrent dans le fond de la vallée où Bodo , transformé en molosse noir , veille sur la couronne que Brunhilde perdit en la franchissant. -

Amtsblatt Nr
Amtsblatt Nr. 04/20 | Jahrgang 11 02. Mai 2020 Blankenburg (Harz) • Börnecke • Cattenstedt • Stadt Derenburg • Heimburg • Hüttenrode • Timmenrode • Wienrode Farbenfrohe Botschafter zeugen von Hoffnung und Zusammenhalt Foto: Marko S. Schüren Derzeit wachsen sie an vielen Orten in im Fasanengarten im blühenden Schlos- tragen sie dabei Namen: Harzsteine oder ganz Deutschland, so auch hier bei uns spark bunt bemalte Steine aneinender. auch Regensteine. Wer einen Stein findet, in der Blütenstadt: Steinschlangen. Hier legte Marleen Heinze den ersten Stein, wird animiert, ihn zu fotografieren und in Hier werden kleine bemalte Steine als Zei- an den sich innerhalb kurzer Zeit viele wei- sozialen Netzwerken wie Facebook oder chen der Hoffnung und des Zusammen- tere kleine Kunstwerke anschlossen. Instagram unter dem entsprechenden, auf halts in Zeiten von Corona neben- Die bunten Steine indes sind nicht neu. den Stein geschriebenen Hashtag – ein einander gelegt, so dass ein schöner, bun- Seit mehreren Monaten kann man hier mit einem Doppelkreuz versehenes ter Gruß in Form einer Schlange entsteht. und dort beim Spazierengehen oder Wan- Schlagwort, z.B. #Harzsteine – zu teilen. Nachdem in Cattenstedt bereits eine erste dern kleine bunte Schätze entdecken. Lie- Anschließend soll man ihn wieder an ei- bunte Steinschlange auf Initiative von Gabi bevoll bemalte Steine, die an verschiede- ner Stelle ablegen, damit sich auch ande- Hoffmann entstand, reihten sich auch bald nen Stellen abgelegt wurden. Je nach Ort re Finder darüber freuen können. Herausgeber: Stadt Blankenburg (Harz), Der Bürgermeister, Harzstr. 3, 38889 Blankenburg (Harz), Tel. 03944 943-202, E-Mail: [email protected] Gesamtherstellung: Harzdruckerei GmbH, Max-Planck-Str. 12/14, 38855 Wernigerode, Tel. -

Moosgesellschaf Ten Von Fließgewässern Im
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Hercynia Jahr/Year: 2005 Band/Volume: 38 Autor(en)/Author(s): Schubert Rudolf Artikel/Article: Moosgesellschaften von Fließgewässern im Nationalpark Hochh 209- 232 ©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Hercynia N. F. 38 (2005): 209–232 209 Moosgesellschaf ten von Fließgewässern im Nationalpark Hochharz (Sachsen-Anhalt)∗) Rudolf SCHUBERT 4 Abbildungen und 15 Tabellen ABSTRACT SCHUBERT, R.: Bryophyte communities of rivers in the national park of Hochharz (Sachsen-Anhalt). – Hercynia N.F 38 (2005): 209–232. In the national park of Hochharz in and on the river of Kalte Bode, Ilse, Wormke, Schwarzes Schluftwasser, Steinbach and Wormkegraben 8 aquatic bryophyte commu ni ties and 7 bryophyte communities of the riverbanks have been described. Their structure, ecology, distribu tion, endangerment and the necessity of management for protection are represented. Key words: bryophyte communities, national park Hochharz, nature protec tion 1 EINFÜHRUNG 1.1 Moosgesellschaften Nachdem im Jahre 2003 die Moosgesellschaften der Fließgewässer Oder und Sieber im Nationalpark Harz untersucht werden konnten (SCHUBERT 2004b), war es 2004 möglich, auch entsprechende Analysen im Bereich des Nationalparks Hochharz vorzunehmen. Gegenstand der Untersuchungen waren die Fließgewässer-Moosgesellschaften der Kalten Bode, Ilse, Wormke, des Schwarzen Schluftwassers und Steinbaches mit ihren Nebengewässern sowie des Wormkegrabens. Mit ihrer pflanzensoziologischen Erfassung soll ihre Struktur, Dynamik, Verbreitung, ökologische Bedeutung und gegebenenfalls Gefährdung erfasst werden (Abb. 1), wobei die Angaben von DREHWALD et PREISING (1991) bestätigt werden konnten. An Standorten, an denen die Umweltfakto ren ein Wachstum von Farn- und Blütenpflanzen verhindern oder doch wenigstens stark einschränken, können sich Flechten und Moose stärker entwickeln.