Regionsprofil Arosa Schanfigg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Graubünden for Mountain Enthusiasts
Graubünden for mountain enthusiasts The Alpine Summer Switzerland’s No. 1 holiday destination. Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden © Andrea Badrutt “Lake Flix”, above Savognin 2 Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden 1000 peaks, 150 valleys and 615 lakes. Graubünden is a place where anyone can enjoy a summer holiday in pure and undisturbed harmony – “padschiifik” is the Romansh word we Bündner locals use – it means “peaceful”. Hiking access is made easy with a free cable car. Long distance bikers can take advantage of luggage transport facilities. Language lovers can enjoy the beautiful Romansh heard in the announcements on the Rhaetian Railway. With a total of 7,106 square kilometres, Graubünden is the biggest alpine playground in the world. Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden. CCNR· 261110 3 With hiking and walking for all grades Hikers near the SAC lodge Tuoi © Andrea Badrutt 4 With hiking and walking for all grades www.graubunden.com/hiking 5 Heidi and Peter in Maienfeld, © Gaudenz Danuser Bündner Herrschaft 6 Heidi’s home www.graubunden.com 7 Bikers nears Brigels 8 Exhilarating mountain bike trails www.graubunden.com/biking 9 Host to the whole world © peterdonatsch.ch Cattle in the Prättigau. 10 Host to the whole world More about tradition in Graubünden www.graubunden.com/tradition 11 Rhaetian Railway on the Bernina Pass © Andrea Badrutt 12 Nature showcase www.graubunden.com/train-travel 13 Recommended for all ages © Engadin Scuol Tourismus www.graubunden.com/family 14 Scuol – a typical village of the Engadin 15 Graubünden Tourism Alexanderstrasse 24 CH-7001 Chur Tel. +41 (0)81 254 24 24 [email protected] www.graubunden.com Gross Furgga Discover Graubünden by train and bus. -

Liniennetz Chur/Mittelbünden Triemel
Liniennetz Chur/Mittelbünden Triemel Untervaz Chur, Postautostation Versam- Safien Calfreisen, Dorf 182 Fatschel Malteser 041 Laax 081 041 Chur, Hof Maladers, Dorf 041 Bellinzona 171 042 Maladers, Brandacker Tumma Schule St. Antönierrank Caflies 041 Pudanal Chisgruob Pagig, Tura Castiel, Dorf Chur, Araschgerrank Maladers, Sax Pagig, Abzw. St. Peter, Gufa Langwies, Araschgen, Peist, Schulhaus Calfreisen, Abzw. St. Peter, Rathaus Abzw. Bahnhof Chur, Städeli Vorderaraschgen Maladers, Castiel, Galgenbühl alte Post Litzirüti Malix, Kreuz Araschgen, Kronenhof Passugg, Brugg Arosa, Rezia Bahnhof Passugg, Hotelfachschule Malix, Dorf Schluocht Arosa Churwalden, Egga 042 Lax 042 Passugg, Furnerschhus Krone Tschiertschen Abzw. Grida Churwalden, Rathaus Ausserpraden, Sattelalp Praden, alte PostPraden, Kurhaus Tschiertschen Bergbahnen Pradaschier Churwalden, Rüti Ausserpraden, Hedwig Churwalden Parpan, Post Obertor /Heimberg Weisshorn Furgglis 182 Parpan Heimberg Stätz Parpan, Parpaner Höhe Valbella, Posthotel Valbella, Dorf 191 Valbella, Canols Klosters Skilift/Kirche Rothorn Davos Platz, Bahnhof Lenzerheide /Lai, 331 Rothornbahn Seehof 183 Davos Platz, Spital Dieschen Sot La Riva Crestannes Fadail/Lido Sportzentrum Davos Platz, Islen Central Davos Frauenkirch, Gadenstatt Altersheim Davos Frauenkirch, Landhaus Skischulplatz 182 Davos Glaris, ARA Lenzerheide/Lai, Post Mühle Tankstelle Davos Glaris, Bahnhof Lenzerheide/Lai, 191 Lenzerheide/Lai, Clavadoiras Val Sporz Ortolfi Gravas Lantsch/Lenz, St. Cassian EW Resgia Biathlon Arena Lenzerheide, Neuhof Barbatschauns Davos Glaris, Ardüsch Vaz /Obervaz, Tranter Moira Vischnanca Davos Monstein, Bahnhof Sudem Vischnanca Lain Davos Monstein, Schmelzboden Muldain Lantsch/Lenz, Sozas Davos Wiesen, Valldanna Brinzauls, DorfBrinzauls, Belfort 184 Alvaschein, Vazerol 183 Schluocht Vaz /Obervaz, Dorf 571 Brienz / Brienz / Alvaneu Dorf,Alvaneu Crappa Dorf,NairaSchmitten, Dorfplatz ChappaliSchmitten, DorfSchmitten,Davos Innerdorf Wiesen, Kirche Zorten Alvaschein, Gipsmühle 182 Alvaneu Bad, Tiefencastel, Bahnhof Bahnhof Thusis Bergün /St. -

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland
A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland Dr. Liliana Schönberger Contents Abstract .............................................................................................................................. 3 1 Introduction ............................................................................................................. 4 1.1 Light pollution ............................................................................................................. 4 1.1.1 The origins of artificial light ................................................................................ 4 1.1.2 Can light be “pollution”? ...................................................................................... 4 1.1.3 Impacts of light pollution on nature and human health .................................... 6 1.1.4 The efforts to minimize light pollution ............................................................... 7 1.2 Hypotheses .................................................................................................................. 8 2 Methods ................................................................................................................... 9 2.1 Literature review ......................................................................................................... 9 2.2 Spatial analyses ........................................................................................................ 10 3 Results ....................................................................................................................11 -

Summer Experience Information and Offers 12 June – 24 October 2021
Summer experience Information and offers 12 June – 24 October 2021 Will thrill your senses. TABLE OF CONTENTS 3 Contents Introduction 4 Arriving by Train 6 Hiking Map 10 Sustainability 12 Arosa All-Inclusive 14 Arosa Baer Sanctuary 20 Arosa Bear Academy 22 Hiking in Arosa 24 Family hikes and thematic trails 26 Hiking to the sights 28 Culinary, cultural and leisure walks 30 Panoramic Hikes 32 Alpine hikes 34 Long-distance hiking trails/ Schanfigger Höhenweg 36 Hiking trail markings 42 Trail running 44 Conduct & respect 46 Mountain biking 48 Family experiences 54 Nature experiences 59 Other summer activities 60 Culture 62 Well-being in Arosa 65 Indoor activities 66 MICE 68 Mountain experiences Arosa 70 Lenzerheide 72 Schanfigg 74 Importand contacts 78 Useful information from a to z 80 Arosa Tourismus LEGAL DETAILS Sports and convention centre Published by: Arosa Tourismus CH-7050 Arosa Design and layout: Nina Mattli, Arosa Tourismus +41 81 378 70 20 Photographs: Nina Mattli, Arosa Tourismus [email protected] Printed by: Triner Media + Print, Print Run 1‘500 arosalenzerheide.swiss All details are subject to change without notice 5 Arosa Summer feeling – another day in paradise Dear guests and friends of Arosa, I have the honour of writing the welcome article for our summer brochure. All about the summer in Aro- sa and the beauty of our favourite destination in the warm season. Where should I start? First of in the same way. By the way, an evening round Arosa events alone need a whole separate chap- all I must confess that the winter is my favourite of golf at the Arosa golf course. -

Aus Der Geschichte Des Tales Schanfigg (Von Den Anfängen Bis Zum Auskauf 1652)
Aus der Geschichte des Tales Schanfigg (von den Anfängen bis zum Auskauf 1652) Autor(en): Pieth, Friedrich Objekttyp: Article Zeitschrift: Jahresbericht der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft von Graubünden Band (Jahr): 81 (1951) PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-595993 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Aus der Geschichte des Tales Schanfigg (von den Anfängen bis zum Auskauf 1652) Von Friedrich Pieth, Chur 99 Siedl ungsgeschichtliches Das vertraute Bild unserer heimatlichen Landschaft wird im wesentlichen bestimmt durch die Berge, die Flüsse, die Seen, die Wälder und das bebaute Land. Es hat aber nicht immer so aus- gesehen, wie es sich heute unserm Blick darbietet. -

Botschaft Zusammenschluss Stadt Chur Mit Der Gemeinde Maladers
' lili11*~11' i,llili Stadt Chur Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat 110300 / 11510 Zusammenschluss Stadt Chur mit Gemeinde Maladers Antrag 1. Der Zusammenschluss-Vertrag zwischen der Stadt Chur und der Gemeinde Maladers wird zustimmend zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. 2. Gestützt auf Art. 15 Abs. 1 lit. d kantonales Gemeindegesetz unterliegt der Zusammen- schluss-Vertrag dem obligatorischen Referendum. Zusammenfassung Für den Zusammenschluss zwischen der Stadt Chur und der Gemeinde Maladers wurde eine gemeinsame Botschaft erarbeitet. Die Gemeindeversammlung Maladers hat als ab- schliessend zuständiges Gremium dem Zusammenschluss-Vertrag am 30. August 2018 zugestimmt. Damit ist die Voraussetzung erfüllt, das Geschäft dem Gemeinderat mit dem Antrag zu unterbreiten, den Vertrag zuhanden der Volksabstimmung zu verabschieden. Nach der Schanfigger Talfusion im Jahr 2012 blieb die Gemeinde Maladers alleine. Sie hat seit längerem Mühe, ihre öffentlichen Ämter zu besetzen, will sich aber auch aus struktu- rellen Überlegungen an Chur anlehnen. Der Stadtrat stand dem Ansinnen stets offen ge- genüber. Der vorliegende Zusammenschluss hat aus seiner Sicht weder gewichtige Vor- noch Nachteile. Maladers ist finanziell gesund, weshalb der Zusammenschluss kaum Aus- wirkungen auf die Stadtfinanzen haben wird. Es handelt sich vorliegend nicht um den ers- ten Zusammenschluss in der Geschichte Churs: 1852 kam der vorher selbstständige Hof zur Stadt, 1939 das Sassal, welches vorher zu Maladers gehörte. I"'I"1 Pq lili*1'Il Seite 2 von 4 Der Stadtrat erachtet es als unumgänglich, dass sich die Stadt dem Thema Gemeindezu- sammenschlüsse aus übergeordneter staatspolitischer Sicht annimmt. Der Ruf nach weni- ger, dafür starken Gemeinden entspricht einem allgemeinen Konsens. Maladers kann aus strukturellen Überlegungen, aber auch aus personellen Gründen, nicht alleine bleiben und muss sich an Chur anlehnen. -

Skigebietsverbindung Arosa-Lenzerheide Grundlage Für Das Referat an Der Jahresversammlung Der BVR Vom 20
Skigebietsverbindung Arosa-Lenzerheide Grundlage für das Referat an der Jahresversammlung der BVR vom 20. Juni 2008 Daniel Monsch, Parpan A) Einleitung Als ich letzten Herbst für ein Referat zur Skigebietsverbindung Arosa – Lenzerheide ange- fragt wurde, freute ich mich schon, über ein erfolgreiches Projekt berichten zu können. Wie Sie wissen wurde das Projekt an der Urnenabstimmung auf der Lenzerheide mit knapp 60% Nein deutlich abgelehnt. Es nützt dagegen wenig, dass gleichentags Arosa mit über 84% Ja dem Vorhaben überwältigend zugestimmt hat. Da die Skigebietsverbindung Arosa-Lenzerheide allgemein als ein sehr sinnvolles Projekt gilt und auch die Gegnerschaft sich grundsätzlich für eine Verbindung ausspricht (halt nur nicht so), muss das Vorhaben trotz dieses Rückschlages weiter verfolgt werden. An der heutigen Jahresversammlung der BVR ist es sicher von Interesse auf die Planungs- geschichte und besonders auf die Rolle (und die Grenzen) der Raumplanung einzugehen. B) Erste Ideen zur Erweiterung der Skigebiete (chronologisch) Die Verbindung Arosa-Lenzerheide-Tschiertschen durch das obere Urdental wird seit 1972 diskutiert. Die Auslöser waren jeweils Revisionen der Richtplanungen oder der Nutzungspla- nungen, in deren Verfahren die Betroffenen jeweils Gelegenheit zur Stellungnahme erhielten. Während sich der damalige Regionalverein Pro Schanfigg und die Gemeinden Tschiert- schen, Praden sowie die Bürgergemeinden Calfreisen, Castiel und Lüen als Grundeigentü- merinnen positiv zu diesen zusätzlichen Entwicklungs- und Nutzungsmöglichkeiten äusser- ten, wollte die Gemeinde Arosa diese Möglichkeit zwar langfristig offen halten, aber die Verbindung zum Aroser Hörnli noch zurück stellen. 1981 vereinbarte die Gemeinde Arosa mit den genannten Bürgergemeinden, dass im Urdental keine mechanische Erschliessung erstellt werden solle, welche eine Verbindung mit Arosa ermöglichen würde. Als Entschädigung für diese Einschränkung erhielten die drei Bürgergemeinden durch die Gemeinde Arosa, die Arosa Bergbahnen und Arosa Tourismus je Fr. -

Business Modell Tschiertschen
Business Modell Tschiertschen Beurteilung verschiedener Varianten & Empfehlungen (V 1.7 public) Hanser Consulting AG | Lagerstrasse 33 | Postfach | 8021 Zürich www.hanserconsulting.ch | [email protected] | +41 44 299 95 11 Impressum Auftraggeber Bergbahnen Tschiertschen AG Bearbeitung Hanser Consulting AG, Peder Plaz und Brigitte Küng Begleitgruppe Martin Weilenmann, Bergbahnen Tschiertschen AG Roderick Galantay, Gemeinde Tschiertschen-Praden Offenlegung von Quellen Die in diesem Dokument verwendeten Inhalte, Angaben und Quellen wurden mit grösster Sorgfalt zusammengestellt. Die Ausführungen beruhen teilweise auf Annahmen, die auf Grund des zum Zeitpunkt der Auftragsbearbeitung zugänglichen Materials für plausibel erachtet wurden. Die verwendeten Quellen und wortwörtlichen Zitate werden offengelegt. Bei der Verwendung von theoretischen oder wissenschaftlichen Konzepten, welche den gegenwärtigen Erkenntnissen der Wissenschaft entsprechen, wird zur Wahrung der Lesbarkeit und Verständlichkeit auf eine explizite Quellenangabe verzichtet. Gleichwohl kann Hanser Consulting AG für die Richtigkeit der gemachten Annahmen keine Haftung übernehmen. Projektnummer 12053.01 Hanser Consulting AG Die Hanser Consulting AG ist eine Politik- und Unternehmensberatung in der Schweiz. Unser Fokus liegt einerseits auf der Unterstützung von Unternehmen in Fragen der Strategieentwicklung und andererseits auf die Beratung der Öffentlichen Hand und Verbände in wirtschaftspolitischen Fragestellungen. Hanser Consulting AG 25.06.2019 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 4 2. Ist-Situation 8 3. SWOT, Vision & Strategien 19 4. Kurzfristige Optionen 25 5. Mittelfristige Optionen 38 6. Langfristige Optionen 48 7. Lösungsvorschlag & Vorgehen 59 Hanser Consulting AG 25.06.2019 3 1 Einleitung Hanser Consulting AG 25.06.2019 4 1 Einleitung Ausgangslage Die Bergbahnen Tschiertschen AG (BBT) generierten in den letzten beiden Saisons bei guten Witterungsbedingungen und bei gutem konjunkturellen Umfeld 32’000 – 42’000 Ersteintritte mit einem Durchschnittsertrag von CHF 22 – 23 Verkehrseinnahmen. -

Amtliche Anzeigen
Amtliche Anzeigen 15. November 2019 | Nr. 46 Gemeinderat Gemeinderatssitzung vom 21. November 2019, 14 Uhr, Rathaus Traktanden 1. Protokoll der Sitzung vom 24. Oktober 2019 2. Botschaft Stationierungskonzept Armee, Kasernenareal Chur, Tauschgeschäfte mit der Bürgergemeinde Chur 3. Botschaft Reorganisation Departement Bildung Gesellschaft Kultur 4. Botschaft Positionierung der Stadt Chur; Werkstattbericht 5. Botschaft Gaststadt; Kultur Events Sport 6. Fragestunde vom 21. November 2019 gemäss Art. 61 Geschäftsordnung (bei Bedarf) Die Unterlagen zur Sitzung können unter Die Bündner Hauptstadt hat eine grosse Anziehungskraft. So führen viele Wege nach Chur. Foto mc www.chur.ch (Über Chur ➞ Gemeinderat ➞ Sitzungen) heruntergeladen werden. Die Sitzung ist öffentlich! Bei der Anmeldung sind den Einwohner- Wohnungs- und Logiswechsel diensten bekannt zu geben: Die Meldepflicht für den Ein- und Auszug von – A ngaben gemäss Familienausweis/Familien- Mieterinnen oder Mietern bzw. von Logisneh- Einwohnerdienste büchlein oder Geburtsschein merinnen oder Logisnehmern obliegt der Ver- – K onfessionszugehörigkeit mieterin oder dem Vermieter bzw. der Logis- Meldevorschriften – A dresse geberin oder dem Logisgeber. Die Ein- oder – B eruf und Arbeitgeber Auszugsanzeige hat an die Einwohnerdienste Meldepflichtige Schritte, die gestützt auf – Z uzugsort und Zuzugsdatum zu erfolgen. das kantonale Gesetz über die Einwohner- register (Einwohnerregistergesetz, ERG) Wegzug Wer Geschäftsräume oder Gewerbelokale in innerhalb von 14 Tagen zu erledigen sind: Gegen Vorweisen -

Kanton Graubünden Region Plessur
Kanton Graubünden Region Plessur Regionaler Richtplan Tourismus Öffentliche Auflage Teil touristischer Langsamverkehr Teil Beherbergung und Gastronomie Von der Präsidentenkonferenz beschlossen am: Die Präsidentin: Die Geschäftsführerin: Von der Regierung genehmigt am: RB-Nr. Der Regierungspräsident: Der Kanzleidirektor: Gäuggelistrasse 7 Tel: 081 254 38 20 7000 Chur Fax: 081 254 38 21 [email protected] www.stw.swiss Impressum Projekt Region Plessur, Regionaler Richtplan Tourismus Projektnummer: 30003 Dokument: Richtplantext Auftraggeber Region Plessur Bearbeitungsstand Stand: Öffentliche Auflage Bearbeitungsdatum: 07.06.2021 Bearbeitung STW AG für Raumplanung, Chur (Nina Eichholz, Ina Hampel, Réka Pötz-Imre) z:\region\plessur\30003_rrip_tourismus_(heimeli)\01_rap\02_resultate\02_richtplantext\20210607_rrip_touri_lv_plessur.docx Inhalt 1. Einleitung ...................................................................................................... 1 1.1 Anlass ...........................................................................................................................................1 1.2 Inhalt, Aufbau und Gliederung ....................................................................................................1 1.3 Planungsprotokoll ........................................................................................................................3 1.3.1 Organisation ................................................................................................................................ 3 1.3.2 Planungsablauf -

Sgs Qualifor Forest Management Certification
SGS QUALIFOR Doc. Number: AD 36-A-1111 (Associated Documents) Doc. Version date: 9 April 2010 Page: 1 of 71 Approved by: Gerrit Marais FOREST MANAGEMENT CERTIFICATION REPORT / ZERTIFIZIERUNGSBERICHT WALDBEWIRTSCHAFTUNG SECTION A: PUBLIC SUMMARY / TEIL A: ÖFFENTLICHE ZUSAMMENFASSUNG Project Nr / Projekt- Nr.: 9210-CH Client / Kunde : Gruppe SELVA (Kantone Graubünden und Glarus) Web Page: www.selva-gr.ch SELVA Bündner Waldwirtschaftsverband Address / Adresse : Bahnhofplatz 1 CH-7302 Landquart Country / Land : Switzerland / Schweiz Certificate Nr. / Certificate Type: Group Forest Management SGS-FM/CoC-002279 Zertifikats-Nr. Waldbewirtschaftung Gruppenzertifizierung Date of Issue / Date of expiry: 18 Oct 2010 17 Oct 2015 Ausstellungsdatum SGS QUALIFOR FOREST MANAGEMENT STANDARD FOR SWITZERLAND AD 33-CH-02 Evaluation Standard / of 2010 Evaluationsstandard SGS QUALIFOR STANDARD FÜR DIE WALDBEWIRTSCHAFTUNG IN DER SCHWEIZ AD 33-CH-02, 2010 Forest Zone / Temperate/ gemässigte Waldzone Waldzone : Total Certified Area / 143’353 ha Zertifizierte Waldfläche: Scope / Management of the natural forests of the participants in the group certification SELVA of the Zertifizierungsbereich: associated regions (cantons Graubünden and Glarus, Switzerland) for the production of hardwood and softwood (round timber, industrial wood, energy wood), Christmas trees, decoration conifer branches and seedlings, for the manufacturing and processing of tables, benches, well water troughs, posts and torches of tree stem sections (Finnish candles). Bewirtschaftung der natürlichen -
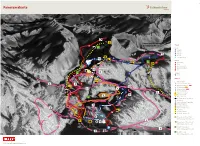
Tschiertschen Piste Map 2020
Panoramakarte artischock.net Urdenfürggli Hörnli Schwarzhorn 2680 m Verbindungsbahn Ski Safari Arosa – Lenzerheide nach Parpan Gürgaletsch Ski Safari 2440 m Alpstein Fussweg nach Parpan Ski Safari nach Parpan Pisten leicht Furgglis Gruoba Jochalp Zalaus Alp Farur Jochalp easy way down 2040 m Gruoba mittel Hüenerchöpf Spinazman Spina Früehschloucht Waldstafel Alpina-Parkplatz Spinazman Joch schwer Jakobi Diverses Furgglis Natureisbahn Sammelplatz Skischule Winterwanderweg Schlittelweg Prader Alp Spina Schneeschuhe Start Gleitschirm Natural Snowpark Mini Snowpark nach Praden Bergrestaurant Ski Safari ( nicht gesichert ) Kinderpark Fupps Gratis-Skibus ab Parkplatz Gratis-Parkplatz Start Freeride 1000 Ende Freeride 1000 Buckelpiste Freeride Praden Postauto-Haltestelle A Sesselbahn Waldstafel 1395 m lang; 1830 m ü. M. B Sesselbahn Hüenerchöpf 940 m lang; 2030 m ü. M. Molinis TSCHIERTSCHEN nach Praden 1350 m C Skilift Gürgaletsch Chur 1210 m lang; 2400 m ü. M. D Skilift Jochalp 750 m lang; 2030 m ü. M. SOS Zentrale + 41 (0) 81 373 01 02 Kontakt Schneesportschule Tarife Bergbahnen Tschiertschen Tourismusverein Skipass nicht übertragbar, ab AHV-Alter 15 % Reduktion 7064 Tschiertschen Tschiertschen–Praden Tage Erwachsene ab 18 J. Jugendliche ab 13 J. Kinder ab 6 J. Tel. +41 (0) 81 373 01 01 Tel. +41 (0) 81 373 10 10 0,5** 39.– 26.– 13.– [email protected] [email protected] 1 49.– 33.– 16.– tschiertschen.ch tschiertschen.ch 1,5 88.– 59.– 29.– 2 95.– 63.– 31.– SOS Pikett Rettungsdienst Schneesportschule Tel. +41 (0) 79 588 75 81 bei der Talstation 3 140.– 93.– 46.– Öffnungszeiten: 4 178.– 119.– 59.– 5 208.– 139.– 69.– Touristikinformationsband 9.30 – 10.30 / 15.30 – 17.00 Uhr Tel.