Jeanette Gallon Robert Schumann Oder Ferdinand Freiligrath
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Robert Schumann and the German Revolution of 1848,” for “Music and Revolution,” Concert and Lecture Series
Loyola University Chicago Loyola eCommons History: Faculty Publications and Other Works Faculty Publications 5-2-1998 “Robert Schumann and the German Revolution of 1848,” for “Music and Revolution,” concert and lecture series David B. Dennis Loyola University Chicago, [email protected] Follow this and additional works at: https://ecommons.luc.edu/history_facpubs Part of the History Commons Author Manuscript This is a pre-publication author manuscript of the final, published article. Recommended Citation Dennis, David B.. “Robert Schumann and the German Revolution of 1848,” for “Music and Revolution,” concert and lecture series. The American Bach Project and supported by the Wisconsin Humanities Council as part of the State of Wisconsin Sesquicentennial Observances, All Saints Cathedral, Milwaukee, Wisconsin, , : , 1998. Retrieved from Loyola eCommons, History: Faculty Publications and Other Works, This Article is brought to you for free and open access by the Faculty Publications at Loyola eCommons. It has been accepted for inclusion in History: Faculty Publications and Other Works by an authorized administrator of Loyola eCommons. For more information, please contact [email protected]. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License. © David B. Dennis 1998 “Robert Schumann and the German Revolution of 1848” David B. Dennis Paper for “Music and Revolution,” concert and lecture series arranged by The American Bach Project and supported by the Wisconsin Humanities Council as part of the State of Wisconsin Sesquicentennial Observances, All Saints Cathedral Milwaukee, Wisconsin, 2 May 1998. 1 Let me open by thanking Alexander Platt and Joan Parsley of Ensemble Musical Offering, for inviting me to speak with you tonight. -

Henry Wadsworth Longfellow
Henry Wadsworth Longfellow By Thomas Wentworth Higginson HENRY WADSWORTH LONGFELLOW CHAPTER I LONGFELLOW AS A CLASSIC THE death of Henry Wadsworth Longfellow made the first breach in that well- known group of poets which adorned Boston and its vicinity so long. The first to go was also the most widely famous. Emerson reached greater depths of thought; Whittier touched the problems of the nation’s life more deeply; Holmes came personally more before the public; Lowell was more brilliant and varied; but, taking the English-speaking world at large, it was Longfellow whose fame overshadowed all the others; he was also better known and more translated upon the continent of Europe than all the rest put together, and, indeed, than any other contemporary poet of the English-speaking race, at least if bibliographies afford any test. Add to this that his place of residence was so accessible and so historic, his personal demeanor so kindly, his life so open and transparent, that everything really conspired to give him the highest accessible degree of contemporary fame. There was no literary laurel that was not his, and he resolutely declined all other laurels; he had wealth and ease, children and grandchildren, health and a stainless conscience; he had also, in a peculiar degree, the blessings that belong to Shakespeare’s estimate of old age,—“honor, love, obedience, troops of friends.” Except for two great domestic bereavements, his life would have been one of absolutely unbroken sunshine; in his whole career he never encountered any serious rebuff, while such were his personal modesty and kindliness that no one could long regard him with envy or antagonism. -

Ferdinand Freiligrath (Gemälde Von Johann Peter Hasenclever)
1 Ferdinand Freiligrath (Gemälde von Johann Peter Hasenclever) Hermann Ferdinand Freiligrath (* 17. Juni 1810 in Detmold – † 18. März 1876 in Cannstatt bei Stuttgart), bis 1825 Gymnasium in Detmold, 1825-32 Kaufmannslehre in Soest, 1832 Kontoristenstelle in Amsterdam, 1837-1839 Buchhalter in Barmen, seit 1839 freier Schriftsteller in Unkel am Rhein, dann 1841 in Darmstadt, 1843-44 in St. Goar. Auf Empfehlung Alexander von Humboldts erhielt er 1842 vom preußischen König ein Ehrengehalt, wandte sich aber zunehmend republikanischen Idealen zu und verzichtete 1844 auf die königliche Pension. In Brüssel 1845 Bekanntschaft mit Karl Marx und Umzug nach Zürich in die Schweiz, dort Bekanntschaft mit Gottfried Keller und Franz Liszt, 1846 Tätigkeit als Korrespondent in London. 1848 Rückkehr nach Deutschland, Verhaftung wegen seines Appells zum Umsturz, Freispruch und Redakteur in der von Marx hrsg. „Neuen Rheinischen Zeitung“ in Köln bis zu deren Verbot im Jahre 1849. In den folgenden Jahren lebte er – zeitweise steckbrieflich gesucht – in den Niederlanden, in Düsseldorf und in London, wo er 1856 Filialleiter der Schweizer Generalbank wurde. Nach Schließung der Bankfiliale im Jahr 1865 veranstalteten Freunde ein der „Gartenlaube“ eine Sammlung für den Dichter, deren Ergebnis von rund 60.000 Talern ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichten. Von 1874 bis zu seinem Tode lebte er in Stuttgart-Cannstatt. Freiligrath war vor allem Lyriker und Übersetzer englischer und französischer Lyrik und Versepik. GG 2 [141] Das Nöttentor zu Soest. 1830. (Kurz vor Abbruch desselben gedichtet.) „Uns ist in alten Mären Wunders viel gesungen, Von Helden mit Lob zu ehren, von großen Handelungen Von Freuden und Festlichkeiten, – – – – – – – – – – – – – mögt ihr nun Wunder hören sagen.“ Lied der Nibelungen, Vers 1–4. -
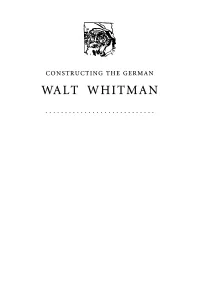
Walt Whitman
CONSTRUCTING THE GERMAN WALT WHITMAN CONSTRUCTING THE GERMAN Walt Whitman BY WALTER GRUNZWEIG UNIVERSITY OF IOWA PRESS 1!11 IOWA CITY University oflowa Press, Iowa City 52242 Copyright © 1995 by the University of Iowa Press All rights reserved Printed in the United States of America Design by Richard Hendel No part of this book may be reproduced or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, without permission in writing from the publisher. Printed on acid-free paper Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Gri.inzweig, Walter. Constructing the German Walt Whitman I by Walter Gri.inzweig. p. em. Includes bibliographical references (p. ) and index. ISBN 0-87745-481-7 (cloth), ISBN 0-87745-482-5 (paper) 1. Whitman, Walt, 1819-1892-Appreciation-Europe, German-speaking. 2. Whitman, Walt, 1819-1892- Criticism and interpretation-History. 3. Criticism Europe, German-speaking-History. I. Title. PS3238.G78 1994 94-30024 8n' .3-dc2o CIP 01 00 99 98 97 96 95 c 5 4 3 2 1 01 00 99 98 97 96 95 p 5 4 3 2 1 To my brother WERNER, another Whitmanite CONTENTS Acknowledgments, ix Abbreviations, xi Introduction, 1 TRANSLATIONS 1. Ferdinand Freiligrath, Adolf Strodtmann, and Ernst Otto Hopp, 11 2. Karl Knortz and Thomas William Rolleston, 20 3· Johannes Schlaf, 32 4· Karl Federn and Wilhelm Scholermann, 43 5· Franz Blei, 50 6. Gustav Landauer, 52 7· Max Hayek, 57 8. Hans Reisiger, 63 9. Translations after World War II, 69 CREATIVE RECEPTION 10. Whitman in German Literature, 77 11. -

Court Counsellor to Berlin Bohemian: Geography and Age in German Literary Production
Appendix: Court Counsellor to Berlin Bohemian: Geography and Age in German Literary Production Lukas Kuld∗and John O'Hagan† Contents 1 Figures1 2 Tables9 1 Figures ∗TU Dortmund †Trinity College Dublin 1 Figure 1: Years of writers aged 18 to 50 per location (a) Before unification 43 10 13 11 21 10 22 26 37 27 25 329 33 15 36 13 10 101 32 27 20 125 12 55 65 58 10 18 168 30 10 23 26 10 15 37 14 32 32 11 25 22 19 28 20 13 19 82 70 23 70 (b) After Unification 29 10 11 372 16 12 15 14 12 19 160 10 2 Notes: The maps show the sum of years that German writers reside in a district before and after the unification in 1871. Numbers are shown for districts with more than nine writer-years. Figure 2: Location by year by agglomeration and city type (a) Agglomerations 20 Romanticism Vormärz Enlightenment Classicism Realism Modernism Biedermeier Napoleonic era Unification Revolutions WWI 3rd Reich Territorial consolidation Berlin capital 15 10 #Writers 5 0 1800 1900 Year City Berlin Maulbronn Munich Naumburg (b) Categories 20 15 10 #Writers 5 0 1800 1900 Year City Large Small, uni Abroad Other Notes: The plots show the number of adult writers per category. The first plot shows writers in circles with a radius of 60km. Naumburg importantly contains the cities Weimar, Jena, and Leipzig. Maulbronn contains Stuttgart, T¨ubingen,and Heidelberg. 3 The second plot shows writers per category: major cities, small university cities, cities outside modern Germany and Poland, and other known locations within Germany/Poland. -

Franz Liszt's Songs on Poems by Victor Hugo Shin-Young Park
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2007 Franz Liszt's Songs on Poems by Victor Hugo Shin-Young Park Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC FRANZ LISZT’S SONGS ON POEMS BY VICTOR HUGO By SHIN-YOUNG PARK A Treatise submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Music Degree Awarded: Summer Semester, 2007 The members of the Committee approve the Treatise of Shin-Young Park defended on May 10, 2007. _______________________ Carolyn Bridger Professor Directing Treatise _______________________ Jane Piper Clendinning Outside Committee Member _______________________ Timothy Hoekman Committee Member _______________________ Valerie Trujillo Committee Member The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii ACKNOWLEDGEMENTS First of all, I would like to express appreciation to my adviser, Dr. Carolyn Bridger, who led me with tireless encouragement to finish my doctoral degree. During my studies at the Florida State University, she was not only an excellent piano professor but also a generous guardian to me. I truly appreciate all that she has done for me. I also owe much to my committee members, Dr. Timothy Hoekman, Professor Valerie Trujillo, and Dr. Jane Piper Clendinning, especially for their flexibility during the final steps of my treatise. Dr. Hoekman helped me with splendid ideas on voice accompanying recitals and taught me the art of vocal coaching. I will never forget his passionate efforts. -

Finding Aid to the Henry Wadsworth Longfellow Dana
Longfellow National Historic Site CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS FINDING AID FOR HENRY WADSWORTH LONGFELLOW DANA (1881-1950) PAPERS, 1744-1972 (BULK DATES 1850-1950) FOURTH EDITION COLLECTION CATALOG NUMBER: LONG 17314 CATALOG NUMBER FOR INDEX CARD COLLECTION: LONG 18687 VARIOUS CATALOG NUMBERS FOR ITEMS CATALOGED INDIVIDUALLY PREPARED BY D.E.W. GODWIN ANITA B. ISRAEL JENNIFER H. QUINN Northeast MUSEUM SERVICES CENTER JUNE 2000 REVISED SUMMER 2007 CONTRIBUTORS Elizabeth Bolton Ann Marie Dubé Lauren Hewes Jalien Hollister Elizabeth Joyce Susan Kraft Steven James Ourada Jude Pfister John J. Prowse Amy E. Tasker Constance Tillinghast FY07 Project Margaret Welch Cover Illustration: Bachrach, Henry Wadsworth Longfellow Dana. Longfellow National Historic Site, Henry Wadsworth Longfellow Dana Papers (LONG 17314), Series IX. Collected Materials, box 141, folder 8. H.W.L. Dana Papers - i CONTENTS List of Illustrations......................................................................................................................... iii Preface..............................................................................................................................................v Restrictions ................................................................................................................................. vii Introduction.................................................................................................................................... 1 Part 1: Collection Description....................................................................................................... -

14. Friedrich Gottlieb Klopstock
https://www.openbookpublishers.com © 2021 Roger Paulin This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the text; to adapt the text and to make commercial use of the text providing attribution is made to the authors (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Attribution should include the following information: Roger Paulin, From Goethe to Gundolf: Essays on German Literature and Culture. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2021, https://doi.org/10.11647/OBP.0258 Copyright and permissions for the reuse of many of the images included in this publication differ from the above. Copyright and permissions information for images is provided separately in the List of Illustrations. In order to access detailed and updated information on the license, please visit, https://doi.org/10.11647/OBP.0258#copyright Further details about CC-BY licenses are available at, https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/ All external links were active at the time of publication unless otherwise stated and have been archived via the Internet Archive Wayback Machine at https://archive.org/web Updated digital material and resources associated with this volume are available at https://doi.org/10.11647/OBP.0258#resources Every effort has been made to identify and contact copyright holders and any omission or error will be corrected if notification is made to the publisher. ISBN Paperback: 9781800642126 ISBN Hardback: 9781800642133 ISBN Digital (PDF): 9781800642140 ISBN Digital ebook (epub): 9781800642157 ISBN Digital ebook (mobi): 9781800642164 ISBN Digital (XML): 9781800642171 DOI: 10.11647/OBP.0258 Cover photo and design by Andrew Corbett, CC-BY 4.0. -
Heinrich Heine
Literatur kompakt 1 Literatur Kompakt: Heinrich Heine Bearbeitet von Hartmut Kircher, Gunter E. Grimm 1. Auflage 2012. Taschenbuch. 268 S. Paperback ISBN 978 3 8288 2924 4 Format (B x L): 17 x 17 cm Weitere Fachgebiete > Literatur, Sprache > Deutsche Literatur Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. Hartmut Kircher HeiNriCH HeiNE Dr. Hartmut Kircher, geb. 1940, Studium der Germanistik und Romanistik Der Autor in Mainz, Kiel, Zürich und Köln. Promotion 1972 über Heinrich Heine und das Judentum. Bis 2005 Akademischer Oberrat am Institut für deutsche Spra- che und Literatur I der Universität zu Köln. Buchveröff entlichungen u.a. zu Heinrich Heine, Heinrich von Kleist, Robert Prutz, Max von der Grün; außerdem Deutsche Sonette, Dorfgeschichten aus dem Vormärz, Der Kriminal- roman, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Literatur und Politik in der Heine-Zeit (hg. zus. mit Maria Kłańska), Avantgarden in Ost und West um 1900 (hg. zus. mit Maria Kłańska u. Erich Kleinschmidt). Aufsätze über Heinrich Heine, Ferdinand Freiligrath, Georg Herwegh, Georg Weerth, Ludwig Börne, Carl Arnold Schloenbach, Hermann Broch, Guillaume Apol- linaire, Max von der Grün, Siegfried Lenz, Uwe Timm; außerdem Naturlyrik als politische Lyrik, Refl exe der Französischen Revolution im deutschen Vormärz, Sonettkunst um 1900, Alain Robbe-Grillet und Friedrich Dürrenmatt, Die De- struktion des Kriminalromans bei Peter Handke, Deutsche Lyrik nach der Wende. -

15 Dietmar Noering Ferdinand Freiligraths Gedicht »Von Unten Auf!
T HEMA Ferdinand Freiligrath Von unten auf! Ein Dämpfer kam von Bieberich: – stolz war die Furche, die er zog! Er qualmt’ und räderte zu Tal, daß rechts und links die Brandung flog! Von Wimpeln und von Flaggen voll, schoß er hinab keck und erfreut: Den König, der in Preußen herrscht, nach seiner Rheinburg trug er heut! Die Sonne schien wie lauter Gold! Auf tauchte schimmernd Stadt um Stadt! Der Rhein war wie ein Spiegel schier, und das Verdeck war blank und glatt! Die Dielen blitzten frisch gebohnt, und auf den schmalen her und hin, Vergnügten Auges wandelten der König und die Königin! Nach allen Seiten schaut’ umher und winkte das erhabne Paar; Des Rheingaus Reben grüßten sie und auch dein Nußlaub, Sankt Goar! Sie sahn zu Rhein, sie sahn zu Berg: – wie war das Schifflein doch so nett! Es ging sich auf den Dielen fast, als wie auf Sanssoucis Parkett! Doch unter all der Nettigkeit und unter all der schwimmenden Pracht, Da frißt und flammt das Element, das sie von dannen schießen macht; Da schafft in Ruß und Feuersglut, der dieses Glanzes Seele ist; Da steht und schürt und ordnet er – der Proletarier-Maschinist! Da draußen lacht und grünt die Welt, da draußen blitzt und rauscht der Rhein – Er stiert den lieben langen Tag in seine Flammen nur hinein! Im wollnen Hemde, halbernackt, vor seiner Esse muß er stehn! Derweil ein König über ihm einschlürft der Berge freies Wehn! Jetzt ist der Ofen zugekeilt, und alles geht und alles paßt; So gönnt er auf Minuten denn sich eine kurze Sklavenrast. -

Marx at the Margins: on Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies
Marx at the Margins Marx at the Margins On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies Kevin B. Anderson The University of Chicago Press Chicago & London Kevin B. Anderson is professor of sociology and political science at the University of California–Santa Barbara. He has edited four books and is the author of Lenin, Hegel, and Western Marxism: A Critical Study and, with Janet Afary, Foucault and the Iranian Revolution: Gender and the Seductions of Islamism. The University of Chicago Press, Chicago 60637 The University of Chicago Press, Ltd., London © 2010 by The University of Chicago All rights reserved. Published 2010 Printed in the United States of America 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 1 2 3 4 5 ISBN-13: 978-0-226-01982-6 (cloth) ISBN-13: 978-0-226-01983-3 (paper) ISBN-10: 0-226-01982-9 (cloth) ISBN-10: 0-226-01983-7 (paper) Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Anderson Kevin, 1948– Marx at the margins : on nationalism, ethnicity, and non-western societies / Kevin B. Anderson. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN-13: 978-0-226-01982-6 (cloth : alk.paper) ISBN-10: 0-226-01982-9 (cloth : alk. paper) ISBN-13: 978-0-226-01983-3 (pbk : alk. paper) ISBN-10: 0-226-01983-7 (pbk. : alk. paper) 1. Marx, Karl, 1818–1883— Political and social views. 2. Nationalism. 3. Ethnicity. I. Title JC233.M299A544 2010 320.54—dc22 2009034187 a The paper used in this publication meets the minimum requirements of the American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials, -

Heinrich Heine - Poems
Classic Poetry Series Heinrich Heine - poems - Publication Date: 2012 Publisher: Poemhunter.com - The World's Poetry Archive Heinrich Heine(13 December 1797 – 17 February 1856) Christian Johann Heinrich Heine was one of the most significant German poets of the 19th century. He was also a journalist, essayist, and literary critic. He is best known outside Germany for his early lyric poetry, which was set to music in the form of Lieder (art songs) by composers such as Robert Schumann and Franz Schubert. Heine's later verse and prose is distinguished by its satirical wit and irony. His radical political views led to many of his works being banned by German authorities. Heine spent the last 25 years of his life as an expatriate in Paris. <b>Childhood and Youth</b> Heine was born in Düsseldorf, Rhineland, into a Jewish family. He was called "Harry" as a child, but after his baptism in 1825 he became "Heinrich". Heine's father, Samson Heine (1764–1828), was a textile merchant. His mother Peira (known as "Betty"), née van Geldern (1771–1859), was the daughter of a physician. Heinrich was the eldest of the four children; his siblings were Charlotte, Gustav - who later became Baron Heine-Geldern and publisher of the Viennese newspaper Das Fremdenblatt - and Maximilian, later a physician in Saint Petersburg. Düsseldorf was then a small town with a population of around 16,000. The Revolution in neighbouring France and the subsequent Revolutionary and Napoleonic Wars which involved Germany meant that Düsseldorf had a complicated political history during Heine's childhood. It had been the capital of the Duchy of Jülich-Berg but at the time of his birth it was under French occupation.