Hochmittelalter
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Die Monatsschrift Für Alle Eichsfelder · Heft 11 · November 2009 53
53. Jahrgang H 11859 Die Monatsschrift für alle Eichsfelder · Heft 11 · November 2009 In dieser Ausgabe Dieterode - Deiderode Die November-Revolution 1918 in Duderstadt Mein schönstes Zur 825-Jahr-Feier von Grenzerlebnis Rengelrode Eine Grenze hat Geschichte Teistungenburg Einzelpreis 2,50 EUR incl. 7 % MWSt Eichsfelder Wurst- und Spezialitätenverkauf Gunkel 37359 Wachstedt/Eichsfeld · Bergstr. 7 · Tel. 036075-60014 · Fax 036075-52005 Email: [email protected] Wir bieten Ihnen Original Eichsfelder Wurstspezialitäten, warm verarbeitet, mit Naturgewürzen schmackhaft gewürzt, nach alter Tradition handwerklich hergestellt. – Stracke, Feldgieker, frische Runde, abgehangene Runde. In Glas oder Dose erhältlich: Leberwurst, Gehacktes (Mett), Sülze, Schwartenwurst, Eisbein, Blutwurst, Weckewurst, Zwiebelwurst (Sortimentenliste gern erhältlich) – Eichsfelder Schnittkäse (Demeter) – Wurst- und Spezialitätenversand – Eichsfelder Spezialitäten von Ihrem Regionalvermarkter Gunkel Eichsfelder Heimatzeitschrift – Die Monatsschrift für alle Eichsfelder 409 Mein schönstes Grenzerlebnis von Helmut Mecke 44 Jahre lang war die innerdeutsche Grenze mein Leben. Denn das „Ende der Welt“ war und die damit verbundene Teilung Deutsch- nur knapp drei Kilometer von meiner Haustür lands in Ost und West Teil meines Lebens. entfernt, und daher endeten die Streifzüge Stets wurde die Grenze von mir als etwas meiner Jugend in Richtung Osten stets am Bedrohliches, etwas Unüberwindbares emp- Stacheldraht der Zonengrenze. funden. Und mit den Jahren wurde die Vorstel- Nach der Eröffnung des Grenzübergangs Du- lung, dass die Bundesrepublik und die DDR derstadt/Worbis 1973 für den kleinen Grenz- wieder ein Staat werden würden, für mich im- verkehr versuchte ich mühsam und trotz viel- mer unwahrscheinlicher. facher Schikanen durch die Grenzer der DDR Dank der sehnsuchtsvollen Erzählungen mei- bei Besuchen mit meiner Familie, einen Teil ner Eltern erfuhr ich jedoch sehr früh, dass des Obereichsfeldes zu erschließen. -

Lokale Aktionspläne
Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ Lokale Aktionspläne Situations- und Ressourcenanalyse zu Strukturen im Landkreis Eichsfeld „Bestandsaufnahme zur Lebenssituation im Landkreis Eichsfeld“ Ansprechpartner: Katharina Müller Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V. Außenstelle Nordhausen Reichsstraße 30-31 99734 Nordhausen Kontakt 03631 475927 [email protected] Inhaltsverzeichnis 1. Anmerkungen ....................................................................................................... 3 2. Informationen: Zahlen, Daten, Fakten Landkreis Eichsfeld .................................. 3 3. Teilnahme am Bundesprogramm ......................................................................... 6 4. Bestandsaufnahme zur Lebenssituation im Landkreis Eichsfeld – Fragebogenerhebung ......................................................................................... 12 4.1 Ergebnisse der Lehrerbefragung ..................................................................... 12 4.2 Ergebnisse der Schülerbefragung ................................................................... 24 4.2.1 Angaben zum Wohnort/Familie ................................................................. 25 4.2.2 Freizeitgestaltung ...................................................................................... 35 4.2.3 Vereine ...................................................................................................... 44 4.2.4 Freizeit- und Kulturangebote im Landkreis Eichsfeld ................................ 46 4.2.5 Berufsfindung -
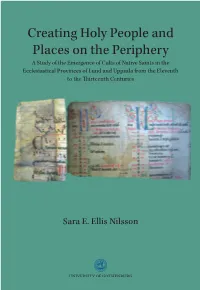
Creating Holy People and Places on the Periphery
Creating Holy People and People Places Holy on theCreating Periphery Creating Holy People and Places on the Periphery A Study of the Emergence of Cults of Native Saints in the Ecclesiastical Provinces of Lund and Uppsala from the Eleventh to the Thirteenth Centuries During the medieval period, the introduction of a new belief system brought profound societal change to Scandinavia. One of the elements of this new religion was the cult of saints. This thesis examines the emergence of new cults of saints native to the region that became the ecclesiastical provinces of Lund and Uppsala in the twelfth century. The study examines theearliest, extant evidence for these cults, in particular that found in liturgical fragments. By analyzing and then comparing the relationship that each native saint’s cult had to the Christianization, the study reveals a mutually beneficial bond between these cults and a newly emerging Christian society. Sara E. EllisSara Nilsson Sara E. Ellis Nilsson Dissertation from the Department of Historical Studies ISBN 978-91-628-9274-6 Creating Holy People and Places on the Periphery Dissertation from the Department of Historical Studies Creating Holy People and Places on the Periphery A Study of the Emergence of Cults of Native Saints in the Ecclesiastical Provinces of Lund and Uppsala from the Eleventh to the Th irteenth Centuries Sara E. Ellis Nilsson med en svensk sammanfattning Avhandling för fi losofi e doktorsexamen i historia Göteborgs universitet, den 20 februari 2015 Institutionen för historiska studier (Department of Historical Studies) ISBN: 978-91-628-9274-6 ISBN: 978-91-628-9275-3 (e-publikation) Distribution: Sara Ellis Nilsson, [email protected] © Sara E. -

Managementplan (Fachbeitrag Offenland) Für Das FFH- Gebiet 166 „Ohmgebirge“ (DE 4528-302) Und Teile Des SPA 11 „Untereichsfeld–Ohmgebirge“ (DE 4527-420)
Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH- Gebiet 166 „Ohmgebirge“ (DE 4528-302) und Teile des SPA 11 „Untereichsfeld–Ohmgebirge“ (DE 4527-420) Abschlussbericht Dessau-Roßlau, November 2019 LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff Zur Großen Halle 15 06844 Dessau-Roßlau Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH- Gebiet 166 „Ohmgebirge“ und Teile des SPA 11 „Untereichsfeld–Ohmgebirge“ (DE 4528-302) Abschlussbericht Auftraggeber Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz Göschwitzer Straße 41 07745 Jena Auftragnehmer LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH Zur Großen Halle 15 06844 Dessau-Roßlau Projektleitung Guido Warthemann Hauptbearbeitung Thomas Premper Guido Warthemann Weitere Bearbeiter Arne Willenberg LRT, Amphibien Dr. Thomas Hofmann Säugetiere Tobias Rauth Amphibien Uwe Patzak Vögel Technische Bearbeitung (FIS, GIS, Karten) Anke Stephani, Thomas Premper Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet Nr. 166 „Ohmgebirge“ und Teile des SPA 11 „Untereichsfeld – Ohmgebirge“ Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................ V Tabellenverzeichnis ................................................................................................................ VI Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................ VIII 1 Rechtlicher und organisatorischer Rahmen der Natura 2000-Managementplanung .... 1 1.1 Rechtlicher Rahmen ...................................................................................................................... -

Historical Pond-Breeding of Cyprinids in Sweden and Finland
CHAPTER 4 Historical Pond-Breeding of Cyprinids in Sweden and Finland Madeleine Bonow and Ingvar Svanberg This chapter describes and analyses the history of pond-breeding of fish in Sweden and Finland (which was an integral part of Sweden until 1809) from late medieval times until around 1900.1 Very little is known about the history of aquaculture in Sweden and Finland. Most published overviews are superficial. There are very few studies based on sources and hardly anything has been written by historians using modern methods and source criticism. We are therefore uncovering a long, although now broken, tradetion of fish cultivation in ponds which has left scant traces in the written record or the physical environment. We need to make some clear distinctions about types of aquaculture since much confusion arises from writers not differentiating among natural fish populations in natural or artificial ponds, unselective capture for stocking or storage of wild fish, selective stock and grow operations, and human management of breeding and species-specific stocking and artificial feeding or nutrient management. We deal mainly with the last case. We do not include marine aquaculture, which is a very recent phenomenon in Scandinavia. The overall purpose of our chapter is to discuss how fish kept in fishponds have been introduced, farmed and spread in Sweden and Finland in early 1 This chapter was written as part of “The story of Crucian carp (Carassius carassius) in the Baltic Sea region: history and a possible future” led by Professor Håkan Olsén at Södertörn University (Sweden) and funded by the Baltic Sea Foundation. -

Traditonelle Viertagewanderung Melsunger Turngemeinde 1861
Melsunger Turngemeinde 1861 Abt. Jedermannsport Traditonelle Viertagewanderung 21. – 24.Mai 2012 Wer seine Heimat nicht kennt, hat keinen Maßstab für fremde Länder. J.W. von Goethe Liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde, unsere diesjährige Viertage-Wanderung, übrigens die 39. seit 1974, führt uns in das Untere Eichsfeld. Im südlich davon gelegenen Oberen Eichsfeld, mit Quartier in Ershausen, waren wir im Jahre 2000 mit unserer Viertagewanderung. Das Untere Eichsfeld ist eine weiträumige wellige Landschaft mit wenig Wald. Wegen seines guten Ackerbodens, dem besonders fruchtbaren Löß, wird das Gebiet die „Goldene Mark“ genannt. Mittendrin liegt das Ohmgebirge, und deshalb ist diese Landschaft auch für uns Wanderer recht interessant. Am Fuße des Ohmgebirges liegt der Ort Wintzingerode, wo sich unser Hotel befindet. In geringer Entfernung liegt die 1000-jährige mittelalterliche Handelsstadt Duderstadt, die das Zentrum des Unteren Eichsfeldes bildet. Während Duderstadt nur wenige Kilometer von der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze im Westen lag, befindet sich unser Quartier in der ehemaligen DDR, im heutigen Bundesland Thüringen in Wintzingerode nördlich von Worbis. Wenn es bei den bisher gemeldeten 21 Personen bleibt, werden wir einen Teilnehmerrekord zu verzeichnen haben. Bisher hatten wir einige Male maximal 20 Teilnehmer, die sich dem Abenteuer einer solchen Viertagewanderung stellten. Und weil wir mit vier „Neulingen“ zu rechnen haben, wird es auch wieder zu einer „Massentaufe“ der Betreffenden kommen. Zu unserem Quartier wäre anzumerken, dass es am Ortsrand von Wintzingerode in ruhiger Lage liegt und es von dort aus nicht weit ist, um die noch intakte Burg Bodenstein zu erreichen. Direkt beim Hotel können wir problemlos unsere Autos parken. Statt der normalen Doppelzimmer werden uns „Suiten“ angeboten. -

Industrieparks Und Gewerbestandorte Der LMBV Liegenschaftskatalog Industrieparks Der LMBV
Industrieparks und Gewerbestandorte der LMBV Liegenschaftskatalog Industrieparks der LMBV Marga/Senftenberg 8 Sonne/Freienhufen 10 Kittlitz/Lübbenau 12 Lauchhammer 14 Espenhain 16 Großkayna-Frankleben 18 „Glückauf“ Sonderhausen 20 Blick über den entstehenden Großräschener See mit dem Lausitz-Industriepark Sonne/Großräschen im Hintergrund 2 Gewerbestandorte der LMBV Bischdorf 24 „Am Ohmberg“ Holungen/Bischofferode 26 „Am Kaliwerk“ Roßleben 28 Braunsbedra 30 Brehnaer Straße Bitterfeld-Wolfen 32 Meuselwitz Mitte Z III 34 Blick über den entstehenden Großräschener See mit dem Lausitz-Industriepark Sonne/Großräschen im Hintergrund 3 Standorte in Mitteldeutschland Spree 15 E lbe 13 Kleine Elster 14 S c h w a rz 9 e Saale E ls M te u r ld e 14 38 38 Weiß e Elster U n e st re ru p t 13 S 71 38 14 4 le a Pl a ei E S ße lbe 9 72 4 17 Mitteldeutsche Industrieparks Nr. Bezeichnung Landkreis Fläche (ha) verfügbar GM 01 Mitteldeutscher Industriepark Espenhain Leipzig 139,5 14,3 GM 02 Mitteldeutscher Industriepark Großkayna-Frankleben Saalekreis 47,1 21,9 GM 03 Gewerbe- und Industriepark „Glückauf“ Sondershausen Kyffhäuserkreis 190,0 5,5 Gewerbestandorte in Mitteldeutschland Nr. Bezeichnung Landkreis Fläche (ha) verfügbar GM 04 Industrie- und Gewerbegebiet „Am Ohmberg“ Holungen/Bischofferode Eichsfeld 67,1 3,0 GM 05 Industrie- und Gewerbegebiet „Am Kaliwerk“ Roßleben Kyffhäuserkreis 58,0 3,7 GM 06 Gewerbestandort Braunsbedra Saalekreis 26,6 15,7 GM 07 Mischgebiet Brehnaer Straße Bitterfeld-Wolfen Anhalt-Bitterfeld 1,4 1,4 GM 08 Gewerbegebiet Meuselwitz Mitte Z III Altenburger Land 9,9 5,1 4 Standorte in der Lausitz Spree 15 E lbe 13 Kleine Elster 14 S c h w a rz 9 e Saale E ls M te u r ld e 14 38 38 Weiß e Elster U n e st re ru p t 13 S 71 38 14 4 le a Pl a ei E S ße lbe 9 72 4 17 Lausitz-Industrieparks Nr. -

Unser Eichsfeld in Geschichte Und Gegenwart
63. Jahrgang Heft 3/4 2019 H 11859 Unser Eichsfeld in Geschichte und Gegenwart • Die Frühlingsgöttin Ostera • 25 Jahre Heyeröder Wappen • Josefswallfahrt nach Renshausen • 50 Jahre alter Entwurf einer Duderstadt- • Mühsame Wasserversorgung im Briefmarke Höhendorf Kalteneber • Die erste geologische Karte des Eichsfeldes • Eichsfelder Opfer bei den • Das Hochwasser im Jahr 1909 Märzkämpfen 1921 • Der Weißstorch im Eichsfeld Duderstadt 4,90 EUR incl. 7 % MWSt Das Eichsfeld sehen, fühlen und schmecken – das entspannte Dorfhotel DER KRONPRINZ lädt ein. Der Kronprinz | Fuhrbacher Str. 31-33 | 37115 Duderstadt / Fuhrbach [email protected] | www.der-kronprinz.de Mit einem Geschenk-Abo der Eichsfelder Heimatzeitschrift für Freunde und Bekannte verschenken Sie ein Stück Eichsfelder Kultur! Einen Bestellschein finden Sie im Internet unter https://shop.meckedruck.de/shop/ehz-bestellschein.pdf Eichsfelder Heimatzeitschrift – Unser Eichsfeld in Geschichte und Gegenwart 61 Die Frühlingsgöttin Ostera – eine Grafik von Josef Gottlieb Bekanntlich stellten sich die alten Germa- nen die Erscheinungen der Natur beseelt und mit menschlichen Eigenschaften aus- gestattet vor und erhoben sie zu Gotthei- ten. So verehrten die alten Deutschen eine Göttin, die zu Frühlingsanfang segenspen- dend durch die Lande zog. Es war Ostera, die Frühlingsgöttin. Von ihr soll der Name „Ostern“ abgeleitet sein. Auf dem Bilde, von Josef Gottlieb1 ge- zeichnet, sehen wir die Göttin Ostera blumenbekränzt auf einem weißen Ros- se aus den alten Wäldern unseres Ohm- gebirges herausreiten. Frühlingswehen umgibt sie. Donar, der Wettergott, der mit seinen Donnerkeilen die Unholde der Erde verscheuchen muss, begleitet sie. Auch Baidur, der Gott des Lichtes, ohne des- sen belebende Kraft der Segen der Göttin nutzlos wäre, schreitet an ihrer Seite. -

Hämta Rapporten
Sten, jord och klosterliv Cistercienserna i Europa och Sverige Seminarierapport 2 Nydala den 14 april 2005 Sten, jord och klosterliv Cistercienserna i Europa och Sverige Seminarierapport 2 Nydala den 14 april 2005 JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Kulturmiljöavdelningen, bebyggelse Byggnadsvårdsrapport 2006:107 Rapportredaktör: Jonas Haas, Hanne Romanus. Grafisk design: Anders Gutehall. Tryckning och distribution: Marita Axelsson Jönköpings läns museum. Box 2133. 550 02 Jönköping Tel: 036-30 18 00. E-post: [email protected] © JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2006 Innehåll Inledning ............................................................................................................................................................5 Den cisterciensiska klosteranläggningen i Sverige och Europa, Jan O M Karlsson...................................6 Alvastra klosterkyrka i förhållande till svenska cistercienserkyrkor och sockenkyrkor, Ann Catherine Bonnier ...................................................................................................................................... 14 Arkeologiska utgrävningar i Nydala 2004, Ann-Marie Nordman .............................................................. 20 Cistercienserna och den första europeiska gemenskapen, Brian Patrick McGuire.................................. 24 Nydala i de medeltida dokumenten, Jan Agertz.......................................................................................... 27 Paneldebatt..................................................................................................................................................... -

Catholic and Protestant Faith Communities in Thuringia After the Second World War, 1945-1948
Catholic and Protestant faith communities in Thuringia after the Second World War, 1945-1948 A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in History in the University of Canterbury By Luke Fenwick University of Canterbury 2007 Table of contents Abstract 1 Acknowledgements 2 List of abbreviations 4 List of figures and maps 5 Introduction 6 Chapter 1: The end of the war, the occupiers and the churches 28 Chapter 2: The churches and the secular authorities, 1945-1948 51 Chapter 3: Church efforts in pastoral and material care, 1945-1948 77 Chapter 4: Church popularity and stagnation, 1945-1948 100 Chapter 5: The social influence of the churches: native Thuringians and refugees 127 Chapter 6: The churches, the Nazi past and denazification 144 Chapter 7: Church conceptions of guilt and community attitudes to the Nazi past 166 Conclusion: The position and influence of the churches 183 Maps 191 Bibliography 197 II Abstract In 1945, many parts of Germany lay in rubble and there was a Zeitgeist of exhaustion, apathy, frustration and, in places, shame. German society was disorientated and the Catholic and Protestant churches were the only surviving mass institutions that remained relatively independent from the former Nazi State. Allowed a general religious freedom by the occupying forces, the churches provided the German population with important spiritual and material support that established their vital post-war role in society. The churches enjoyed widespread popular support and, in October 1946, over 90 percent of the population in the Soviet zone (SBZ) claimed membership in either confession. -

Download Free
Music and Nation essays on the time of german and italian unifications Sergio Durante Department of Music Harvard University 2019 Copyright 2019 by the President and Fellows of Harvard College ISBN 978-0-964031-9-1 Designed and published by the Harvard University Department of Music Essays 2, 3, and 4 were first given as spoken papers for a general audience as De Bosis Lectures in the History of Italian Civilization at Harvard Uni- versity on Sept. 22, Oct. 20, and Nov. 10, 2011. A version of Essay 2 has been published in Dramma giocoso. Four contemporary perspectives on the Mozart-Da Ponte Operas (Leuven, Leuven University Press, 2012). COVER ART: Friedrich Overbeck, Italia und Germania (Italy and Germany), finished in 1828. Source: Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/9/99/Friedrich_Overbeck_008.jpg Table of Contents Preface vii Between Germany and Italy: Tropes of Nationality and Music 1 Don Giovanni vs. Don Juan and Back 23 Mazzini as a Music Critic 45 Visions and Revisions of Risorgimento Music 67 A Taste of Italy or, Wagner before Wagner 87 Acknowledgments 97 Author’s Biographical Note 99 General Index 100 v Preface ergio Durante (Ph. D. Harvard University 1993) is Professor of SMusicology at the Università degli Studi di Padova. In the fall of 2011 he served as Lauro De Bosis Visiting Professor at Harvard, and as part of his contribution to the intellectual life of the University he presented a series of Lauro De Bosis Lectures in the History of Italian Civilization. Professor Durante here presents a revised and expanded version of these lectures, the result of careful consideration over a long period. -

Art Der Baulichen Nutzung: Es Ist Nur Ein Zweigeschossiges Mehrzweckgebäude Mit Entspre- Chenden Nebenanlagen Zulässig
Anlage UMWELTBERICHT Vorentwurf Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Neubau Werkstatt-Fahrzeughalle, Büro und 3 Ferienwohnungen“ Landgemeinde Sonnenstein Ortsteil Holungen Umweltbericht Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1 Stand: 05/2020 „Neubau Werkstatt-Fahrzeughalle, Büro und 3 Ferienwohnungen“ Landgemeinde Sonnenstein, Ortsteil Holungen 1. EINLEITUNG .................................................................................................................................................. 3 1.1 KURZDARSTELLUNG DER INHALTE UND ZIELE ............................................................................................................ 4 1.2 LAGE UND KURZCHARAKTERISTIK DES PLANGEBIETES ................................................................................................. 5 1.2.1 Landschaftsbild ................................................................................................................................................... 5 1.2.2 Lage im Naturraum ............................................................................................................................................ 6 1.2.3 Lage und derzeitige Nutzung des Planungsgebiets ................................................................................. 7 1.3 UMWELT- UND ÜBERGEORDNETE ZIELE ............................................................................................................. 9 1.3.1 Regionalplan ......................................................................................................................................................