Im Land Sachsen-Anhalt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
8995-15 RVH Landmarke 7 Engl. 2 Auflage 2015.Indd
Landmark 7 Kohnstein Hill ® On the 17th of November, 2015 in the course of the 38th General Assembly of the UNESCO, the 195 members of the United Nations organization agreed to introduce a new label of distinction. Under this label Geoparks can be designated as UNESCO Global Geoparks. The Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen is amongst the fi rst of 120 UNESCO Global Geoparks worldwide in 33 countries to be awarded this title. UNESCO-Geoparks are clearly defi ned, unique areas in which sites and landscapes of international geological signifi cance can be found. Each is supported by an institution responsible for the protection of this geological heritage, for environmental education and for sustainability in regional development which takes into account the interests of the local population. Königslutter 28 ® 20 Oschersleben 27 18 14 Goslar Halberstadt 3 2 8 1 Quedlinburg 4 OsterodeOsterode a.H. 9 11 5 13 15 16 6 10 17 19 7 Sangerhausen Nordhausendhahaussenn 12 21 Already in 2002, two associations, one of them the Regionalverband Harz, founded the Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen as a partnership under civil jurisdiction. In the year 2004, 17 European and eight Chinese Geoparks founded the Global Geoparks Network (GGN) under the auspices of the UNESCO. The Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen was incorporated in the same year. In the meantime, there are various regional networks, among them the European Geoparks Network (EGN). The regional networks coordinate international cooperation. The summary map above shows the position of all landmarks in the UNESCO Global Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen. South Harz Zechstein Belt 1 Kohnstein Hill, Niedersachswerfen On our tour of discovery through the Geopark we come from Ilfeld (in the area covered by Landmark 6 ), either by car on the B4 or with the Harz Narrow Gauge Railway, to Niedersachswerfen. -

Die Kulturhistorische Entwicklung Und Nutzung Der Karstlandschah Südharz
Die kulturhistorische Entwicklung und Nutzung der Karstlandschah Südharz Steffi Rahland; Heinz Naack Ein großer Teil der Karstlandschaft des Südharzes die Hermunduren, ein. Sie vermischten sich mit den grenzt an den Nordrand des fruchtbaren Tales hier schon ansässigen Volksstämmen. der Goldenen Aue. Diese schmale Niederung, Die ältesten Anlagen im Gebiet, die Wallburgen auf von der Helme durchflossen, ist der Ausgangs dem Arnsberg und auf der Queste bei Questenberg punkt der menschlichen Nutzung des Südharzran• (187) wurden in der frühen Eisenzeit errichtet. Die des. Bereits vor rund 7000 Jahren, in der Jung Anlage auf der Queste hat den Charakter einer steinzeit, begann hier die Siedlungsgeschichte. Volksburg und eines geschützten Kultplatzes. Bei den ersten Siedlern handelte es sich um Men Die natürlichen Bedingungen gaben den Menschen schen, die sich durch den Anbau von Kulturpflan der Eisenzeit die Möglichkeit, Eisenerz zu gewin zen, wie z.B. Getreide, und das Halten von Haus nen und zu verarbeiten. Den für die Verhüttung tieren ihre Nahrungsgrundlage erarbeiteten. Die notwendigen Brennstoff stellte man durch Verkoh Archäologie bezeichnet diese Kulturstufe als len von Holz her. Die Verhüttung erfolgte in Bandkeramik. Umfangreiche Auenlehmbildungen Schmelzöfen. Reste solcher Anlagen wurden bisher aus dieser Zeit weisen auf eine starke Erosion hin, bei Sangerhausen und Brücken gefunden. Mögli• die vermutlich durch Rodungen und Ackerbau cherweise war das der Beginn einer jahrhunderte ausgelöst wurde. Das sind die ersten uns bekann langen bergbaulichen Nutzung sowie der Entwick ten Umweltveränderungen in diesem Gebiet, die lung des Hüttenwesens am Südharzrand. Dadurch durch menschliche Einflüsse verursacht wurden. kam es abermals zu einem nachhaltigen Eingriff in Für ihre Siedlungen bevorzugten die Menschen in die Naturlandschaft. -

Der Landkreis Nordhausen
Begrüßung Tretet nur getrost diese Broschüre einen aus- führlichen Behördenwegwei- herein, sollet wohl ser an. Auch wichtige andere empfangen sein! Adressen und Sehenswürdig- keiten in unserem von der Natur besonders abwechs- Es sei mir als Landrat des lungsreich ausgestatteten Landkreises Nordhausen er- Landkreis möchten wir nen- laubt, Sie mit dem oben zitier- nen und vorstellen. ten klassischen Spruch im Landratsamt Nordhausen zu Ich danke den Inserenten, die begrüßen. den Druck dieses Wegweisers ermöglichten. Uns ist es ein Bedürfnis, daß derjenige, der unsere Mitar- beiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungsgebäuden aufsucht, gut geleitet dorthin Joachim Claus findet. Deshalb bietet Ihnen Landrat 1 Der Landkreis Nordhausen Der Landkreis Nordhausen befindet sich im dem Ausbau der Gewässer besteht in der Maße Franken diesen Raum. Mit der Wahl nördlichsten Teil des Freistaates Thüringen. Erhaltung und Wiederherstellung der des sächsischen Herzogs Heinrich zum Die Menschen sprechen die Nordthüringer natürlichen Verhältnisse an den Fließ- deutschen König Heinrich I. änderte sich das. Mundart. Als Städte liegen auf dem 711 km2 und Standgewässern. Renaturierungs- Er und seine Nachfolger legten rings um großen Territorium die große kreisan- bzw. Rückbaumaßnahmen an Wasserläu- den Harz Pfalzen, Königshöfe und Burgen gehörige Stadt Nordhausen, Bleicherode, fen werden dort, wo es möglich ist, durch- an, aus denen sich oft Städte entwickelten. Ellrich und Heringen. geführt. In den Flußtälern der Helme und Eine von diesen war Nordhausen, dessen Wipper befindet sich fruchtbares Flachland. erste urkundliche Erwähnung im Jahre Der Landkreis erstreckt sich von der Hain- Besonders berühmt ist die „Goldene Aue“. 927 erfolgte. Im frühen Mittelalter war leite im Süden bis in die Harzberge im der Harzraum also der politische Mittelpunkt Norden, vom Quellgebiet der Helme im Der Pflanzenreichtum unserer Landschaft des deutschen Reiches. -
11701-19-A0558 RVH Landmarke 12 Englisch
Landmark 12 Hohe Linde ® On the 17th of November, 2015, during the 38th UNESCO General Assembly, the 195 member states of the United Nations resolved to introduce a new title. As a result, Geoparks can be distinguished as UNESCO Global Geoparks. As early as 2004, 25 European and Chinese Geoparks had founded the Global Geoparks Network (GGN). In autumn of that year Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen became part of the network. In addition, there are various regional networks, among them the European Geoparks Network (EGN). These coordinate international cooperation. 22 Königslutter 28 ® 1 cm = 26 km 20 Oschersleben 27 18 14 Goslar Halberstadt 3 2 1 8 Quedlinburg 4 Osterode a.H. 9 11 5 13 15 16 6 10 17 19 7 SangerhausenSannggerrhaauusee Nordhausen 1212 21 In the above overview map you can see the locations of all UNESCO Global Geoparks in Europe, including UNESCO Global Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen and the borders of its parts. UNESCO-Geoparks are clearly defi ned, unique areas, in which geosites and landscapes of international geological importance are found. The purpose of every UNESCO-Geopark is to protect the geological heritage and to promote environmental education and sustainable regional development. Actions which can infl ict considerable damage on geosites are forbidden by law. Monument of mining history 1 Point cone mine dump Hohe Linde The pyramid north of the town of Sangerhausen can be seen far across the landscape and is the mine dump from the former Thomas Müntzer mine and a highly visible monument of mining history. The basis for more than 800 years of mining in the area of Sangerhausen was a rock layer of about 30 cm thickness – the copper shale. -

Biosphere Reserves in Germany 1 4
IN TOUCH WITH NATURE Biosphere reserves in Germany 1 4 2 3 5 6a 6c 6b 6d 7 8 9 6e 10 11 13 12 15 14 16 17 18 1 6a 7 11 15 2 6b 8 12 16 3 6c 9 13 17 4 6d 10 14 18 5 6e Foreword Seals, dippers, Rhön sheep, orchids, salt marshes UNESCO biosphere reserves must develop in line and more: the German biosphere reserves are char- with the 17 sustainability goals of Agenda 2030. acterized by a great diversity of habitats with a var- The Federal Government supports this by sup- ied range of animal and plant species. With their porting protection and development measures, for ancient beech forests, clear lakes, rugged karst land- example in the context of large nature conservation scapes, and craggy peaks, they are representative of projects or research projects. unique natural and cultural landscapes. Their ob- Biosphere reserves also contribute to regional jective is to promote sustainable development in all value creation through sustainable tourism and areas of life and economy, where people and nature creating jobs in structurally weak rural regions. are in harmony. As such, they are internationally They offer space for leisure, recreation, and to representative model regions. experience nature – be it on foot, by bike, or on In Germany, these fascinating landscapes and the water. In this way they inspire us about nature valuable ecosystems extend from the Wadden Sea and landscape, make us aware of the need to use to the Alps, from Neuwerk Island to Berchtes- them carefully, and invite us to help design a future gadener Land. -
11701-16-A0376 Rvh Lm 7
Landmarke 7 Kohnstein ® Am 17. November 2015, während der 38. General- versammlung der UNESCO, beschlossen die 195 Mit- glieds staaten der Organ i- sation der Vereinten Na- tionen die Ein führung eines neuen Labels. Mit diesem Label können Geoparke als UNESCO Global Geoparks ausgezeichnet werden. Zu den ersten weltweit 120 UNESCO Global Geoparks in 33 Ländern gehört auch der Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen. UNESCO-Geoparks sind klar abgegrenzte, einzigartige Gebiete, in denen sich Orte und Landschaften von geologisch internationalem Rang befi nden. Sie haben einen Träger, der sich für den Schutz des geologischen Erbes, für die Umweltbildung und eine nachhaltige Regionalentwicklung unter Einbeziehung der Bevölkerung einsetzt. Königslutter 28 ® 20 Oschersleben 27 18 14 Goslar Halberstadt 3 2 8 1 Quedlinburg 4 OsterodeOsterode a.H. 9 11 5 13 15 16 6 10 17 19 7 Sangerhausen Nordhausendhahaussenn 12 21 2004 gründeten 17 europäische und acht chinesische Geoparks das Global Geoparks Network (GGN) unter Schirmherrschaft der UNESCO. Noch im Herbst desselben Jahres wurde auch der Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen aufgenommen. Inzwischen gibt es verschiedene regionale Netzwerke, darunter das European Geoparks Network (EGN). Sie koordinieren die internationale Zusammenarbeit. Der oben stehenden Übersichtskarte können Sie die Lage aller bisher eingerichteten Landmarken im UNESCO Global Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen entnehmen. Südharzer Zechsteingürtel 1 Kohnstein Niedersachswerfen Auf unserer Erkundungsreise durch den Geopark kom- men wir aus dem Gebiet um die Landmarke 6 von Ilfeld entweder mit dem Auto auf der B 4 oder mit der Harzer Schmalspurbahn nach Niedersachswerfen. Beide Orte sind seit Anfang 2012 in der Gemeinde Harztor vereint. Richtung Niedersachswerfen folgten wir der Bere, einem 17 km langen Flüsschen, das bei knapp 600 m ü. -

Neue Und Interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleóptera, Chrysomelidae), Teil 2
Thüringer Faunistische Abhandlungen VI 1999 S. 201-210 Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleóptera, Chrysomelidae), Teil 2 F r ank Fr itzlar , Jena Zusammenfassung Für 77 Arten der Blattkäfer (Chrysomelidae) werden bisher unpublizierte faunistisch bemerkenswerte Funde aus Thüringen mitgeteilt, die meisten aus den letzten 3 Jahren. Ein Neunachweis für Thüringen und für ganz Mitteldeutschland ist Longitarsus brisouti. Wiedergefunden wurden 5 Arten, die seit mehr als 60 Jahren verschollen waren ( Cryptocephalus distinguendus , Longitarsus gracilis, L. languidus, Altica palustris und Neocrepidodera nigritula) und eine seit ca. 40 Jahren verschollene Art (Psylliodes vindobonensis). Für 19 Arten stellen die Meldungen Erstnachweise für einzelne Landschaften Thüringens dar. Für die weiteren Arten gab es wegen taxonomischer Unklarheiten bisher nur wenige sichere faunistische Angaben oder ihr Vorkommen ist deutschlandweit faunistisch interessant. Summary New and interesting records of Thuringian leafbeetle species (Coleoptera, Chrysomelidae), part 2. Records of 77 leafbeetle species from Thuringia, Central Germany, are listed. Longitarsus brisouti is new for Thuringia and Central Germany. Five current records refer to species that had been missed since more than 60 years (Cryptocephalus distinguendus , Longitarsus gracilis, L. languidus, Altica palustris and Neocrepidodera nigritula). Psylliodes vindobonensis was rediscovered after about 40 years of missing since the last record in Thuringia. Nineteen species are new to different regions within Thuringia. For the remaining species mentioned earlier records were rare or doubtful because of taxonomic uncertainties, or their occurrence is of importance for the fauna of entire Germany, respectively. 1. Einleitung Im ersten Teil der Mitteilungen Thüringer Blattkäferfunde (F ritzlar 1998) wurde die Lücke zwischen den vorliegenden zusammengefaßten Ergebnissen der Faunistik (F ritzlar & P erner 1994, K öhler & K l a u sn it z e r 1998), und den publiziert vorliegenden detaillierten Fundmeldungen geschlossen. -

Der Gemeinde Südharz Inhalt
AMTSBLATT der Gemeinde Südharz mit den Ortsteilen Agnesdorf, Bennungen, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Dittichenrode, Drebsdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Kleinleinungen, Questenberg, Roßla, Rottleberode, Schwenda, Stadt Stolberg (Harz), Uftrungen, Wickerode Jahrgang 9, Nummer 19 Freitag, den 28. September 2018 Inhalt Öffentliche Bekanntmachungen Seite 2 Wir gratulieren Seite 5 Aus den Ortschaften Seite 6 Was ist wann geöffnet Seite 13 Termine und Informationen Seite 14 Pressemitteilungen Seite 14 Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.gemeinde- suedharz.de Sitz der Gemeinde: 06536 Südharz, OT Roßla, Wilhelmstraße 4 Seite 2 Südharz Nr. 19/2018 Die Verwaltung informiert Öffentliche Bekanntmachungen Wichtige Information für die Ortsteile Agnesdorf, Questenberg, Rottleberode und Stadt Stolberg (Harz) Jährliche Entleerung von Kleinkläranlagen und Abflusslosen Sammelgruben Zeitraum für Agnesdorf und Questenberg Wichtige Hinweise 1. bis 17. Oktober 2018 Gemäß § 19 der geltenden Abwasserbeseitigungssatzung der Zeitraum für Stolberg und Rottleberode Gemeinde Südharz müssen Hauskläranlagen und Abflusslose 18. bis 31. Oktober 2018 Sammelgruben regelmäßig entschlammt bzw. entleert werden. Sollte die jährliche Entsorgung noch nicht erfolgt sein, können Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf, jedoch min- Sie diese in den oben genannten Zeiträumen mit dem von der destens ein Mal je Jahr geleert, Schlamm aus Hauskläranla- Gemeinde beauftragten Unternehmen vereinbaren. gen muss mindestens ein Mal jährlich abgefahren werden, es sei denn, Sie haben einmalig eine abweichende Häufigkeit bei Beauftragter Entsorger: Firma Rohr-Service-Arndt, der Gemeinde Südharz beantragt und diese wurde durch Be- Sangerhausen scheid bestätigt. Telefonnummer: 03464 579144 Den Antrag zur abweichenden Häufigkeit der Entsorgung rei- Für Fragen steht Ihnen die Gemeinde Südharz gern zur Ver- chen Sie bitte formlos, schriftlich und unter Bekanntgabe der fügung: Gründe bei der Gemeinde Südharz ein. -
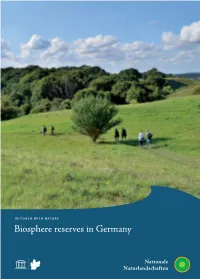
Biosphere Reserves in Germany 1 4
IN TOUCH WITH NATURE Biosphere reserves in Germany 1 4 2 3 5 6a 6c 6b 6d 7 8 9 6e 10 11 13 12 15 14 16 17 18 1 6a 7 11 15 2 6b 8 12 16 3 6c 9 13 17 4 6d 10 14 18 5 6e 1 4 2 3 5 6a 6c 6b 6d 7 8 Foreword 9 6e Seals, dippers, Rhön sheep, orchids, salt marshes UNESCO biosphere reserves must develop in line and more: the German biosphere reserves are char- with the 17 sustainability goals of Agenda 2030. acterized by a great diversity of habitats with a var- The Federal Government supports this by sup- 10 11 ied range of animal and plant species. With their porting protection and development measures, for ancient beech forests, clear lakes, rugged karst land- example in the context of large nature conservation scapes, and craggy peaks, they are representative of projects or research projects. unique natural and cultural landscapes. Their ob- Biosphere reserves also contribute to regional jective is to promote sustainable development in all value creation through sustainable tourism and areas of life and economy, where people and nature creating jobs in structurally weak rural regions. are in harmony. As such, they are internationally They offer space for leisure, recreation, and to 13 12 representative model regions. experience nature – be it on foot, by bike, or on In Germany, these fascinating landscapes and the water. In this way they inspire us about nature valuable ecosystems extend from the Wadden Sea and landscape, make us aware of the need to use to the Alps, from Neuwerk Island to Berchtes- them carefully, and invite us to help design a future gadener Land. -

Begründung Zum Flächennutzungsplan Der Gemeinde Südharz Formeller Entwurf Juni 2019
GEMEINDE SÜDHARZ FLÄCHENNUTZUNGSPLAN Verfahrensstand: Juni 2019 Auftraggeber: Gemeinde Südharz Planverfasser: vertreten durch den Bürgermeister Ralf Rettig Dipl. Ing. Andrea Kautz Wilhelmstraße 4 Architekt für Stadtplanung 06536 Südharz Am Rosentalweg 10 Tel. 034651 3890 06526 Sangerhausen Fax 034651 38912 Tel. 03464 579022 E-Mail [email protected] Fax 03464 579024 [email protected] Begründung zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Südharz formeller Entwurf Juni 2019 GEMEINDE SÜDHARZ FLÄCHENNUTZUNGSPLAN Begründung Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung .................................................................................................................... 4 1.1. Aufstellungsverfahren ................................................................................................ 5 1.2. Kartengrundlage/ Darstellung ................................................................................. 13 1.3. Rechtsgrundlagen .................................................................................................... 13 2. Planungsgrundlagen ................................................................................................ 15 2.1. Lage im Raum ........................................................................................................... 15 2.1.1 Räumlich funktionale Einordnung ........................................................................... 15 2.1.2 Naturräumliche Gliederung...................................................................................... 17 2.2. Überörtliche -

NSG Alter Stolberg“
Thüringer Landesverwaltungsamt Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH-Gebiet „NSG Alter Stolberg“ FFH_008 (DE 4431-305) Abschlussbericht Halle (Saale), im November 2014 RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer Mühlweg 39 06114 Halle (Saale) Tel. 0345-1317580 Fax 0345-1317589 eMail: [email protected] Internet: www.rana-halle.de Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH-Gebiet Nr. 8 „NSG Alter Stolberg“ Bearbeiter Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH-Gebiet „NSG Alter Stolberg“ FFH_008 (DE 4431-305) Abschlussbericht überarbeiteter Stand 03/2016 Auftraggeber Thüringer Landesverwaltungsamt Referat 460 Weimarplatz 4 99423 Weimar Projektbegleitung Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie Referat 33 Dipl.-Ing. Dörthe MAHNKE Auftragnehmer RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer Mühlweg 39 06114 Halle (Saale) Tel. 0345-1317580 Fax 0345-1317589 eMail: [email protected] Internet: www.rana-halle.de Projektleitung und Redaktion Dipl.-Biol. Frank MEYER Hauptbearbeitung Dipl.-Ing. (FH) Astrid THUROW Teilbeiträge Dipl.-Biol. Markus DUCHECK LRT und Biotoptypen Dipl.-Biol. Dirk LÄMMEL Fische und Rundmäuler Dipl.-Biol. Thoralf SY Amphibien Dipl.-Ing. (FH) Astrid THUROW Hirschkäfer Dipl. Geogr. Janine WEBER Grundlagen Kartographie/GIS Dipl.-Ing. (FH) Astrid THUROW Dipl.-Geogr. Janine WEBER Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH-Gebiet Nr. 8 Verzeichnisse „NSG Alter Stolberg“ Inhalt Inhalt 1 Rechtlicher und organisatorischer Rahmen für Natura 2000-Gebiete ....................... -

03 Begründung 2009-Teil I-Klein
STADT NORDHAUSEN Flächennutzungsplan Begründung mit Umweltbericht Feststellungsbeschluss, April 2009 Stadt Nordhausen Dezernat für Bau, Wirtschaft und Umwelt Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtplanung Markt 1 Tel: 03631 696 403 99734 Nordhausen Fax: 03631 696 515 e-Mail: [email protected] Seite: 1 von 116 Seite: 2 von 116 April 2009 April 2009 Flächennutzungsplan der Stadt Nordhausen 7.4.2.4 Landwirtschaft............................................................................................................................... 70 7.4.2.5 Industrieelle Tierproduktion .......................................................................................................... 70 Begründung mit Umweltbericht 7.4.2.6 Freizeit........................................................................................................................................... 71 Inhaltsverzeichnis 7.4.3. Sonderbauflächen für Einzelhandel, großflächig (§ 11 Abs. 3 BauNVO)................................... 71 Seite 7.5. Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen gem. § 5 (2) Nr. 2 BauGB ............................................................................................................ 74 TEIL I Begründung gemäß § 5 (1) BauGB 7.6. Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge 1. Planerfordernis ............................................................................................................................... 4 gem. § 5 (2) Nr. 3 und (4) BauGB...............................................................................................